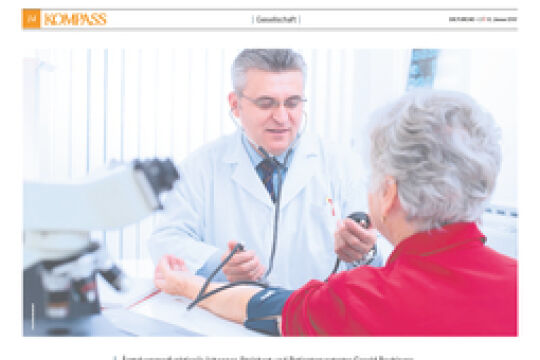Gesellschaft • Wer über die Art seines Sterbens mitbestimmen möchte, hat in Österreich zwei Möglichkeiten: Die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht.
"Ich will nicht sinnlos an Schläuche angehängt werden und vor mich hin vegetieren. Und ich will nicht anderen Menschen die Entscheidung aufbürden, wie ich sterben soll“, sagt Emil Pitelka. Der 82-jährige Wiener hat vorgesorgt: Er hat sich eine verbindliche Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht geholt. Dafür ließ er sich von einer Ärztin beraten, welche medizinischen Maßnahmen seinen Vorstellungen vom würdevollen Sterben entsprechen. Anschließend beglaubigte ein Notar die Dokumente. In Pitelkas Patientenverfügung ist genau beschrieben, welche Behandlungen er ablehnt: In aussichtslosen Situationen wünscht er keine künstliche Ernährung oder Beatmung. "Ich möchte nur Schmerzmittel bekommen, um friedlich sterben zu können. Denn worin besteht der Sinn, nur mehr mittels Maschinen am Leben erhalten zu werden?“
Sein Schritt ist die Ausnahme von der Regel: Nur vier Prozent der Österreicher verfügten 2009 - aktuellere Zahlen gibt es nicht - über eine Patientenverfügung. Eine Studie der Palliativ-Abteilung an der Universitätsklinik Wien sollte erforschen, warum Patienten diese Maßnahme bisher wenig nutzen. "Trotz ärztlicher Aufklärungsarbeit haben sich nur fünfzehn Prozent der Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium zu einer Patientenverfügung entschlossen“, berichtet Herbert Watzke, Leiter der Abteilung für Palliativmedizin am AKH Wien. Seine Studienergebnisse: 22 Prozent der Patienten gaben an, dass sie den Ärzten vertrauen. 15 Prozent meinten, dass sie zu optimistisch für eine Patientenverfügung seien. Acht Prozent befürchteten, die falsche Entscheidung zu treffen. Je sieben Prozent fühlten sich nicht gut genug informiert oder wollten die Entscheidung ihren Familien überlassen. Und vier Prozent hatten Angst, dass die Ärzte ihnen wichtige Maßnahmen vorenthalten könnten.
Sinnvolle Kommunikationsbrücke
Der anfängliche Widerstand der Ärzteschaft habe bereits nachgelassen, berichtet Patientenanwalt Gerald Bachinger: "Zuerst gab es Vorbehalte, dass ein Laie nicht entscheiden könne. Inzwischen sind immer mehr Ärzte froh über diese Kommunikationsbrücke.“ Im Falle der verbindlichen, also juristisch beglaubigten Patientenverfügung seien Ärzte rechtlich hundertprozentig abgesichert: "Jeder Arzt, der dem Patientenwillen folgt und deshalb etwa eine PEG-Sonde nicht setzt, ist auf der sicheren Seite“, betont Bachinger.
Auch Emil Pitelka hat sich für die verbindliche Patientenverfügung entschieden: "Damals wurde mir gesagt, das sei die sicherste Variante.“ Nur ein Drittel aller Patientenverfügungen in Österreich sind verbindliche. "Aber nur verbindliche und fachgemäß formulierte Patientenverfügungen schaffen für uns Ärzte Klarheit“, betont Watzke. Von Laien verfasste Formulierungen wie "Ich will nicht sinnlos am Leben gehalten werden“ seien zu vage. Je genauer die medizinische Situation definiert wird, desto wirksamer das Gesetz: "Wenn sich Patienten medizinisch beraten lassen und ihre Wünsche konkret formulieren, können sich die Ärzte kaum darüber hinwegsetzen“, bestätigt der Wiener Notar Michael Lunzer.
Die Grenzen der Vorhersehbarkeit
Doch Patientenverfügungen haben einen Haken: Wenn jemandem nichts Konkretes fehlt, ist es quasi unmöglich, sämtliche medizinische Behandlungen auszuschließen, die sich künftig ergeben könnten. Im Zweifelsfall muss der Arzt entscheiden: "Manchmal sind wir unsicher, ob die vom Patienten beschriebene Situation zutrifft“, räumt Watzke ein.
Die Entscheidung über Leben oder Tod kann für Ärzte weitreichende Folgen haben: Im schlimmsten Fall kann eine Fehlentscheidung das Ende einer Karriere und den finanziellen Ruin bedeuten. "Als Arzt tendiert man daher dazu, Hilfe zu leisten. Auch wenn man zweifelt, ob dies im Sinne des Patienten ist“, betont Watzke.
Für den Fall, dass die Patientenverfügung den Ärzten keine Klarheit verschaffen sollte, hat sich Emil Pitelka zusätzlich für eine Vorsorgevollmacht entschieden: Er hat seine Lebensgefährtin als Vertrauensperson bestimmt. Sie soll für ihn sprechen, wenn er selbst nicht mehr dazu in der Lage ist. Falls die 80-Jährige nicht mehr entscheidungsfähig sein sollte, werden nahestehende Freunde seine Anliegen vertreten.
Notar Lunzer rät in komplexen und unvorhersehbaren Situationen zur Vorsorgevollmacht: "Der Vorteil ist, dass man nicht heute schon etwas abschätzen muss, das nicht abschätzbar ist. Die Ärzte sind froh, wenn sie einen kompetenten, rechtlich gültigen Ansprechpartner haben.“ Auch Palliativmediziner Watzke sieht darin das bessere Instrument zur Kommunikation des Patientenwillens.
Kein Garantieschein
Noch ist das Patientenverfügungsgesetz lückenhaft: Es gibt bis heute kein zentrales Register für Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. "Und Ärzte sind nicht verpflichtet, dort nachzusehen“, kritisiert Patientenanwalt Bachinger. Deshalb sei es umso wichtiger, dass Hausarzt und Angehörige eine Kopie der Dokumente erhalten: "Gesetzlich liegt die Bringschuld bei den Angehörigen. "Es sollte eine Holschuld der Ärzte sein“, so Anna Pissarek vom Dachverband Hospiz Österreich.
Viele Mediziner seien nicht ausreichend informiert und unsicher bei der Beratung über Patientenverfügungen, kritisiert Pissarek: "Patienten erzählen, dass Ärzte damit keine Erfahrung haben oder die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Manche befürchten, dass sie bei Problemen belangt werden könnten, oder die nötige Zeit für die Beratung fehlt ihnen.“
Die Notare wiederum können nur die Ergebnisse der ärztlichen Beratung festhalten und über die Rechtslage informieren. Auch eine verbindliche Patientenverfügung sei kein "Garantieschein“, sondern bloß eine Entscheidungsgrundlage. Dennoch rät Pissarek zur Patientenverfügung: "Ansonsten halten Ärzte und Angehörige oft stark am Leben fest.“
Emil Pitelka würde noch viel weiter gehen - und sich aktive Sterbehilfe wünschen. "Es wäre schlimm, wenn ich mich quälen müsste und anderen ausgeliefert wäre.“ Den Ärzten vertraut der betagte Mann nicht blind: Weil es schwer mit ihrem hippokratischen Eid vereinbar sei, Leute sterben zu lassen. Er trägt immer einen speziellen Ausweis mit sich. Ob seine Vorkehrungen tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielen werden, weiß er nicht. Letztlich sind sie nur Wegweiser im Niemandsland zwischen Leben und Tod.