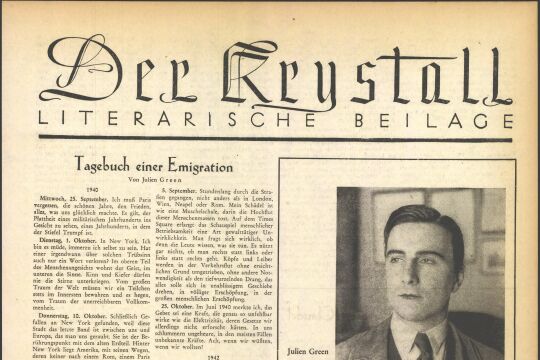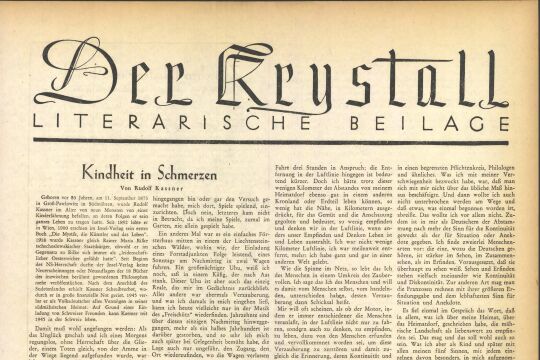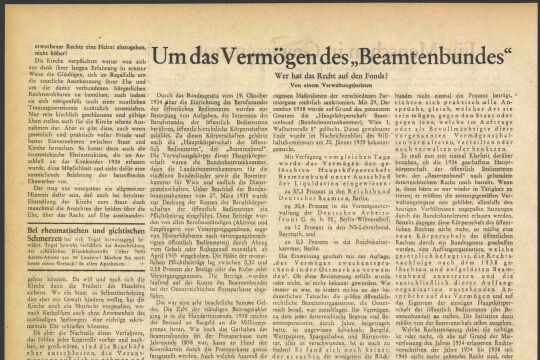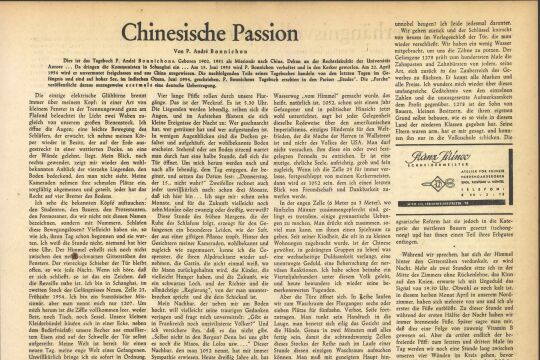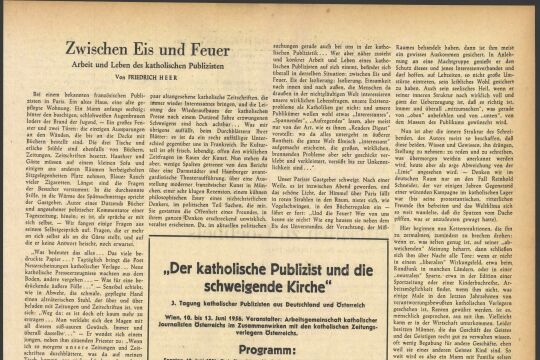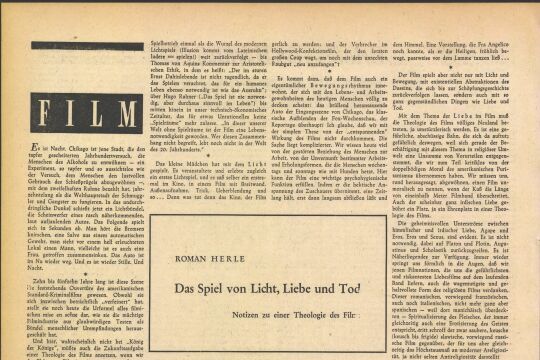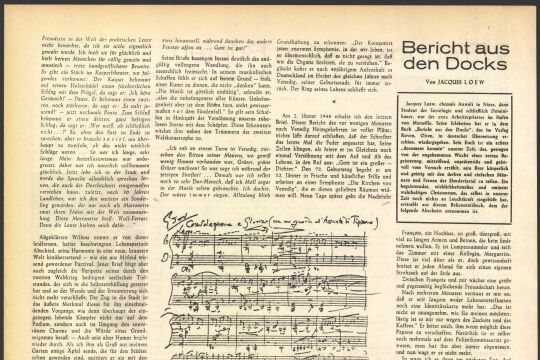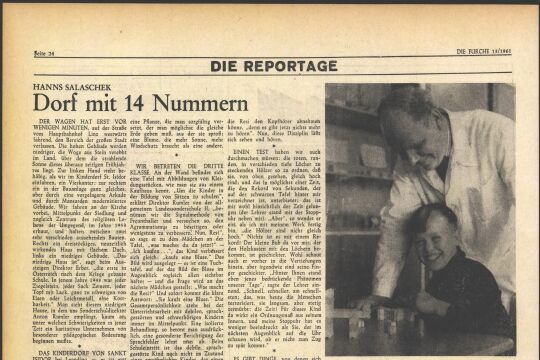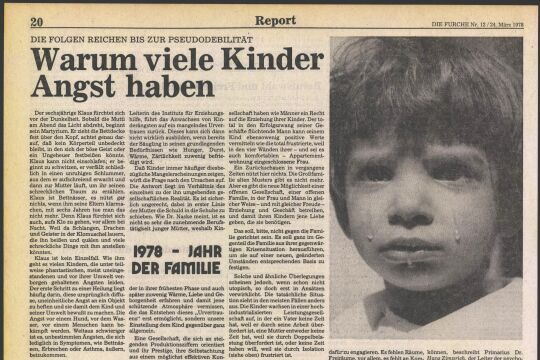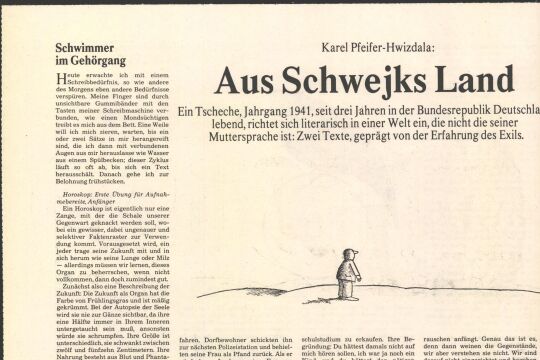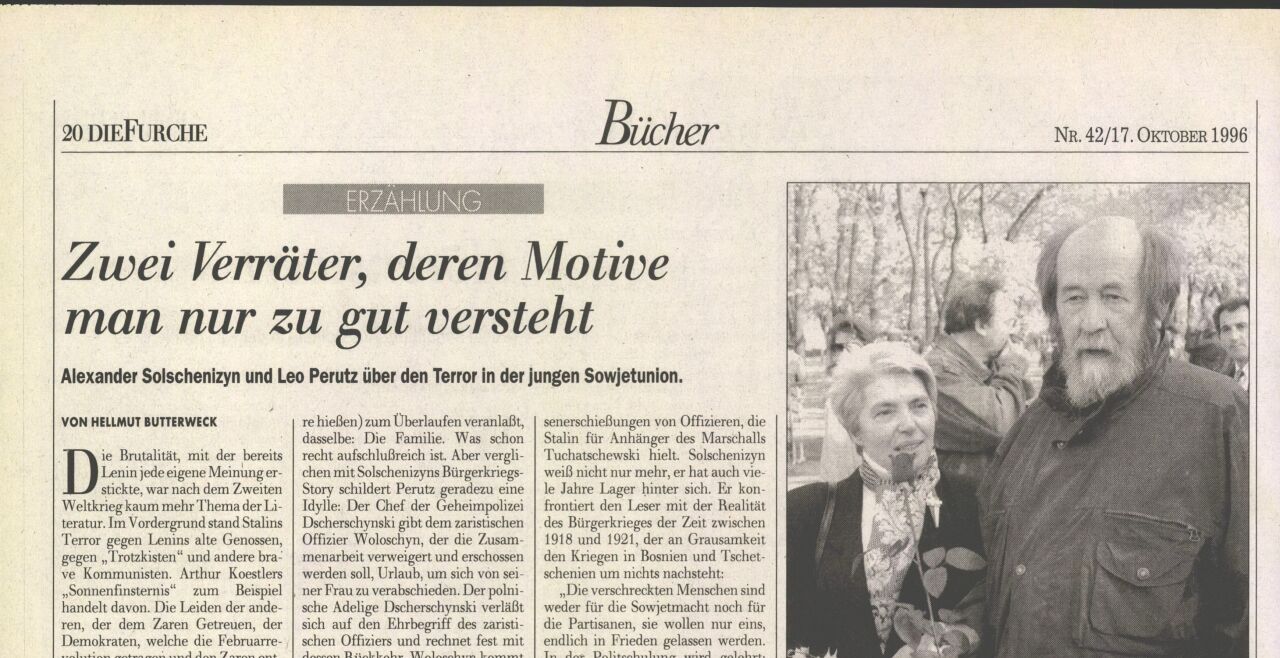
In den USA testet man derzeit ein Verfahren, mit dem „heiße” und „kalte” Hirnregionen bei Alzheimer-Patienten geortet werden können. Heiße und kalte Zonen unserer Gesellschaft werden in einem Boman von Leonore Suhl geortet. Die alzheimerkranke Hauptperson hat es noch gut, sie wird von der Familie versorgt. Üm Sauberkeit und Essen muß sie sich nicht kümmern, nur Gas und Strom hat man ihr nach gefährlichen Pannen abgedreht. Die zerbrochene Brille, das verlegte Gebiß, die Essen -reste, die sie für eine Katze sammelt, die seit zwanzig Jahren tot ist, all das wird bloß mit sanften Rügen quittiert.
Doch niemand hat Zeit, ihr die Verwirrungen im Kopf entwirren zu helfen. Sie will über Gefühle reden, doch weil sie die Fakten verwechselt, nimmt sie keiner ernst. Rald kann sie sich ihre Fragen nicht mehr bis zur Formulierung merken. Naph und nach verlernt sie das Reden. Der Rückzug in die Innenwelt schreitet voran, immer chaotischere Spuren hinterläßt sie in ihrer Umgebung.
„Wenn Frau Dahl so in die Tiefe des Nachthimmels blickte, ging ihr alles durcheinander: Hochzeiten, Bombenangriffe, angebrannte Mahlzeiten, Revolutionen, Mozartkugeln, falsche Versprechen.” Eben hat ihre kleine Enkeltochter noch mit ihren besten Blusen „große Wäsche” in der Wanne gespielt, plötzlich sitzt sie als Teenager mit ihrem Freund drin. Die liebevollen, oft komische Schilderungen erinnern an die Erzählungen des Neurologen Oliver Sacks über Patienten mit partiellen Gehirnstörungen.
Köstlich ist die Wiedergabe einer Familienfeier für die alte Dame. Zu vielen Stichworten fallen ihr Assoziationen ein, doch schon schwirrt das nächste Weltproblem über den Eßtisch. Der Autorin gelingt das Kunststück, die Informationsfetzen als auch für Gesunde unverdaulich erlebbar zu machen. Jeder redet an jedem vorbei. Die „Krankheit des Vergessens” erscheint an diesen Stellen als Ausweg zum Überleben in dieser informationsüberladenen Welt.
Daß auch die tatsächliche Überforderung der Familienangehörigen und viele Probleme des Altwerdens schlechthin deutlich gemacht werden, macht den Roman besonders lesenswert. Er ist ein Plädoyer für behutsamen Umgang mit Alten und Kranken, auch wenn sie längst in ihrer eigenen Welt leben und unsere nicht mehr verstehen: „Das Schlimmste war, daß man sich eigentlich nicht alt fühlte. Man war immer noch ein Kind. Ein uraltes, kaputtes Kind mit brüchigen Knochen und versagendem Gedächtnis, aber eben doch noch ein Kind.”