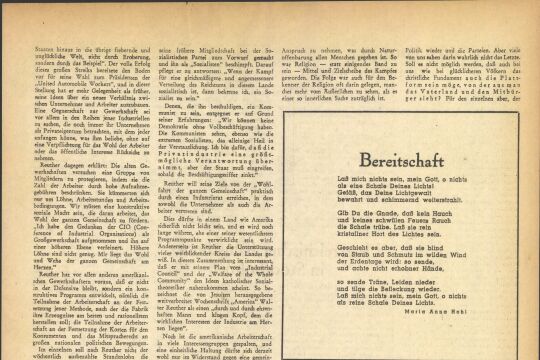Eine Universität lehrt: Integration
Ich habe es immer wieder erlebt, daß gerade diejenigen, die das Glück hatten, aus dem fernsten Osten des alten Österreich-Ungarn zu Stämmen, oft mehr als andere Verständnis für das Große hatten, das Österreich einst bedeutet hat. Sie sind daher heute — ob sie sich dessen bewußt sind oder nicht, vielfach auch bessere Europäer. Dazu kommt, daß das Nationalitätenproblem derzeit genauso aktuell ist wie am Ende des 19. Jahrhunderts. Erkennt man in Westeuropa diese Tatsache heute auch noch manchmal ungenügend oder gar nicht, so zeigt uns Mitteleuropäern die wachsende Bevölkerungsbewegung, das Phänomen der Gastarbeiter, daß das Nationalitätenproblem unter zeitlich gewandelten Bedingungen auch in unseren Tagen einer Lösung harrt. Es ist demnach verständlich, wenn man in der. Geschichte nach erfolgreichen Beispielen forscht. Dabei stößt man unweigerlich auf jene zwei gesetzlichen Regelungen,“ von denen man sagen kann, daß sie in kürzester Zeit beachtliche Fortschritte brachten: Mähren und die Bukowina mit ihren „Ausgleichen“, wie man die Lösung damals nannte. '
Ich habe es immer wieder erlebt, daß gerade diejenigen, die das Glück hatten, aus dem fernsten Osten des alten Österreich-Ungarn zu Stämmen, oft mehr als andere Verständnis für das Große hatten, das Österreich einst bedeutet hat. Sie sind daher heute — ob sie sich dessen bewußt sind oder nicht, vielfach auch bessere Europäer. Dazu kommt, daß das Nationalitätenproblem derzeit genauso aktuell ist wie am Ende des 19. Jahrhunderts. Erkennt man in Westeuropa diese Tatsache heute auch noch manchmal ungenügend oder gar nicht, so zeigt uns Mitteleuropäern die wachsende Bevölkerungsbewegung, das Phänomen der Gastarbeiter, daß das Nationalitätenproblem unter zeitlich gewandelten Bedingungen auch in unseren Tagen einer Lösung harrt. Es ist demnach verständlich, wenn man in der. Geschichte nach erfolgreichen Beispielen forscht. Dabei stößt man unweigerlich auf jene zwei gesetzlichen Regelungen,“ von denen man sagen kann, daß sie in kürzester Zeit beachtliche Fortschritte brachten: Mähren und die Bukowina mit ihren „Ausgleichen“, wie man die Lösung damals nannte. '
Die Bukowona war auf- kleinstem Raum nicht nur ein Abbild Österreichs mit allen seinen Nationalitäten und Konfessionen. Sie war auch eine der schönsten Leistungen österreichischer Staatskunst. Es sind erst zweihundert Jahre her, seit die 10.442 Quadratkilometer des Buchenlandes Österreich zugesprochen wurden. Damals, 1775, lebten kaum 70.000 Menschen auf diesem Gebiet; als Österreich im Jahre 1918 das Buchenland Rumänien überlassen mußte, war die Bevölkerung auf 800.000 angewachsen, während die Hauptstadt Czernowitz, vorher ein Dorf aus Lehmhütten, eine schöne Stadt mit mehr als 60.000 Einwohnern geworden war und oft als „Klein-Wien“ bezeichnet wurde.
Die Volkszählung des Jahres 1910, die letzte des österreichischen Regimes, wiederum, hatte in der Bukowina 305.222 Ukrainer (oder „Ruthe-nen“) festgestellt, 273.216 Rumänen, 168.799 Deutsche, davon rund 95.000 mit jiddischer Sprache, 36.217 Polen, 10.339 Magyaren, über 1000 Tschechen, Slowaken und kleinere Gruppen von Zigeunern, Armeniern oder Lippowanern. Auch die Religionsbekenntnisse ergaben ein vielfarbiges Bild mit 548.000 griechisch-orientalischen Christen, 103.000 Bürgern mosaischen Glaubens, nahezu 100.000 römischen Katholiken, mehr als -20.000 evangelischen Christen und dazu einer großen Anzahl anderer konfessioneller Gemeinschaften.
Im wahrsten Sinne des Wortes war daher die Bukowina das, was man „österreichisch“ nennen konnte. War das Dichterwort berechtigt, daß Österreich jene kleine Welt sei, in der die große ihre Probe hält, so kann man mit noch größerem Recht sagen, daß die Bukowina jene ganz kleine Welt war, in der sich Österreich widerspiegelte. Die Bukowina hat gezeigt, was möglich gewesen wäre, hätte Österreich inmitten der Stürme des 19. Jahrhunderts genügend Zeit gehabt, seine Grundsätze auf dem ganzen Reichsgebiet durchzusetzen.
;
Die Geschichte aller großen Universitäten lehrt: jede von ihnen verdankt ihren Ursprung einem Gedanken, einem Auftrag, der ihre Eigenart prägte. Sie alle wurden damit Träger einer wesentlichen Idee, ich möchte beinahe sagen: einer Philosophie. Das gleiche ließe sich übrigens auch von den Völkern sagen.
Nach der Besetzung von Czernowitz durch die Russen, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, entstand auf dem alten Boden eine neue Universität, die allein schon durch diese Tatsache sich in einem gewissen Ausmaß als eine Fortsetzung des Gewesenen verstehen will. Sieht man sich aber das Organigramm und die Studienpläne der alten -und der neuen Universität an, so wird klar, daß es zwischen beiden keine Kontinuität gibt. Schon allein in der Auswahl ihrer Wissensfächer hat die sowjetische Gründung nichts mehr mit der einstigen österreichischen Universität gemein, denn sie entspricht einer vollkommen anderen geistigen Einstellung. Die Alma Mater Francisco-Josephina hatte drei Fakultäten: die theologische, die philosophische und die juristische. Sie alle waren auf den Primat des Geistigen hin ausgerichtet, wenn auch innerhalb dieses Rahmens die Naturwissenschaften ihren berechtigten Platz einnahmen. Demgegenüber findet man im Studienprogramm der sowjetisch-ukrainischen Universität von Czernowitz keine Geisteswissenschaften mehr. Daß die theologische Fakultät, die ein Ruhm von Czernowitz gewesen ist, verschwinden mußte, wäre in einem Staate, der sich als atheistisch bezeichnet, noch verständlich. Ebenso ist es bezeichnend, daß in einem Gewaltregime, wie dem sowjetischen, die juristische Fakultät keinen Platz mehr hat. Aber auch die philosophische Fakultät wurde aufgelöst und durch eine ganze Reihe von Lernbereichen ersetzt, durch die philologische, die historische, die mathematische, naturwissenschaftliche, die biologische, die chemische und die geographische Fakultät. Schon diese Aufzählung zeigt, wie sehr eine Universität durch Auswahl ihrer Fächer ihre Grundeinstellung dartut.
In diesem Sinne lohnt es sich, den Versuch zu unternehmen, die Ideen Francisco-Josephinae, der einstigen Universität von Czernowitz, zu analysieren, ihre Bedeutung für die Gegenwart zu ermessen, um sich schließlich die Frage zu stellen, ob wir nach hundert Jahren von einem Erfolg oder Mißerfolg des großen geistigen Unternehmens sprechen können.
Es ist mit Recht festgestellt worden, daß jede politische Diskussion, die bis zu ihren letzten Konsequenzen durchgeführt wird, im theologischen Bereich endet. Dabei muß man selbstverständlich die Wörter „Politik“ und „Theologie“ in ihrem breitesten Sinne verstehen. Politik ist, so gesehen, das Wissen um das Leben einer Gemeinschaft und das Suchen nach den besten Mitteln, um diese Gemeinschaft richtig zu orientieren. Theologie wiederum befaßt sich mit den letzten Dingen, so auch mit der Beantwortung der Frage, welches der Platz des Menschen in der Schöpfung und was überhaupt der Sinn und das Ziel des Lebens ist. Geht man nämlich von dem Gedanken aus, daß zumindest auf dieser Erde der Mensch das bedeutendste Element ist, so muß man sich zunächst die Frage nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Gemeinschaft stellen. Steht die Gemeinschaft höher als der einzelne, ist sie demnach das wesentliche Element der Schöpfung und Grundrechtträger auch gegenüber dem Individuum? Um es theologisch auszudrücken: Ist der Mensch, wie uns der Glaube lehrt, ein Ebenbild Gottes, oder ist er autonom, selbstzwecklich, nicht dem Transzendenten verbunden? In biblischer Perspektive wäre er dann Luzifer, jener Geist, der sich selbst auf den höchsten Platz stellt, um von diesem aus sein autonomes Recht zu setzen — laut dem heiligen Augustinus eine „perversa imitatio Dei“. Die Frage ist eine grundsätzliche, denn ihre Beantwortung bestimmt die Haltung gegenüber den Mitmenschen: Achten wir diesen als ein Ebenbild Gottes, oder halten wir ihn für ein Objekt, mit dem wir nach Belieben verfahren können? Ist es unsere Aufgabe gegenüber unserem Nächsten, zu versuchen, ihm so wie er ist, möglichst viel Glück zu bescheren, oder können wir das Recht für uns in Anspruch nehmen, ihn unter Leugnung göttlicher Schöpfung selbst neu zu schaffen?
Es hat im Laufe der Geschichte immer wieder jene Bipolarität gegeben, die Zarathustra schon in frühester Zeit mit den Namen Ormuzd und Ariman ausdrückte. In unseren Tagen zeigt sich die gleiche Spannung in einer stärker politisierten und weniger theologisch orientierten Weise. Diese Bipolacität führt zwangsläufig zu einer Kategorisie-rung der Menschheit.
Im Politischen wiederum zeigt sich heute die wesentliche Spannung zwischen totalitären und nichttotalitären Menschen. Ein kluger politischer Beobachter hat schon vor vielen Jahren behauptet, die totalitäre Einstellung sei nicht so sehr eine politische Überzeugung wie eine Geisteskrankheit. Gewiß, der Satz ist übertrieben, sogar ungerecht, wenn wir an die große Anzahl von Mitläufern totalitärer Bewegungen denken. Er kommt aber doch sehr nahe an das Wesen der Dinge heran, weil eben der Totalitarismus unserer Zeit weitgehend nicht mehr ein politisches ' Problem, sondern Ausdruck der Einstellung zum Menschen ist.
Der nicht-totalitäre Mensch achtet seinen Nächsten. Er anerkennt die Grundrechte, die dieser nach eigenem Ermessen nützen kann. Er fühlt sich nicht berufen und nicht berechtigt, in diese Grundrechte einzugreifen. Er gibt auch ohne weiteres die Möglichkeit zu, daß er sich irren kann. Er beansprucht also für sich selbst keinerlei Unfehlbarkeit. Der nicht-totalitäre Mensch hat auch aus der Vergangenheit gelernt, daß der Wandel das Grundgesetz der Geschichte ist, daß daher Dinge, die zu einer bestimmten Zeit durchaus ihre Berechtigung haben, durch die Ereignisse überholt werden können. Er wird daher wohl Ideen treu bleiben, sich aber nicht unbedingt an äußere Formen klammern. Eine seiner wesentlichsten Tugenden ist die Toleranz, die wohl der beste Ausdruck für das Anerkennen der Rechte des Nächsten ist.
Der totalitäre Mensch demgegenüber glaubt, die absolute Wahrheit hier auf dieser Erde zu besitzen. In seiner luziferischen Anmaßung behauptet er, daß es auch in dieser unserer materiellen Welt unverrückbare Grundsätze gebe, die im Bereich der Politik einen ähnlichen Anspruch erheben können wie die
Religion im Bereich des Transzendenten. Da er sich allein im Besitz der Wahrheit wähnt, anerkennt er auch nicht das Recht der Dissidenz, den Anspruch seines Nächsten auf eine andere Auffassung. Logisch zu Ende gedacht, sieht er also in diesem Nächsten nicht ein Ebenbild Gottes. Das Wesen seiner Politik ist demnach der Zwang, mit dem er den Nächsten in missionarischem Eifer zu seinem vermeintlichen Glück nötigen will. Für ihn ist die Anwendung der Gewalt nicht ein unvermeidliches Übel, das erst dann Berechtigung hat, wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind, auf vernünftigem und gütlichem Wege das Ziel zu erreichen. Er sieht vielmehr in der Gewalt ein entscheidendes Element zur Neuschöpfung des Menschen.
Der Totalitarismus ist demnach ein politisches System, welches unweigerlich bei den Konzentrationslagern, den Massenerschießungen und der Gewaltanwendung verschiedenster Art, einschließlich dem Uberfall auf den Nachbarn, enden muß.
Eine weitere Charakteristik des Totalitären ist die Tatsache, daß die auf solchen Grundsätzen aufgebauten Systeme, historisch gesehen, nur kurze Dauer haben können. Ein französisches Sprichwort sagt „Chassez le naturel — il revient au galop“ — man verjage die Natur und sie kehrt im Galopp zurück. Das ist sogar bei den stärksten totalitären Systemen schon darum der Fall, weil der Mensch ein Wesen mit Leib und Seele ist, das seine eigenen Gedanken verfolgt und daher gegen die Unterdrückung früher oder später aufsteht.
In dieser größeren Perspektive war die Francisco-Josephina in Czernowitz Ausdruck des nichttotalitären Geistes. Schon ihre Anfänge sind bezeichnend. Wenn dabei auch ohne allzu viel Zeitverlust vorgegangen wird — denn die Gründungsphase vom Beschluß des Reichsrates bis zur Einweihung ist beispielgebend kurz — so wird trotzdem nichts überstürzt. Wo Widerstände entstehen, hat man die nötige Ausdauer und wartet zu. Weder Kaiser Franz Joseph, noch sein Unterrichtsminister Carl von Stremayr, noch der wahre Gründer und erste Rektor der Universität,. Constantin Tomaszczuk, sind Menschen, die das Bedürfnis haben, Pyramiden zu errichten und sich durch diese Universität zu verewigen. Sie wollen nicht Effekt, sondern Dauer. Alles wird unternommen, um die Rechte aller zu achten. Bezeichnend sind diesbezüglich die Debatten im Reichsrat.
Auch zu einer Zeit, als für das Regierungsprojekt bereits die Mehrheit vorhanden ist, wird auf die Anträge der Minderheiten gehört und diesen Vorschlägen Rechnung getragen. Es geht darum, einen möglichst breiten Konsensus zu schaffen — daher dann auch die überwältigende par--lamentarische Mehrheit für die Universität.
Diese Grundeinstellung der Universität, die Toleranz, die von Anfang an bei der Alma Mater Francisco-Josephina Pate gestanden ist, drückt sich, greifbar für alle, in der richtig verstandenen Ökumene aus.
Eine solche Ökumene ist besonders in Gebieten mit national und religiös gemischter Bevölkerung notwendig, wie dies in der Bukowina der Fall war. Daher war auch die Universität von Anfang an grundsätzlich religiös eingestellt, wie die Schaffung einer theologischen Fakultät beweist; anderseits war die Universität aber tolerant, weil es die Verschiedenheit der Glaubensgemeinschaften so verlangte.
In diesem Sinne war die Fakultät für griechisch-orientalische Theologie in Czernowitz von ganz besonderer Bedeutung. Sie war nämlich nicht nur die erste ihrer Art in diesem osteuropäischen Raum; noch wichtiger ist die Tatsache, daß sie von Anfang an über die österreichischen Grenzen hinausgriff und den im Ausland beheimateten Rumänen und Ukrainern zur Verfügung stand. Auf der theologischen Fakultät bestand freundschaftliche Koexistenz zwischen den verschiedenen Sprachengruppen, insbesondere infolge der örtlichen Gegebenheiten zwischen Ukrainern und Rumänen.
Ebenso war die Roll, der Juden an der 'Universität bezeichnend. Im letzten österreichischen Friedensjahr 1913/14 waren von den 1198 Studenten 431 Juden. Allgemein konfessionell aufgegliedert, stellten die Griechisch-Orientalen rund drei Fünftel, die mosaischen Studenten ein Drittel der Hörerschaft. Unter den studentischen Organisationen spielten die jüdischen Verbindungen eine bedeutende Rolle. Nicht zu übersehen ist in diesem Zusammenhang auch der Einfluß der Universität Czernowitz auf die Entwicklung des Zionismus. Nach weitverbreitetem Glauben hätte nun eine solche Konzentrierung jüdischer Elemente zu antisemitischen Bewegungen führen müssen, aber gerade das Gegenteil war in Cernowitz der Fall. Dort gab es, unter gegenseitiger Achtung, ein harmonisches Zusammenleben zwischen den Juden und den nichtjüdischen Studenten. Von den 44 Rektoren der Universität waren neun Juden. Bezeichnend ist, daß heute noch einstige jüdische Studenten der Universität Czernowitz im fernen Israel die Tradition ihrer Alma Mater aufrechterhalten.
Genau das gleiche trifft natürlich auf die katholischen und evangelischen Christen zu, die sich ebenfalls auf vorbildliche Weise in das Leben der Universität einfügten.
Wie auf dem Gebiete der Religion, gab es in Czernowitz auch eine kulturelle Ökumene. Es wurde bereits im Zusammenhang mit der theologischen Fakultät darauf hingewiesen, welche Bedeutung für Rumänen und Ukrainer die Errichtung von Lehrstühlen in ihrer Sprache gehabt hat. Das gilt am meisten für die Ukrainer, die damals in Groß-Ruß-land keine Möglichkeit hatten, ihre Eigenart zu entfalten und ihre Sprache zu pflegen. Die Tatsache, daß Lehrstühle für rumänische und ukrainische Literatur geschaffen wurden, weist auf den Respekt für die geistigen Leistungen von Völkern hin, deren Rang allzuoft im Westen verkannt wird.
Kultureller Ökumenismus drückt Fortsetzung auf Seite 10