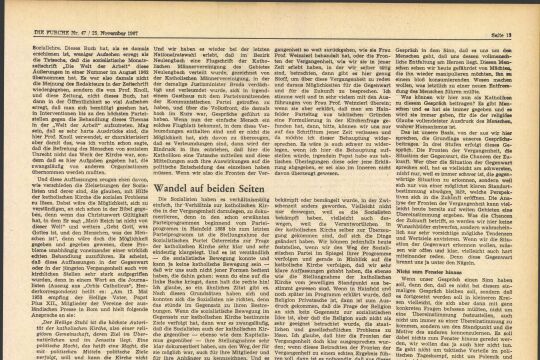In der heutigen innerkirchlichen Diskussion spielt das Wort „Mitte“ eine große, in ihrer Bedeutung und in ihrer Problematik oft nicht erkannte Rolle. Man sagt, um die Position irgendeines Diskussionsteilnehmers kurz zu charakterisieren, er stehe „links von der Mitte“ — und das gilt im allgemeinen ohne nähere Nachprüfung als Synonym für zeitgemäß, fortschrittlich, aufgeschlossen. Oder man stuft einen Diskussionsteilnehmer — und das geschieht selten ohne diskriminierenden Unterton — als „rechts“ oder gar als „rechtskonservativ“ ein und will damit in der Regel sagen, daß er sich eigentlich selbst aus dem Gespräch gezogen habe, indem er als unzeitgemäß, rückschrittlich, starr am Alten festhaltend erschienen sei.
Wenn soviel von links und rechts die Rede ist, drängt sich die Frage auf, wo denn eigentlich die Mitte liege, von der aus solche Positionsbezeichnungen überhaupt erst einen Sinn gewinnen.
Um über die unkritische Weiterverwendung beliebter Aufklebeetiketten hinauszugeianigen, muß man sich zunächst vor Augen führen, daß die Begriffe, um die es hier geht, allesamt aus dem Bereich des politischen, genauer gesagt: des modernen parlamentarischen Lebens stammen. Sind die Begriffe „rechts“ und „links“ schon im politischen Bereich äußerst problematisch geworden, so muß man sie erst recht mit Vorsicht gebrauchen, wenn man darangeht, sie auf geistig-kulturelle und kirchliche Phänomene zu übertragen.
Beim Nachdenken über die Frage, was ,,Mitte“ im Kontext der heutigen innerkatholischen Auseinandersetzung heißt, kann man nicht davon absehen, daß die politische Partei, die drei Menschenalter hindurch für die Mehrheit der kirchentreuen Katholiken Deutschlands die politische Heimat (und für viele seit dem Kulturkampf noch einiges mehr) bedeutet hat, den Namen „Mitte“ trug: das Zentrum. Als 1858 im preußischen Landtag erstmals eine Fraktion von Abgeordneten unter dieser Bezeichnung auftrat, geschah dies nach reiflicher Überlegung unter ausdrücklicher Bezugnahme auf zwei Gegebenheiten: auf den Platz, den diese Fraktion in der Mitte des Hauses einzunehmen wünschte, und auf das politische Programm, das sich gleichermaßen von der konservativen Rechten wie von der liberalen Linken abheben sollte.
Einen „Katholischen Club“ hatte es zwar schon in der Frankfurter Pauls-Kirche 1848'49 gegeben, aber dieser war kein primär politischer, sondern ein konfessioneller Zusammenschluß gewesen. Die „Fraktion des Zentrums“ wollte das Gegenteil sein: Eine politische Partei, die auch Nichtkatholiken offenstehen sollte.
Daß die große Tradition des Zentrums, dessen Wähler sich bis zu den letzten freien Wahlen 1933 als erstaunlich immun gegen den Nationalsozialismus erwiesen haben, zumal bei den Älteren heute noch mitschwingt, wenn im katholischen Bereich das Wort „Mitte“ als Positionsbezeichnung gebraucht wird, und daß sich damit die Wertvorstellung von einer gesunden, redlichen, ausbalancierten, vernünftigen Mitte verbindet, ist durchaus verständlich und jedenfalls in Rechnung zu stellen. Ob dadurch die Ortsbestimmung für die kirchliche Gegenwart eher erschwert oder erleichtert wird, muß freilich unentschieden bleiben. Denn gerade die politische Charakterisierung pflegt nicht sonderlich hilfreich zu sein, wenn von der kirchlichen Situation die Rede ist. Weder auf dem Konzil noch an anderen kirchlichen Orten gibt es eine Sitzordnung, die der des Parlaments vergleichbar wäre. Und die Programminhalte, zu denen politische Parteien sich bekennen, können sich — etwa im Falle christlicher Parteien — auf religiöse Prinzipien beziehen, aber eine Ordnung in umgekehrter Reihenfolge ist nicht denkbar.
Wer in der Kirche eine „mittlere Linie“ einzuhalten sucht zwischen den „Reaktionären“ und den „Neuerern“, den „Konservativen“ und den „Progressiven“, den „Traditionallsten“ und den „Aufgeschlossenen“ (oder wie immer diese Bezeichnungen lauten mögen), kann diese mittlere Linie gewiß nicht dadurch finden, daß er in soundso vielen Einzelfragen jeweils den Punkt zu treffen sucht, der von den Exremen gleich weit entfernt ist, und diese Punkte dann verbindet und eine „Linie“ daraus macht.
„Mitte“ kann in der Kirche, wo es im Eigentlichen nicht um Errechenbares, nicht um quantifizierbare Größen geht, nicht etwa ein kirchenpolitisches, mehr oder weniger taktisch kalkuliertes Durchschnittsmaß sein. Um es ganz deutlich zu sagen: Wenn es schon in der Politik von Übel ist, daß viele Maßnahmen nicht auf Grund personal verantworteter Entscheidungen — nach bestem Wissen und Gewissen der Entscheidenden —, sondern als Ergebnisse opportunistisch lavierender Erwägungen getroffen werden, dann ist dies in der Kirche, wo es um deren Wesentliches geht, erst recht verkehrt, ja unerlaubt.
Eine zusätzliche Schwierigkeit liegt darin, daß der Begriff „Mitte“ heutzutage viel weniger gilt als einst. Drei Jahrtausende lang hat die abendländische Zivilisation, ob heidnisch oder christlich, gläubig oder aufklärerisch, die „aurea mediocri-tas“, den goldenen Mittelweg, als ein Ideal der Tugend und der Lebenskunst hochgeschätzt. Mit dem Aufkommen des Genie-Kultes, mit der grotesken Überbewertung der Originalität, die heute außerdem auf den Modebegriff „kreativ“ heruntergekommen ist, und mit der massenhaften Verbreitung alles Exzentrischen, Abartigen, Absonderlichen und Sensationellen hat sich dies nun grundlegend geändert. Maß und Mitte, zwei fundamentale Tugenden praktischer Philosophie, sind in Verruf geraten. Sie stehen unter dem
Verdikt, Mittelmaß und Mittelmäßigkeit zu produzieren, Größe zu verhindern, Freiheit einzuschränken. Kurzum: Da man weder weiß, wo Mitte ist, noch Maß halten will, wehrt man sich gegen diese Maximen, und das kann nicht bequemer und wirksamer geschehen als dadurch, daß man sie mit Hohn überschüttet.
Leider macht auch das kirchliche Wesen hiervon keine Ausnahme. Das ist betrüblich, aber nicht verwunderlich, denn es beweist nur noch einmal, wie sehr die (darf man noch sagen: streitende?) Kirche als eine Kirche aus Sündern dem Zeitgeist der jeweiligen Epoche im Bösen wie im Guten ausgesetzt ist. Wären wir etwas bescheidener in unserer Kritik am Kirchenverständnis, an den Frömmigkeitshaltungen und an den Handlungen früherer Generationen, kämen wir wohl unschwer zu der Einsicht, daß auch unsere heutige Position, so „avanciert“ (um mit Adorno zu sprechen) und so aufgeklärt sie sich vorkommt, durchaus zeitbedingt ist — und daher in absehbarer Frist überholt sein wird.
Es spricht nicht gerade für wirkliche, sondern eher für eine nur eingebildete Aufgeklärtheit der Vergangenheits-Denunzianten, daß sie das Instrumentarium der Ideologie-Kritik (oder was sie dafür halten) mit großer Virtuosität handhaben, wenn es darum geht, die Begrenztheit früherer Zeiten aufzuzeigen, etwa das Gebundensein der mittelalterlichen Theologie an Denkfiguren der scholastischen Philosophie oder die Orienteriung biblischer Bilder am Weltverständnis des vornaturwissenschaftlichen Zeitalters, daß sie aber gar nicht auf den Gedanken kommen, dieses gleiche Instrumentarium auch einmal gegen die eigene, nun doch gewiß ebenso menschliche, das heißt, begrenzte und von sachfremden Determinanten abhängige Position anzuwenden.
Das gilt natürlich auch umgekehrt: Wären unsere sich „kritisch“ nennenden Zeitgenossen nicht in Wirklichkeit so unkritisch geschichtsblind, obwohl sie ständig düstere Vergangenheiten an die Wand malen, um die Gegenwart und noch mehr die Zukunft kontrastierend abheben zu können, verhielten sie sich wohl bedeutend vorsichtiger und selbstkritischer in ihren Urteilen und Verurteilungen.
Dazu wäre um so mehr Anlaß, als man sich gut vorstellen kann, wie auch eine Geschichte der Heiligen — wie übrigens jede Geschichte menschlicher Verhältnisse — unter anderen Vorzeichen sich neu schreiben läßt, sobald man es aufgibt, die Handlungen, Unterlassungen, Motive und Absichten der Menschen aus ihren zeitlichen Voraussetzungen zu verstehen. Was haben diese bedauernswerten Männer und Frauen alles falsch gemacht, sofern man nur die Maßstäbe der heute als besonders modern geltenden Lehren und Betrachtungsweisen anlegt:
— die Märtyrer der römischen Kaiserzeit, die in den Tod gingen, weil sie vor dem Standbild des Souveräns nicht ein paar Körner Weihrauch in ein Kohlenbecken werfen wollten, eine schlichte Huldigung, die man nur als einen puren weltlichen Akt anzusehen braucht, um sie in ihrer ganzen Harmlosigkeit zu erkennen ;
— die Asketen der thebäischen Wüste, die Einsiedler der deutschen Wälder, die weltflüchtigen Mönche, die ihre sozialen Pflichten sträflich mißachteten und in egoistischer Weise dem Heil ihrer Seele frönten, anstatt sich um die Analphabeten ihres Volkes, um Arme, Hungernde und Kranke zu kümmern;
— ein Thomas Morus, der aufs Schafott stieg, weil er sich nicht von der Ansicht abbringen ließ, daß auch die Ehe eines Königs unauflöslich sei — unaufgeklärt wie er war und nicht wissend, daß wenige Jahrhunderte später fortschrittliche katholische Moraltheologen über die Auflösbarkeit der Ehe ganz neue Erkenntnisse gewinnen würden, bemerkenswerterweise zur gleichen Zeit, da die Abschaffung des Zölibats und damit die Problematik von Ehe und Scheidung auch für Priester in existentielle Nähe zu rücken scheint;
— die vielen Opfer von Glaubenskriegen und Religionsverfolgungen, die es gewiß sehr viel leichter gehabt hätten, wäre ihnen nur schon der Holländische Katechismus mit seinen diversen Abstrichen am tradierten Glaubensgut bekannt gewesen ...;
— die gewiß nicht minder zahlreichen Opfer der überlieferten Sexualmoral, die so viele Unbequemlichkeiten, Trieb verzichte und selbst schwere Opfer auf sich nahmen, um das Gebot der Keuschheit vor und in der Ehe nach Menschenmöglichkeit einzuhalten, ohne zu ahnen, daß in klügeren Jahrhunderten von kirchlichen Kanzeln unter stillschwelgender Zustimmung oder wenigstens Duldung der verantwortlichen Inhaber des Lehramtes viel angenehmere Tugendlehren verkündet werden würden;
— die vielen Christenmenschen, die um Gottes willen ihr Kreuz auf sich genommen haben, um Christus nachzufolgen in seinem Leiden und in seinem Sterben, die sich selbst verleugnet, ihre eigenen Interessen hintangestellt und die Sache Gottes, der Kirche, der Mitmenschen zum Lebenszweck gemacht haben — und damit einer gigantischen Selbsttäuschung erlegen sind, weil sie nicht wußten, daß dieser Christus doch eigentlich etwas ganz anderes verkündet hat: Freude, Selbstverwirklichung, Emanzipation, Befreiung aus gesellschaftlichen Zwängen, ein humaneres Leben ohne Not und Leiden, Persönlichkeitsentfaltung, Bewußtseinserweiterung, Welthingabe, Kreativität, Spontaneität...
Aber im Ernst — wie steht es heute mit der Position der „Mitte“ in der innerkirchlichen Auseinandersetzung, wenn man darunter weder eine kirchenpolitisch-taktisch bestimmte Symmetrie-Achse zwischen den jeweils vorhandenen und sich artikulierenden Extremen noch eine organisch faßbare Fraktion „besonnener Reformer“ begreifen soll?
Für eine Kirche, die sich als von Jesus Christus gestiftet versteht, kann die Mitte eigentlich nur vom Wort der Offenbarung her bestimmt werden. Dieses Wort auszulegen, ist freilich alles andere als einfach, heute wie eh und je. Ließe sich diese Aufgabe so schlicht und einsinnig lösen, wie einige Exegeten es sich vorzustellen scheinen, nämlich durch bloße Anwendung des Methodenbestecks der Philologie und ihrer Hilfswissenschaften, hätten wir es in der Tat leichter als unsere Vorfahren, die Botschaft Christi in ihrer unverzerrten Kontur zu erkennen.
Aber eine Schriftauslegung, die für die Angehörigen einer christlichen Kirche verbindlich sein will, kann sich nicht damit begnügen, philologisch korrekt zu sein; sie muß auch theologisch richtig sein. Und es gibt eben keine glaubensunabhängige Theologie, die für alle Religionen und Konfessionen Gültigkeit zu beanspruchen vermag, wie es etwa philologische Methoden gibt, die sich auf Sanskrit-Texte ebenso wie auf die Ilias oder die „Blechtrommel“ anwenden lassen. Es gibt nur bestimmte Theologien: eine christliche, also in den Überlieferungsstrom des Christentums eingebundene Theologie, eine jüdische, buddhistische Gotteslehre.
Daher muß eine Auslegung der Schrift, die für sich in Anspruch nimmt, daß sie dem Christenmenschen mehr zu bieten hat als wissenschaftlich interessante Details akri-bischer Textkritik, auch vor dem Glauben der Väter bestehen können, wie er sich in der Kontinuität der Lehrüberlieferung manifestiert. Eine Position der Mitte ist nich zu legitimieren, ohne den Nachweis ihrer Übereinstimmung mit dem Sensus fidelium der gesamten, in den zurückliegenden Jahrhunderten ebenso wie im Heutigen, lebenden Kirche. Das „Volk Gottes“ ist ja nicht erst seit dem Zweiten Vatikanum auf dem Wege, und zur Kirche gehört nicht nur die von fortschrittlichen Theologen bis zur Blendung erleuchtete Generation, sondern, so wenig das manchem in den Kram passen mag, die gesamte Christenheit, die durch das Dunkel der Jahrtausende ihren von so beklagenswert schwachen Lichtern wie den Kirchenvätern, Thomas von Aquin und Pascal erhellten Weg dahingestolpert ist.
Gerade wer heute so großen Wert darauf legt, die „kirchliche Basis“ in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken, sie womöglich gegen das „amtskirchliche Establishment“ und die „charismatischen Kräfte“ gegen die verholzten Institutionen und die machtbesessene Hierarchie auszuspielen, kann nicht am gelebten Glauben des Kirchenvolkes in zwei Jahrtausenden vorbeigehen, ohne sich selbst jede Glaubwürdigkeit zu nehmen.
Diese Position der Mitte auszumachen, dürfte freilich auch einem lauteren Gewissen, einem bemühten Intellekt, einem missionarisch gestimmten Gemüt nicht immer leichtfallen. Ohne Versenkung in die unverstellte Botschaft der Schrift, ohne Gebet und Betrachtung, ohne Kenntnis des geschichtlichen Werdegangs der Christenheit wird es nicht gelingen können.