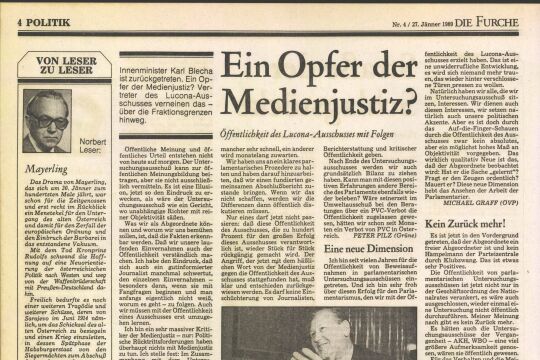Die befürchtete Überschneidung von gerichtlichen und parlamentarischen Untersuchungen zur Korruption sind ausgeblieben.
Befürchtungen, der parlamentarische Ausschuss zur Untersuchung von Korruptionsfällen und Finanzierungsströmen könnte mit den am Wiener Straflandesgericht laufenden Ermittlungsverfahren gegen teilweise idente Personen in teilweisen identen Causen kollidieren, haben sich noch nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil.
"Es geht besser, als erwartet“, sagt etwa Werner Zögernitz, Präsident des im Parlament angesiedelten "Institutes für Paralamentarismus und Demokratiefragen“ auf FURCHE-Anfrage. Trotz des Problems, dass sich einige Personen wegen paralleler Untersuchung der Aussage entschlagen, seien die ersten Sitzungen und Einvernahmen vor dem Untersuchungs-Ausschuss "besser gelaufen, als befürchtet“. Auch die anfänglich erwarteten Schwierigkeit im Aktenlauf seien nicht eingetreten.
Akten neu und ungeschwärzt
Ähnlich positiv bilanzierte jüngst Gabriele Moser als Vorsitzende die bisherige Tätigkeit des Ausschusses. Dass sich einige Personen, etwa der frühere Verkehrsminister Hubert Gorbach, der Aussage entschlagen würden, sei zu erwarten gewesen. Doch eine "Nicht-Aussage“ würde den Betreffenden "eher belasten“, weil dann die Daten und Angaben aus den Akten unwidersprochen im Raum stehen bleiben würden.
Eine Lösung wurde diese Woche im jüngsten Konflikt um die Übermittlung teilsweise geschwärzter Akten gefunden. Nach der Empörung der Abgeordneten aller Parteien über die teilweise geschwärzt erhaltenen Akten bezüglich der Steuerunterlagen des Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly hat sich das Finanzministerium zur Änderung der Vorgangsweise entschlossen: Mitte der Woche wurden die Akten neuerlich übermittelt. Es seien nun auch jene Angaben lesbar, die vom Finanzamt Eisenstadt ursprünglich als "nicht relevant“ eingestuft worden waren. Ausgespart bleibe nur ein kleiner Bereich, der die Rechte völlig unbeteiligter Dritter betreffe. Dennoch bleibt: Völlig ungeschwärzt bekommen die Abgeordneten den Akt nicht in die Hände, Privates bleibe unkenntlich, wie Hans-Georg Kramer, Generalsekretär im Finanzmininsterium erklärte.
Der Vorgang selbst scheint jedoch eine Lücke im Regelwerk offenzulegen, nämlich jene des Streits zwischen staatlichen Organen.
Die Behörden hätten alle jene angeforderten Akten vorzulegen, die im Zusammenhang mit den Untersuchungsthema gegenständlich seien, sagt Zögernitz. Privates gehört nicht dazu. Damit ist ein Konflikt zwischen Parlament einerseits, das Akten vollständig zu sehen wünscht, und Behörden, welche diese unvollständig oder teilweise geschwärzt übermitteln, möglich. Wer entscheidet? Das sei ein interner Organ-Streit, für den in Österreich - anders als in Deutschland - noch keine Instanz vorgesehen sei. In Deutschland würden sogenannte "Interorganstreitigkeiten“ vom Verfassungsgerichtshof geklärt, diese sei in Österreich nicht vorgesehen. Was dann? "Bei uns“, so Zögernitz, würde sich wohl Vertreter des Parlaments und der Regierung zusammensetzen, mit einem Verfahrensanwalt ein Gremium bilden, welches dann als Schiedsstelle fungiere.
Geklärt hingegen ist die - siehe unten - zu umstrittenen Folgen führende Frage der Öffentlichkeit des Untersuchungsausschusses.
Grundsätzlich ist der Ausschuss medienöffentlich, Journalisten verfolgen die Einvernahmen. Allerdings kann der Ausschuss die Öffentlichkeit ausschließen, sollten Schutzinteressen überwiegen. Etwa jene eines Einzelnen, eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses oder wenn eine wahrheitsgemäße Aussage anders nicht zu erwarten ist. Sollen Beamte unter Aufhebung der Amtsverschwiegenheit aussagen, dann kann ebenfalls die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.
Erste Folgen und Erfolge
Während der Untersuchungsausschuss seine bereits ein Monat währende Tätigkeit noch zumindest bis zum Sommer fortsetzt, werden von Einzelnen bereits dessen erste Erfolge genannt.
So verweist Moser auf den Beschluss, die Vergabe von Inseraten durch die Bundesregierung zu prüfen. Neben dem Transparenzgesetz gilt die angestrebte transparente Parteienfinanzierung sowie die neuerliche Verschärfung - zuvor gelockerter - Anti-Korruptionsbestimmungen ebenfalls als eine Folge der Aufdeckung von Geldflüssen zwischen öffentlichen bzw. halbstaatlichen Unternehmen einerseits und Politiker und Parteien andererseits. Allerdings erhielt diese Initiative schon wenige Tage vor dem Start des Untersuchungs-Ausschusses ihre Dynamik, als der Europarat Österreich Parteienfinanzierung kritisierte.