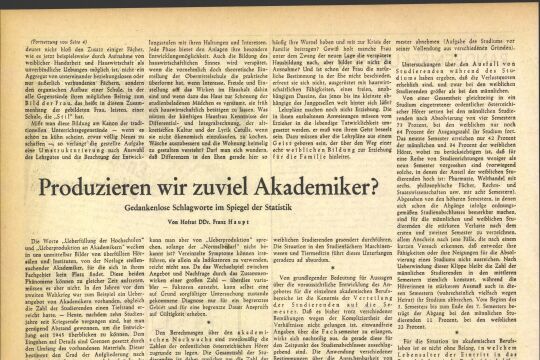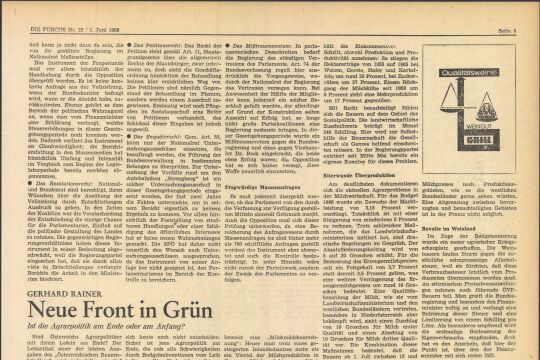Während sich die künftigen Medizinunis in Wien, Graz und Innsbruck mühen, die Studierendenzahl den Finanzen anzupassen, kann die neue Private Medizinische Universität Salzburg nach Herzenslust selektieren - und kassieren. von doris helmberger und christina gastager-repolust
Ehrgeizig, selbstbewusst und zielstrebig - so wünschen sich Eltern ihre studierenden Kinder. Spannende Professoren, ein gutes Gesprächsklima und viel Praxis - so erträumen sich Studierende das universitäre Ambiente. Die neue Private Medizinische Universität (PMU) Salzburg scheint auf den ersten Blick beide Visionen zu erfüllen.
Bis zur Adaption ihres zukünftigen Standortes ist sie in den Räumen der Naturwissenschaftlichen Fakultät untergebracht: Kafkaeske Gänge gilt es zu überwinden, bis man die gut gelaunten Ärzte in spe vor dem Chemiesaal trifft. Knapp fünf Wochen nach Studienbeginn haben die 42 Studierenden - davon 18 Frauen - ihre erste Prüfung abgelegt: Chemie. Maria Kollmann aus dem Salzburgischen Schwarzach ist eine der insgesamt 29 österreichischen Studierenden, die das Experiment Privatuni wagen - elf ihrer Kollegen kommen aus Deutschland, zwei aus Südtirol: "Die nächsten fünf Jahre habe ich klar geplant: Ich will dieses Studium durchziehen", erklärt sie entschlossen. Eher kurzfristig habe sie sich für diesen anstrengenden Ausbildungsweg entschlossen. Dass sie unter 400 Bewerbern ausgewählt wurde, erfüllt sie mit Genugtuung.
Teurer Komfort
Die jungen Leute wissen, was sie wollen. Für eine jährliche Studiengebühr von 8.000 Euro - jeder Dritte erhält ein Stipendium - wird ihnen auch einiges geboten: 40 bis 48 Wochen Unterricht pro Jahr, "Bedside-Teaching" am Salzburger LKH, eine wöchentliche Evaluation der Lehrveranstaltungen - und die Aussicht, ein Jahr früher als die schnellsten Kollegen an den öffentlichen Unis ihren "Dr. med." zu ergattern. Die dafür nötigen Finanzmittel werden freilich nur zu 21 Prozent von den Studiengebühren gespeist. 33 Prozent werden von Land, Stadt und Gemeinden zugeschossen, 17 Prozent stammen aus Forschungsaktivitäten, 29 Prozent aus Fundraising. Im Vollausbau wird man über ein Jahresbudget von 7,8 Millionen Euro verfügen.
Thomas Kunit, Sohn einer Salzburger Arztfamilie, weiß die komfortablen Studienbedingungen an der PMU zu schätzen. Ursprünglich hatte er in Wien mit dem Medizinstudium begonnen. Seine Erinnerungen an diese zwei Semester: "Hörsaal und Labor waren überfüllt, der Kampf um Praxisplätze aussichtslos und die Motivation seitens der Lehrenden kaum vorhanden." Hier in Salzburg sei alles anders, meint der 21-Jährige im Brustton der Überzeugung: "Hier bekomme ich die Motivation für mein Studium von den Professoren zurück."
Auch die 19-jährige Birgit aus Linz hätte auf solch studentischen Luxus gute Lust gehabt. Wie 360 andere Kollegen ist sie aber an der schweren Aufnahmsprüfung gescheitert - und sitzt nun gemeinsam mit rund 300 Studierenden im voll besetzten Hörsaal 1 des Anatomie-Instituts der Universität Wien. "Meine Eltern hätten die Studiengebühr von 8.000 Euro schon bezahlt", sinniert sie hoch oben in der letzten Reihe, kurz bevor die Vorlesung über "Gesunde und Kranke" beginnt. "Aber jetzt genieße ich eben Wien."
Viel Zeit für die Erkundung der Bundeshauptstadt wird der angehenden Ärztin allerdings nicht bleiben. Schon nach einem Jahr, am Ende des ersten Studienabschnitts, steht ihr eine "Summative Integrierte Prüfung" (SIP) ins Haus, die über den Aufstieg in den zweiten Abschnitt - oder den Absturz in die Warteschleife entscheidet. Nur 482 Studierende, 45 Prozent der über tausend Möchtegern-Mediziner, schafften heuer diesen Sprung. Für Judith Böhm, Vorsitzende der Fakultätsvertretung Medizin der Universität Wien, ein untragbarer Zustand: "Die anderen Studierenden müssen jetzt ein ganzes Jahr warten."
Auslöser dieses "Flaschenhalses" ist der neue Medizin-Studienplan, der 2002 implementiert wurde und die Arzt-Ausbildung an den medizinischen Fakultäten in Wien, Innsbruck und Graz - rechtzeitig vor ihrer Umwandlung in eigenständige Medizin-Universitäten am 1. Jänner 2004 - optimieren soll. Ziel ist eine ganzheitlichere Sicht des (kranken) Menschen und mehr Praxisbezug. Einleitende Vorlesungen über "Gesunde und Kranke" zeugen ebenso vom neuen Geist wie der klinische Unterricht in Kleingruppen von 15 Personen. Angesichts dieses Praxisschubs im zweiten Studienabschnitt haben die Verantwortlichen zur Notbremse gegriffen und Studienplatzbeschränkungen angedacht. Während dies in Innsbruck und Graz vom Bildungsministerium akzeptiert wurde, legte man in Wien ein Veto ein. Mittlerweile wurde sogar der Verwaltungsgerichtshof eingeschaltet.
"Weltfremde" Offenheit
"Es ist entweder weltfremd oder politisch motiviert, zu glauben, wir könnten 800 oder 900 Leute pro Jahr qualitativ hochwertig betreuen", empört sich Kurt Kletter, Studiendekan der medizinischen Fakultät der Uni Wien. Das derzeitige Limit von 600 Studierenden sei bereits äußerst großzügig angesetzt, so Kletter. "Wir haben die Ausbildung primär im AKH mit seinen 2.000 Betten zu leisten. In bestimmten Bereichen wie den Intensivstationen ist ein Studentenbetrieb nicht möglich. Und auch der Patient hält es nicht aus, wenn er den ganzen Tag von Studierenden umgeben ist."
Wie Kletter wehrt sich auch der derzeitige Dekan und künftige Rektor der Wiener Medizinuniversität, Wolfgang Schütz, gegen den Vorwurf, überzählige Studierende einfach durch besonders strenge Prüfungen loswerden zu wollen. "Früher haben nur sieben Prozent den ersten, damals viersemestrigen Abschnitt in der Mindestzeit bestanden, jetzt sind es immerhin 45 Prozent." Der tatsächliche Studienerfolg, der früher durch sechs Einzelprüfungen "verdeckt" worden wäre, werde nun eben deutlicher sichtbar.
Von Aufnahmetests zum Medizin-Studium, wie sie vergangene Woche vom steirischen Ärztekammerchef Dietmar Bayer gefordert wurden (siehe auch Interview), hält Schütz jedoch nichts: "Bei Prüfungen nach einem Jahr wissen die Studierenden, dass sie an medizinischen Themen gescheitert sind. Bei einer Zulassungsprüfung am Anfang könnten sich sehr viele darüber beschweren, dass sie sehr gute Ärzte geworden wären, aber keine relevanten Fragen bekommen haben." Dass es aber angesichts der beschränkten Finanzmittel eine Studienplatzbewirtschaftung geben müsse, steht nach Schütz außer Diskussion.
Auch an den beiden anderen Medizin-Standorten sieht die Lage - wenige Wochen vor der Entlassung in die Autonomie - nicht gerade rosig aus: Während sich die Studierendenvertreter an der künftigen Medizin-Universität Graz über Durchfallquoten von bis zu 93 Prozent in einzelnen Modulen des ersten Abschnitt empören und Studiendekan Gilbert Reibnegger nur zu einer vorübergehende Ausnahmereglung bewegen konnten, harrt man in Innsbruck noch des Rektors, der da kommen soll. Nachdem die Gehaltsverhandlungen mit dem deutschen Anatomen Robert Nitsch gescheitert waren, hat das Bildungsministerium nicht den Zweitgereihten - den derzeitigen Medizin-Dekan Hans Grunicke - ausgewählt, sondern die Position neu ausgeschrieben.
Derlei Querelen sind der Wiener Medizinuni erspart geblieben. Auch die Existenz der neuen Privatuniversität sieht man hier gelassen: "Die Zahl der Medical Schools' ist in Österreich ohnehin zu gering", meint Rektor Wolfgang Schütz - wobei abzuwarten bleibe, wie lange das Land Salzburg die großzügige Finanzierung übernehmen könne. Im Übrigen sei die PMU "keine Konkurrenz": "Dort werden 210 Personen studieren. Bei uns sind es 11.000."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!