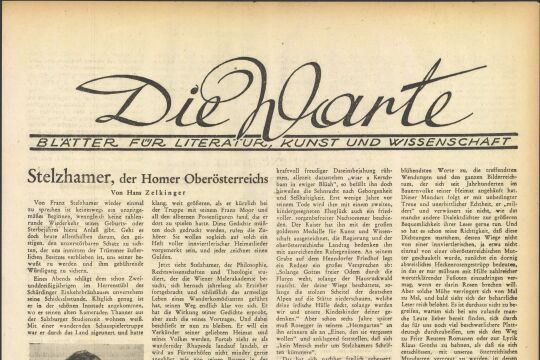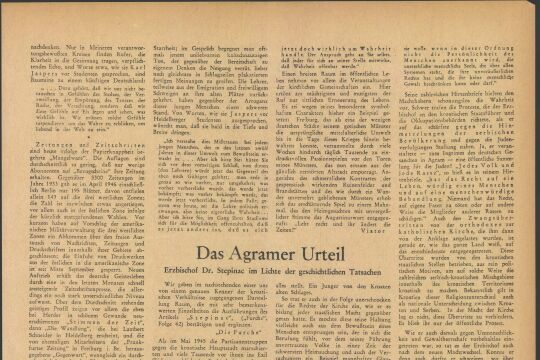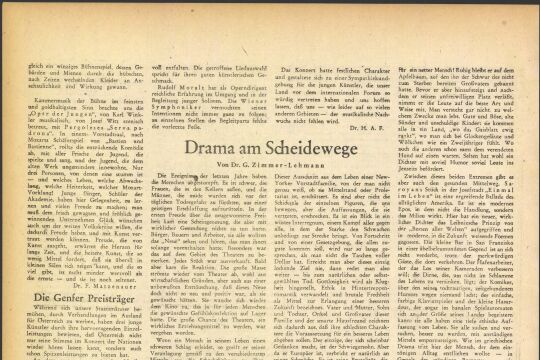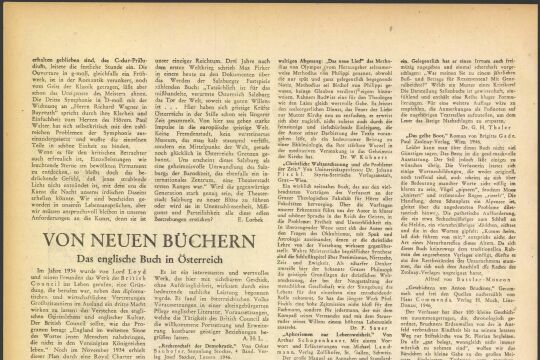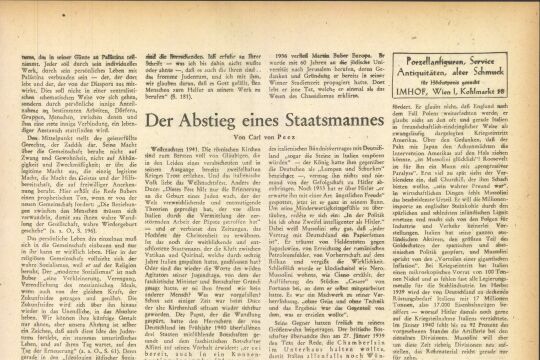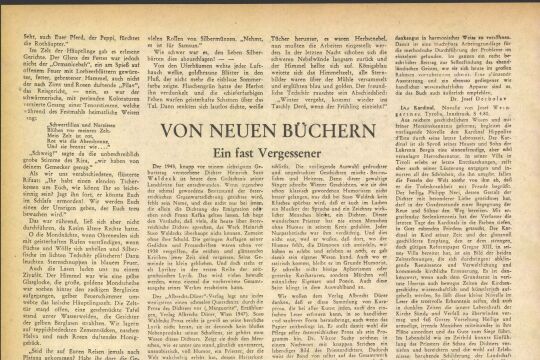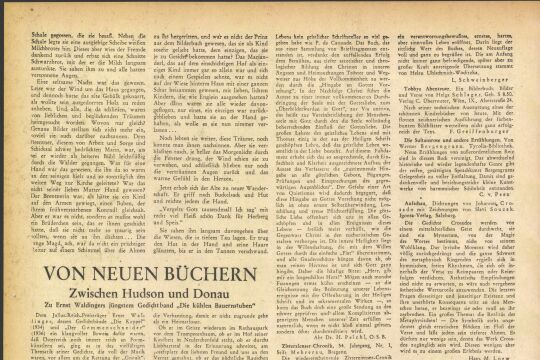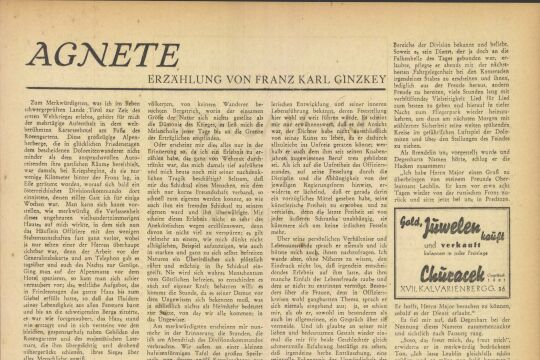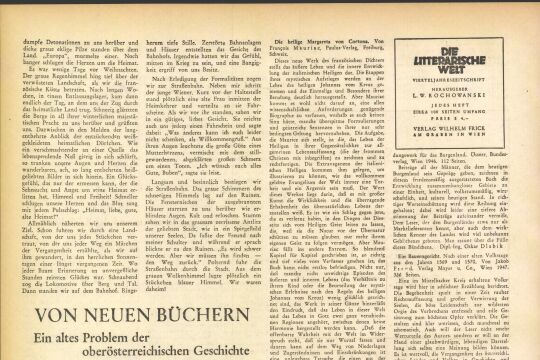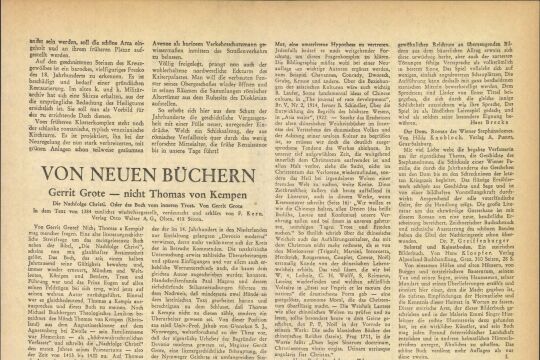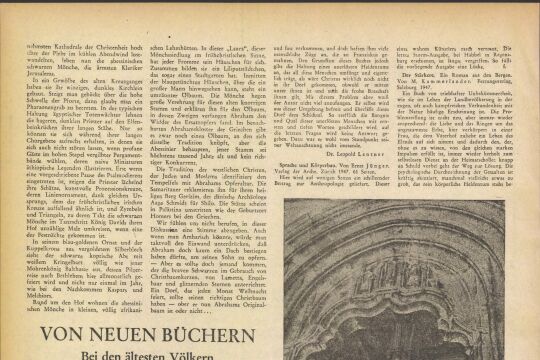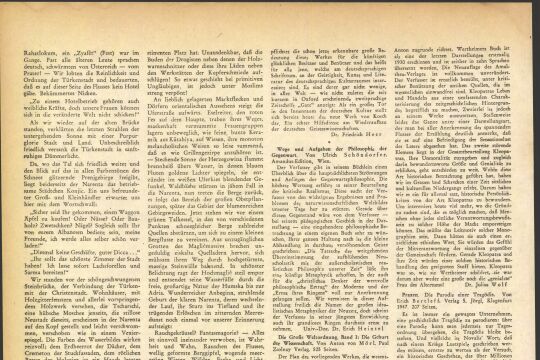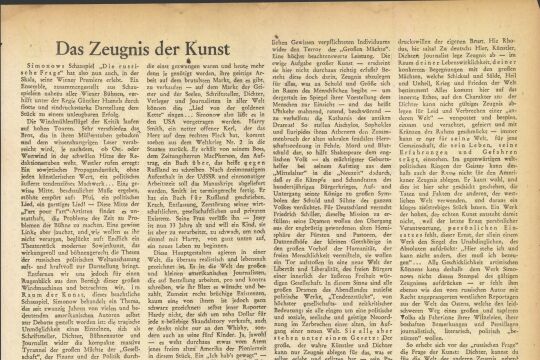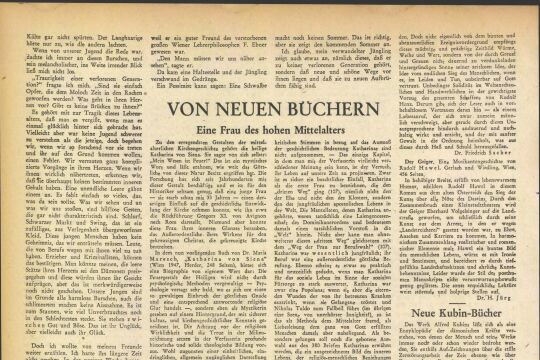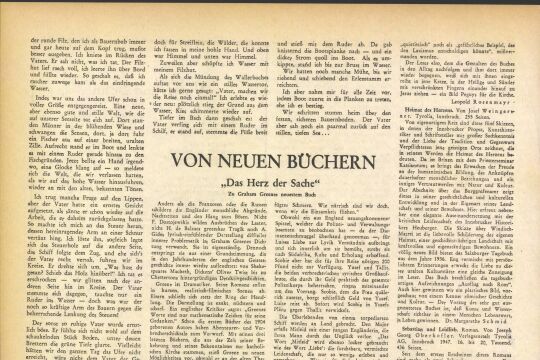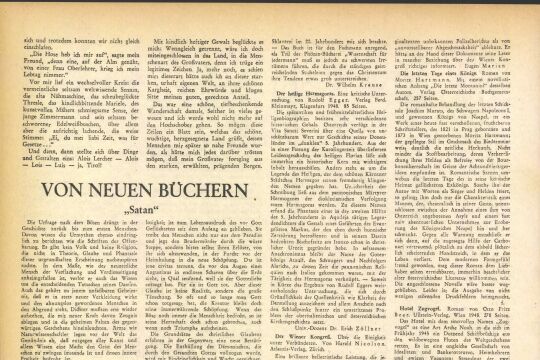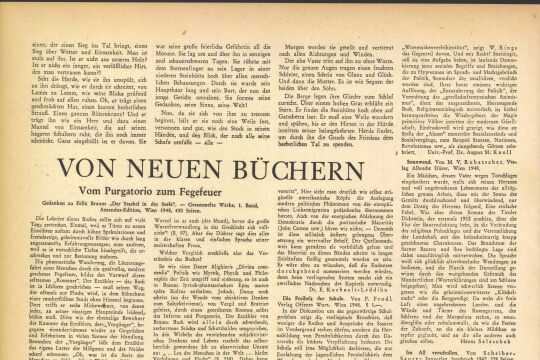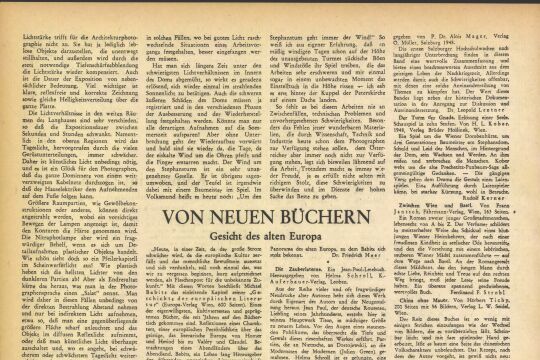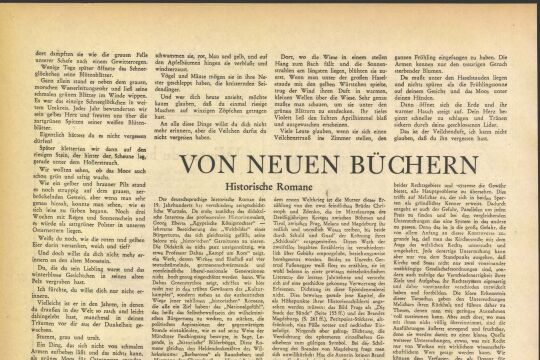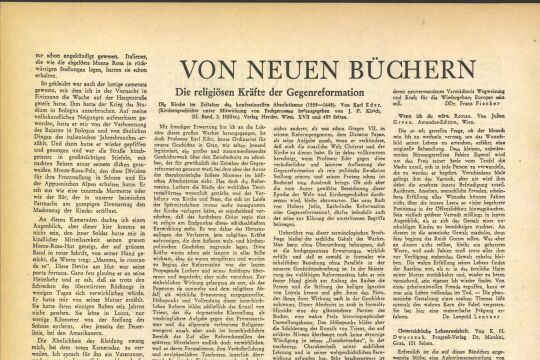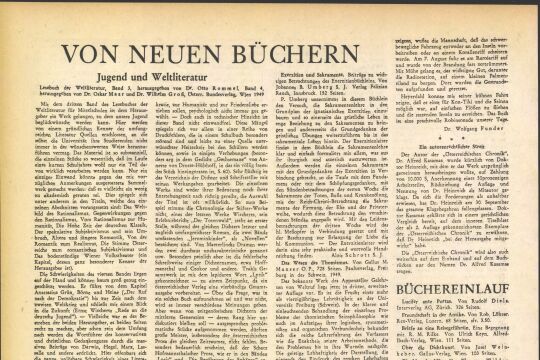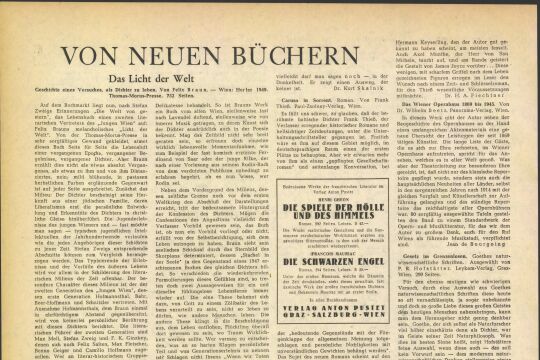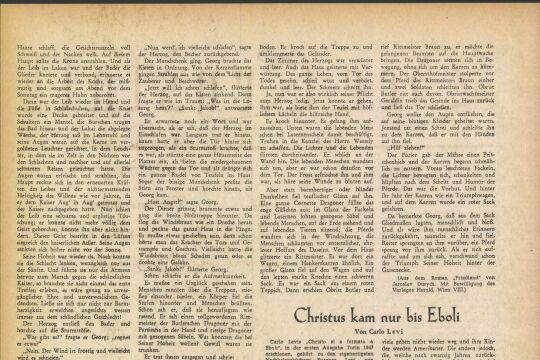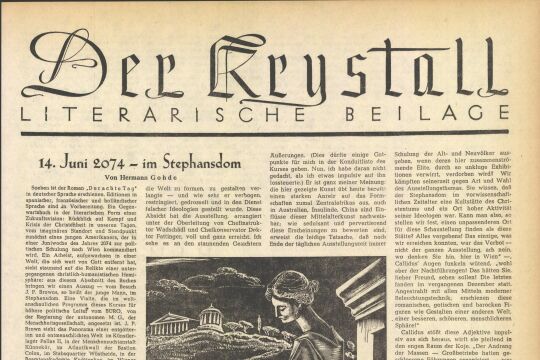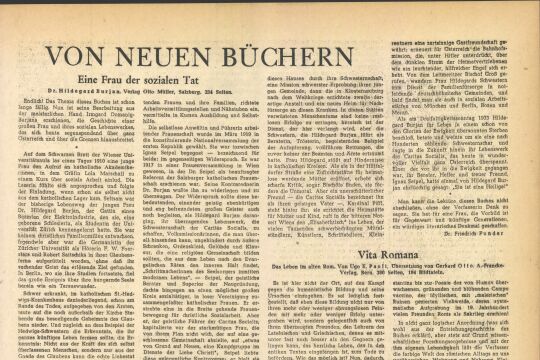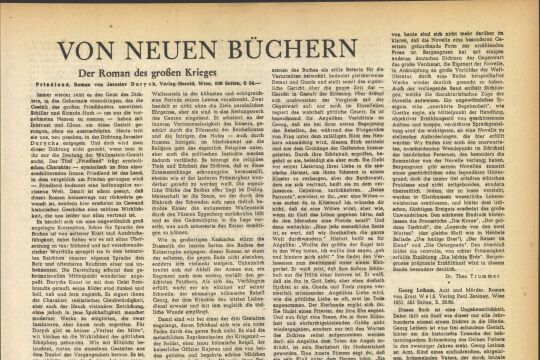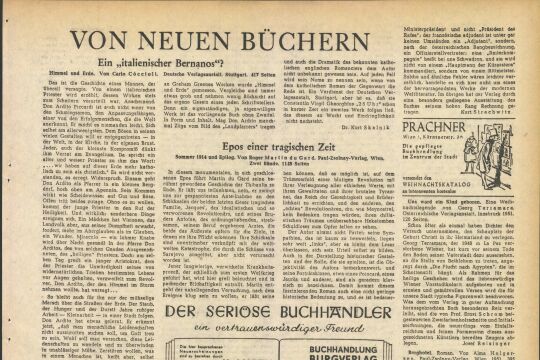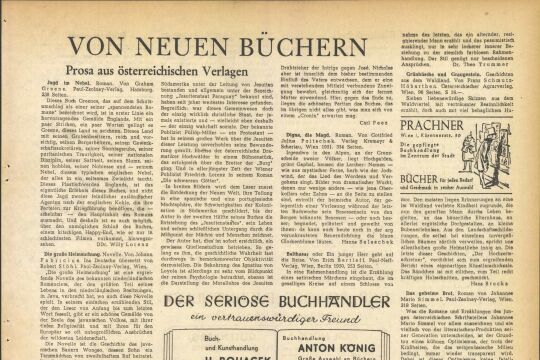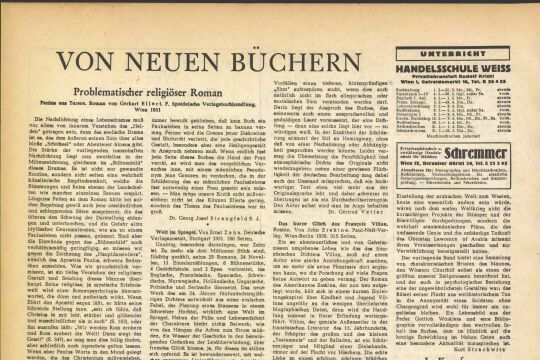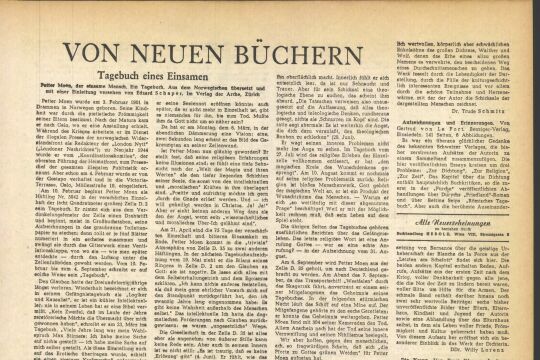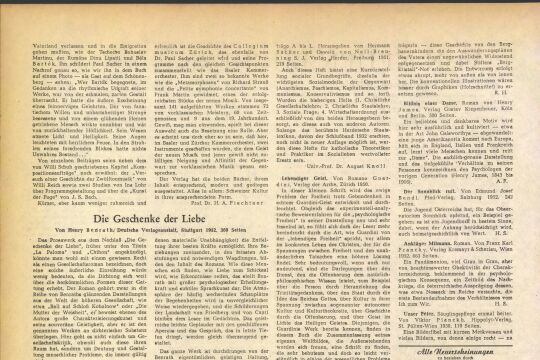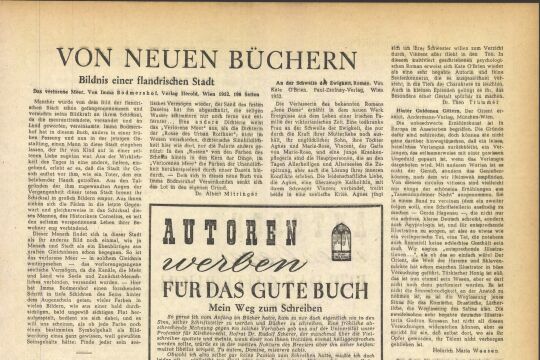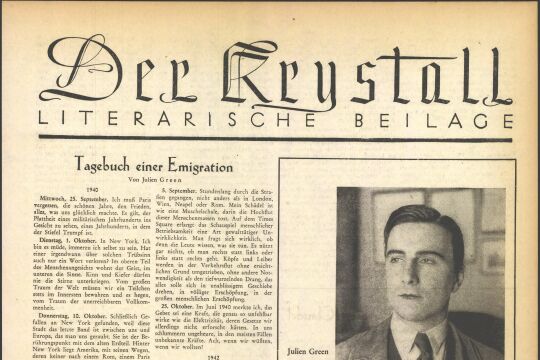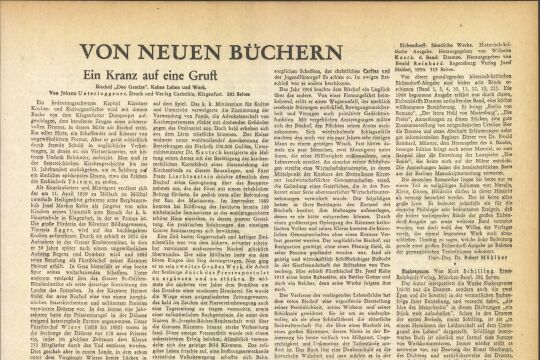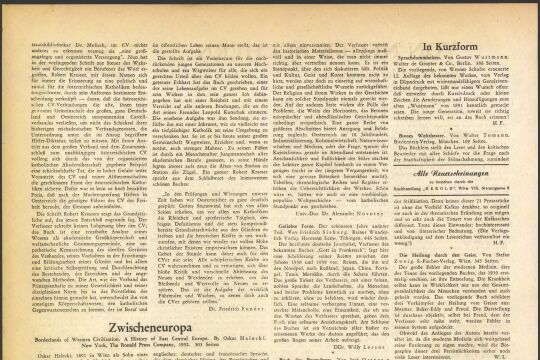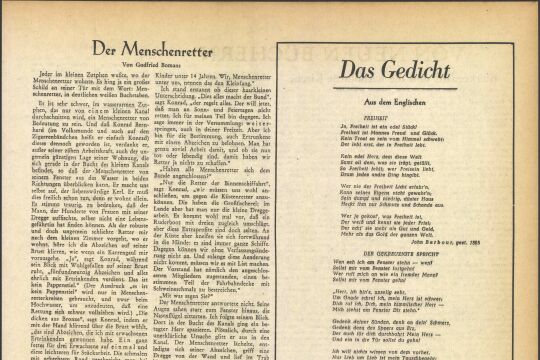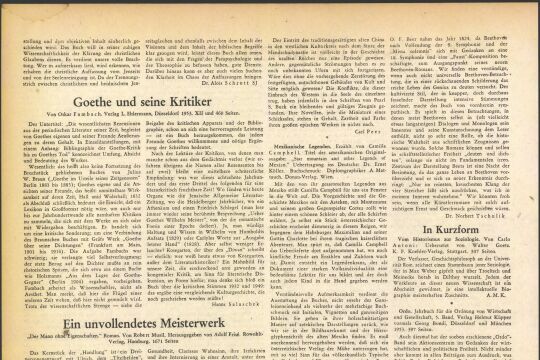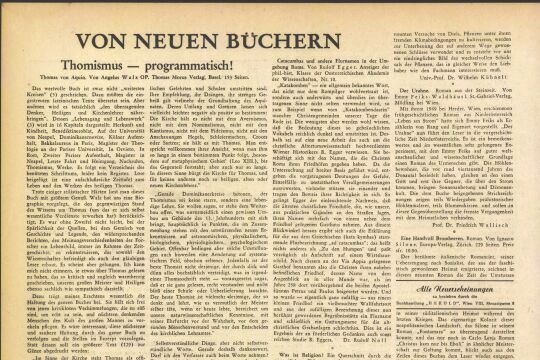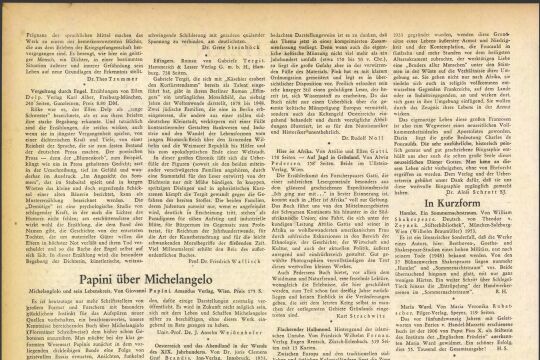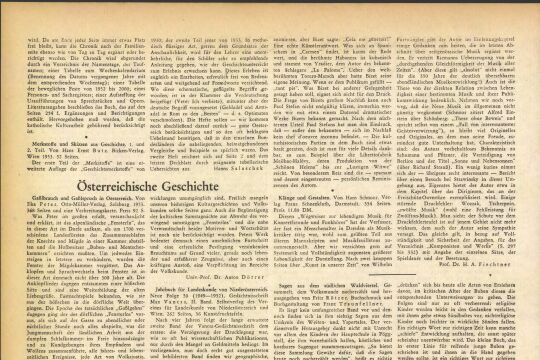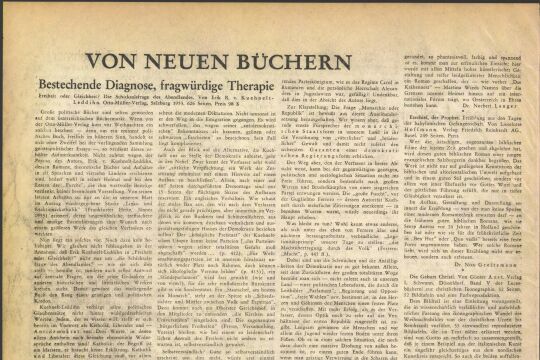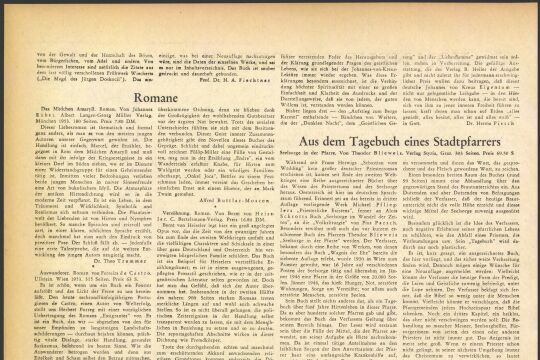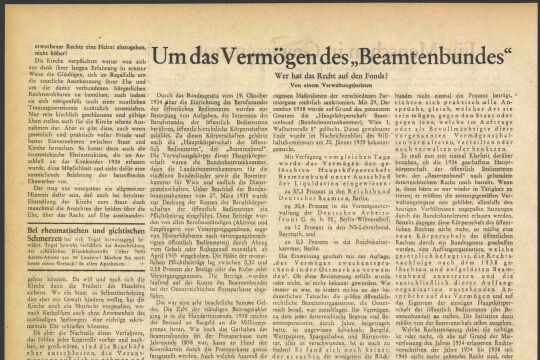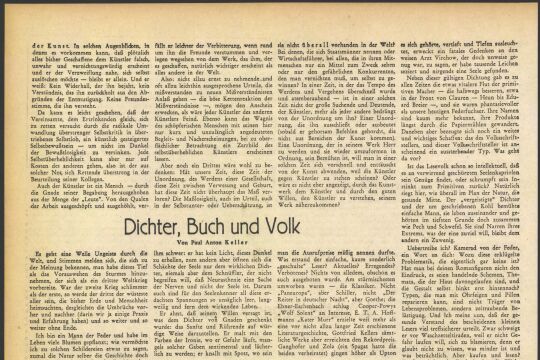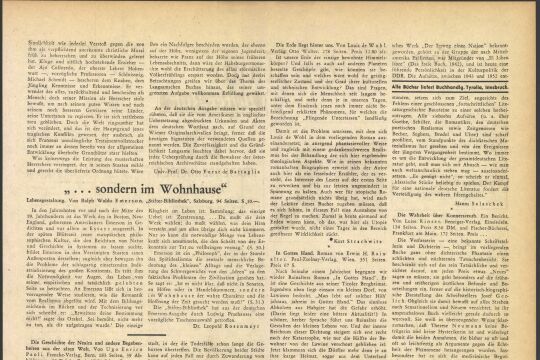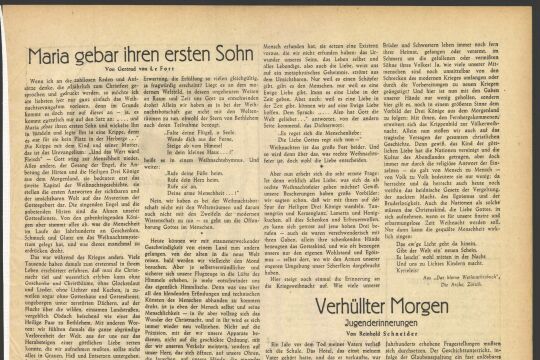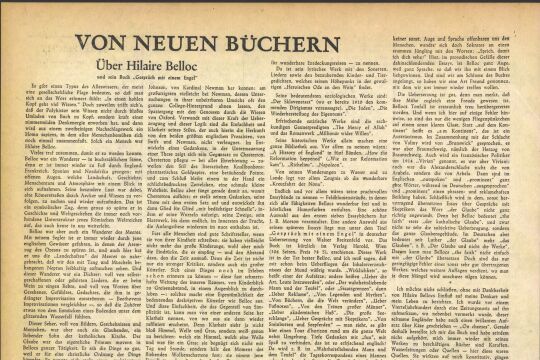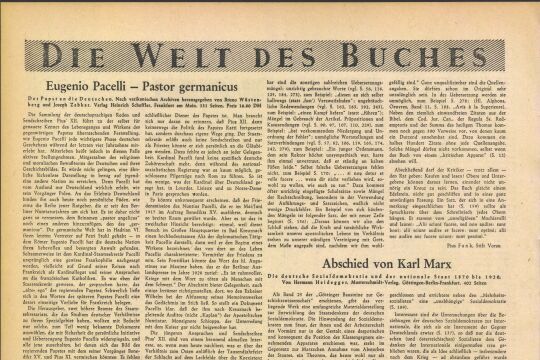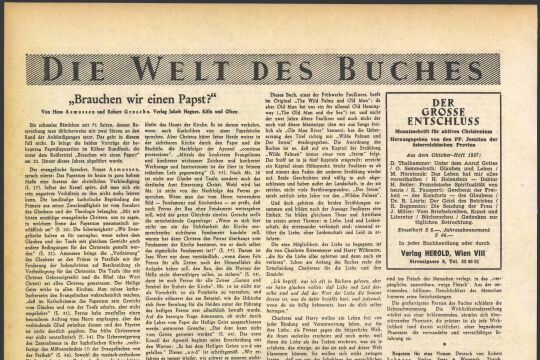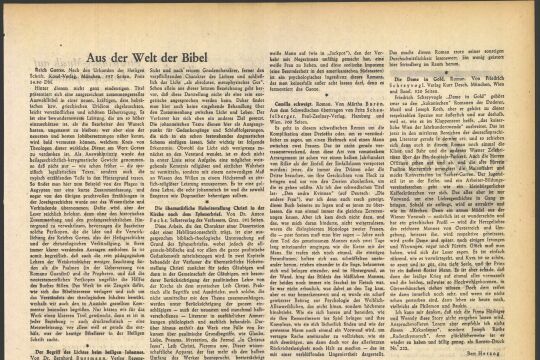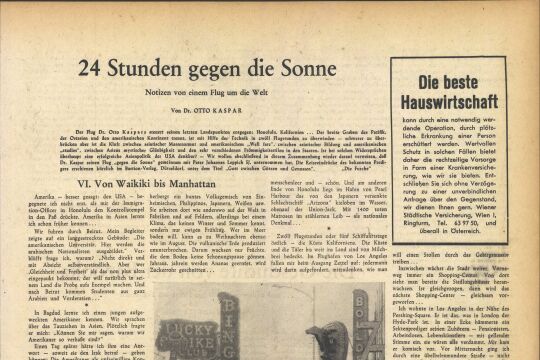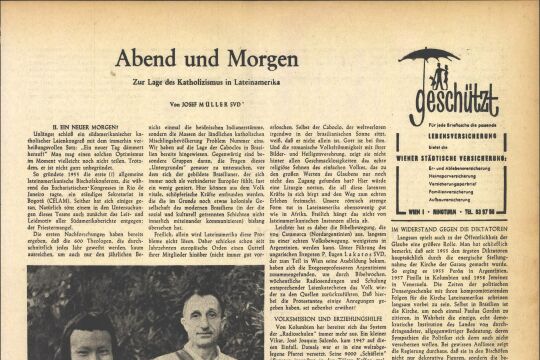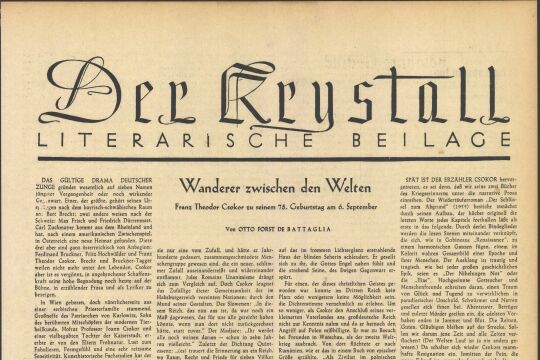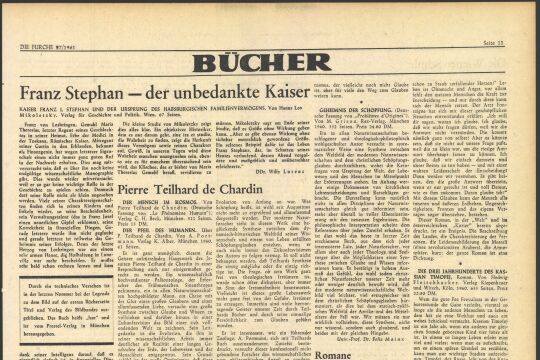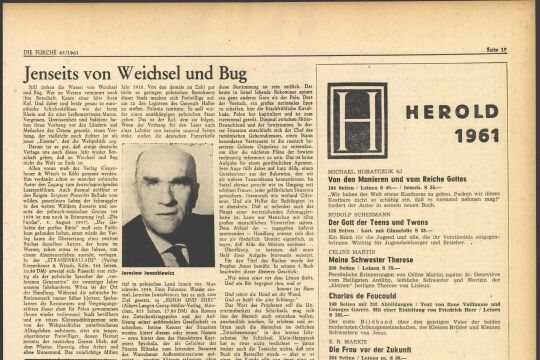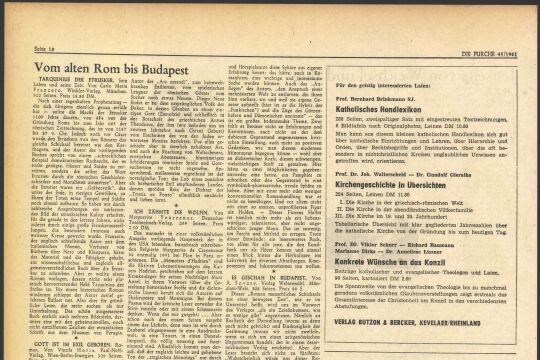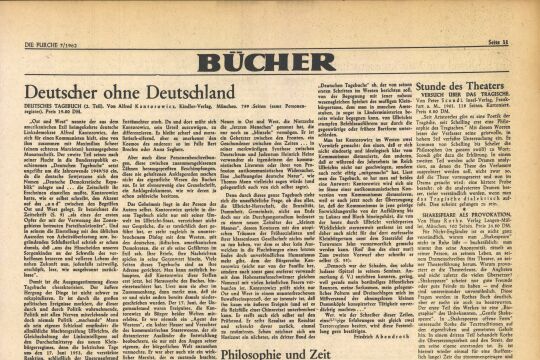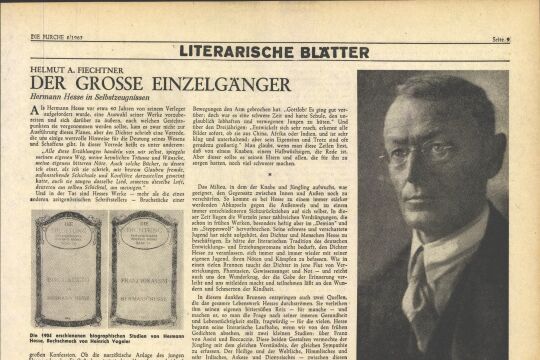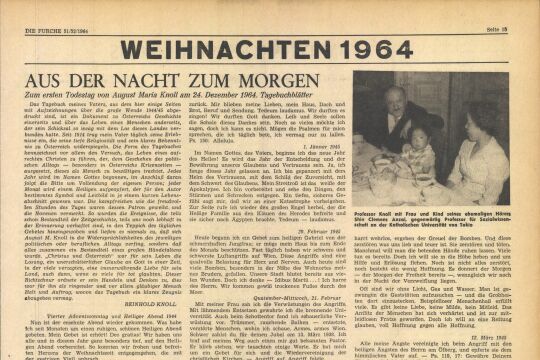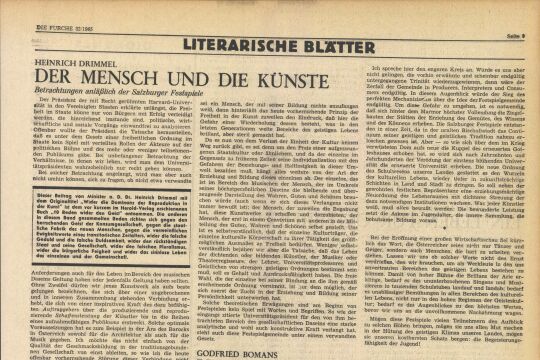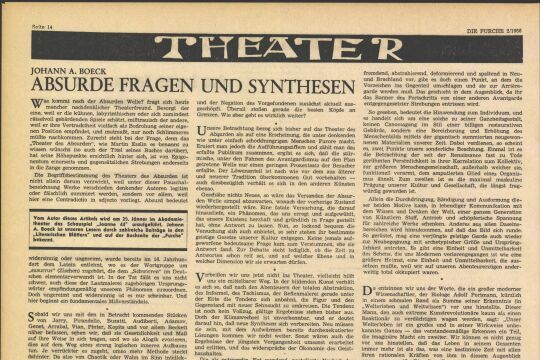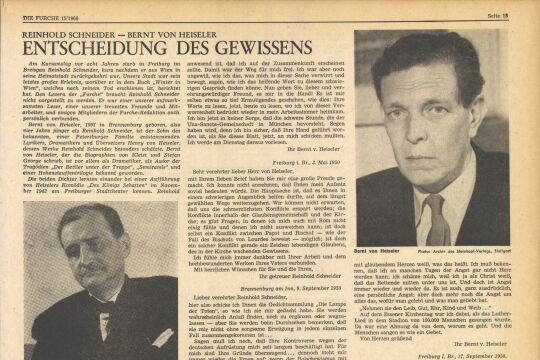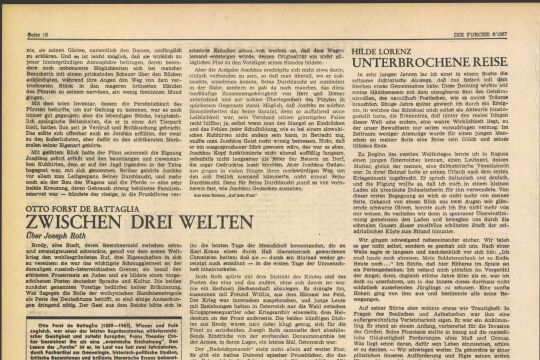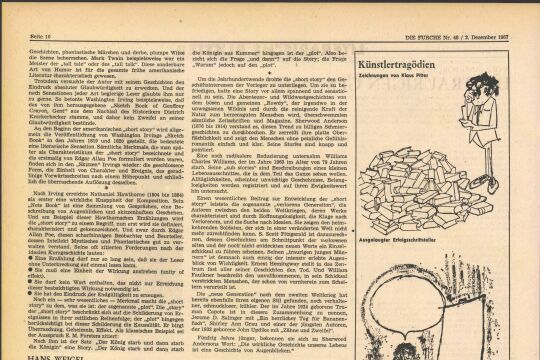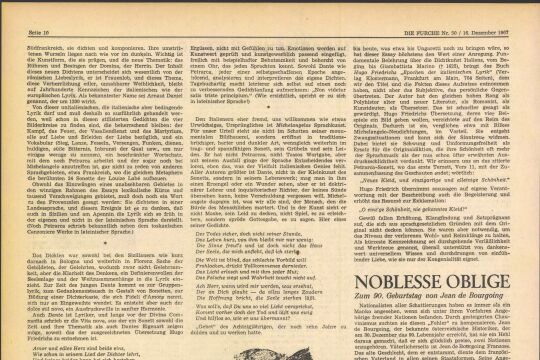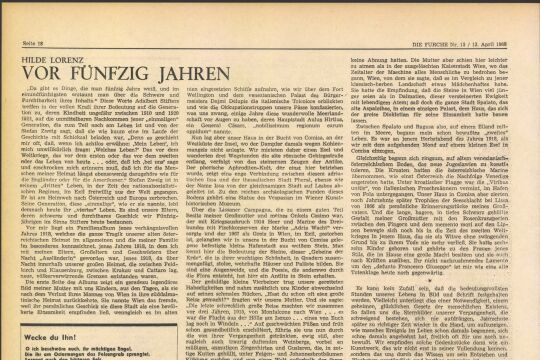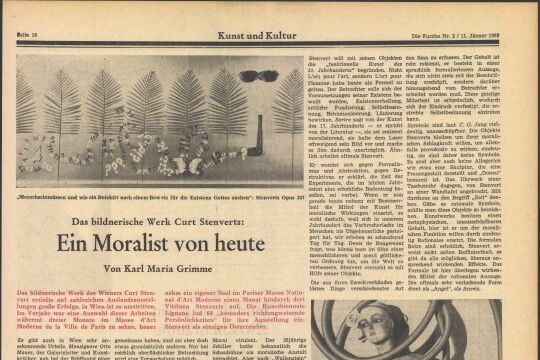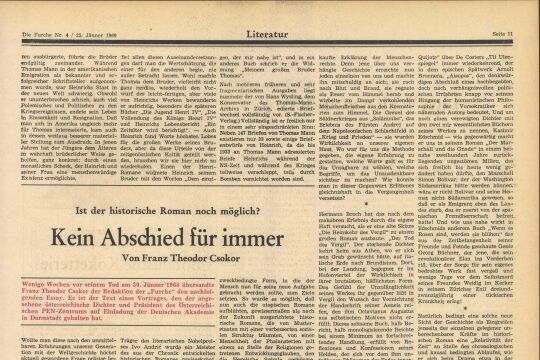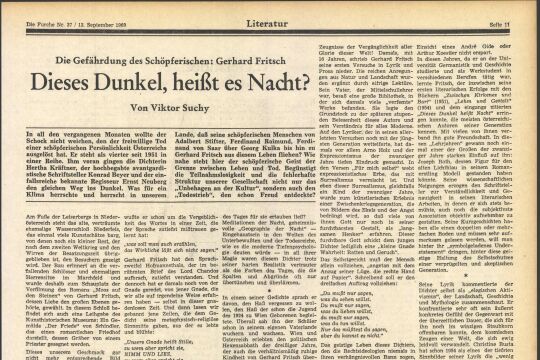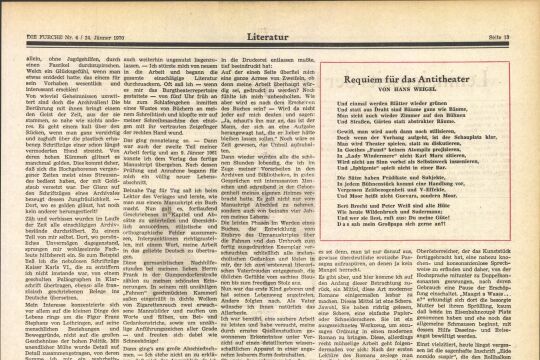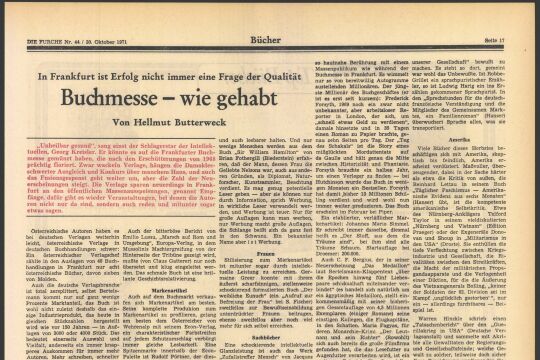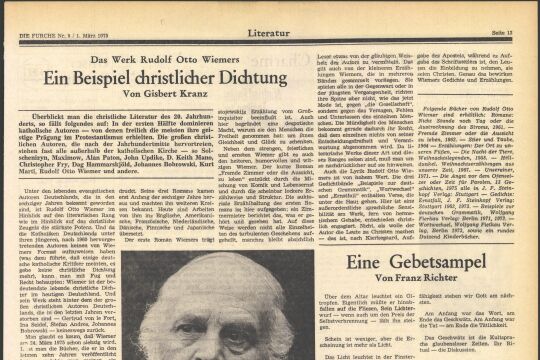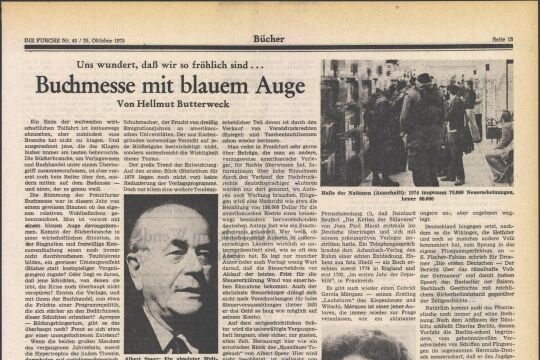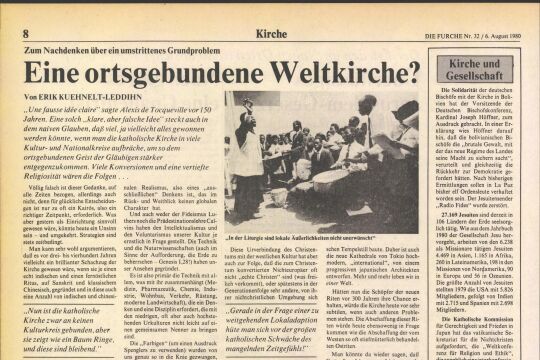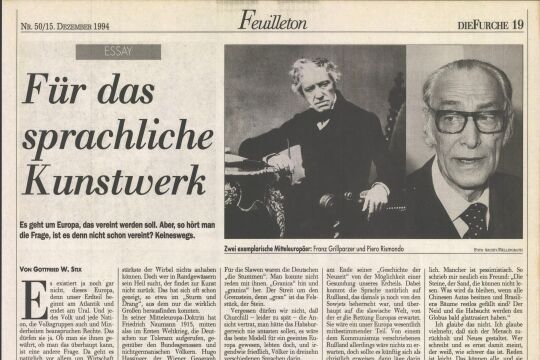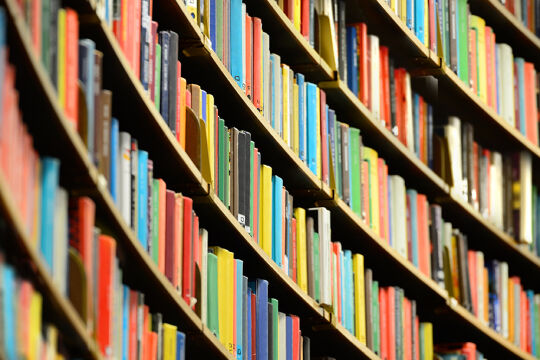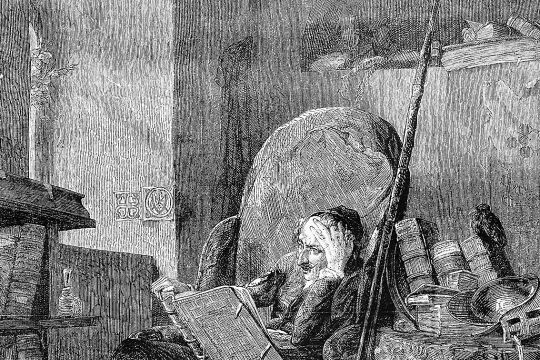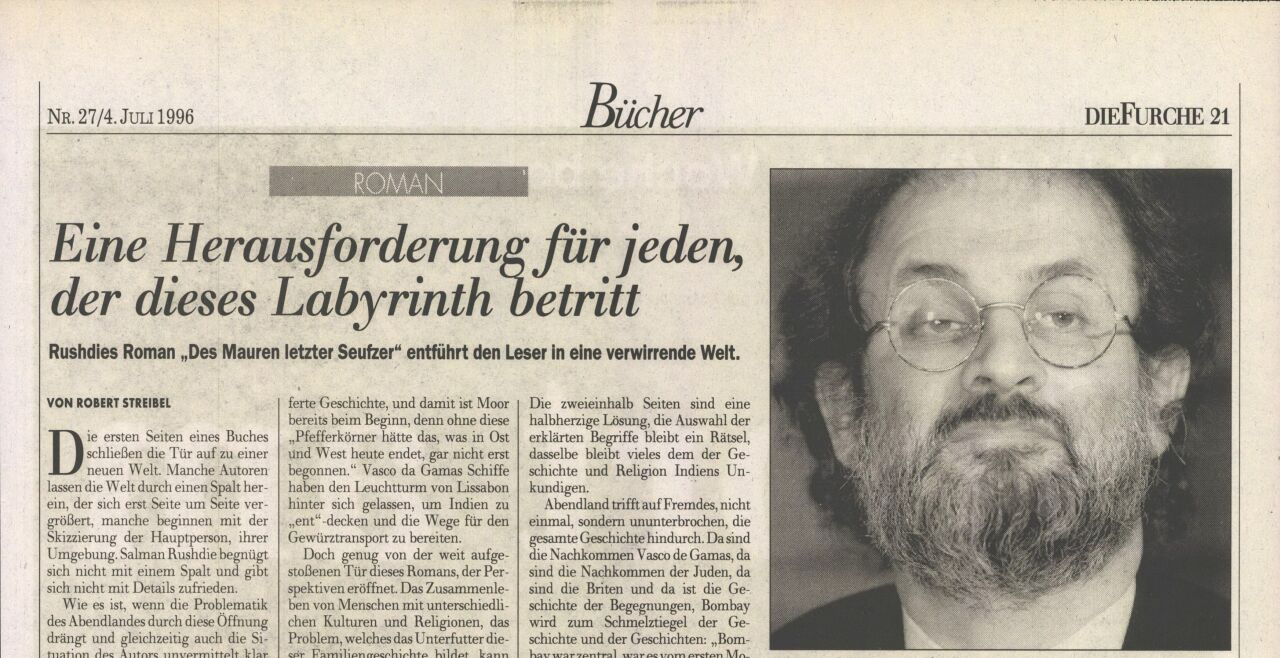
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine Herausforderung für jeden, der dieses Labyrinth oetritt
Die ersten Seiten eines Buches schließen die Tür auf zu einer neuen Welt. Manche Autoren lassen die Welt durch einen Spalt herein, der sich erst Seite um Seite vergrößert, manche beginnen mit der Skizzierung der Hauptperson, ihrer Umgebung. Salman Bushdie begnügt sich nicht mit einem Spalt und gibt sich nicht mit Details zufrieden.
Wie es ist, wenn die Problematik des Abendlandes durch diese Öffnung drängt und gleichzeitig auch die Situation des Autors unvermittelt klar wird, ist in Rushdies neuem Roman „Des Mauren letzter Seufzer” zu erleben: Die Leserin, der Leser steht im Gegenwind großer Literatur und das raubt fast den Atem. Moor, der letzte Nachkomme der Familie Da-Gama-Zogoiby, befindet sich auf der Flucht, mußte Indien den Rücken kehren und ist nach Spanien zurückgekehrt, von wo seine Vorfahren vor Plünderten Jahren aufgebrochen sind. Moor ist Jude, er nagelt seine Botschaft mit Zwei-Zoll-Nägeln an Kirchentüren und Ölbäume.
Wer will, kann an Luther und Chri -stus denken und Beziehungen zu Rushdies Situation herstellen: „Sehr viel ist angeschlagen, angenagelt worden. Flaggen, zum Beispiel, die man zeigen will. Doch noch einem gar nicht so langen (wenn auch fahnenbunten) Leben sind mir plötzlich die Thesen ausgegangen. Das Leben selbst ist Kreuzigung genug.” Der Seufzer Moors gilt nicht nur der eigenen Familiengeschichte, sondern „für eine verlorene Welt. Aber auch eine Träne für ihren Untergang. Aber auch ein letztes Hurra, ein finales, skandalöses Gewirr unentwirrbarer Geschichten...”
Dieser letzte Seufzer ist lang und dauert 580 Seiten, ein langer Atemzug, ohne Luft zu holen, ein Seufzer mit Ironie und Humor, eine gepfefferte Geschichte, und damit ist Moor bereits beim Beginn, denn ohne diese „Pfefferkörner hätte das, was in Ost und West heute endet, gar nicht erst begonnen.” Vasco da Gamas Schiffe haben den Leuchtturm von Lissabon hinter sich gelassen, um Indien zu „ent”-decken und die Wege für den Gewürztransport zu bereiten.
Doch genug von der weit auf gestoßenen Tür dieses Romans, der Perspektiven eröffnet. Das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen, das Problem, welches das Unterfutter dieser Familiengeschichte bildet, kann wissenschaftlich analysiert werden. Doch diese Analyse ist nicht die Aufgabe der Kunst.
Vielmehr geht es dem Autor darum, dem Leser das Herz zu öffnen, und wenn es ihm gelingt, daß die Probleme eines Teiles dieser Welt wenigstens in einem kurzen Aufflackern anders betrachtet werden, dann wurde die Tür nicht umsonst aufgestoßen. Anlässe bietet das reale Leben, das Indien des Jahres 1996, mehr als genug, mit Anschlägen fundamentalistischer Moslems, mit Pattsituationen nach Parlamentswahlen und korrupten Parteien und Politikern. Das Wissen, das sich der Leser mit dieser von Rushdie betriebenen Herzensbildung unweigerlich aneignet, ist keineswegs Ballast. „Warum soll ich beim Lesen soviel über Indien lernen?” hat ein prominenter Kritiker vom Fernsehquartett gefragt. Indien ist uns fremd und bietet „Material” für eine Verfremdung, die es erlaubt, allgemein gültige Probleme in einem anderen Licht zu betrachten.
Literatur folgt anderen Gesetzen als soziologische Untersuchungen, doch Rushdies Lesern hätte ein umfangreicheres Glossar Hilfe geleistet.
Abendland trifft auf Fremdes, die gesamte Geschichte hindurch
Die zweieinhalb Seiten sind eine halbherzige Lösung, die Auswahl der erklärten Begriffe bleibt ein Rätsel, dasselbe bleibt vieles dem der Geschichte und Religion Indiens Unkundigen.
Abendland trifft auf Fremdes, nicht einmal, sondern ununterbrochen, die gesamte Geschichte hindurch. Da sind die Nachkommen Vasco de Gamas, da sind die Nachkommen der Juden, da sind die Briten und da ist die Geschichte der Begegnungen, Bombay wird zum Schmelztiegel der Geschichte und der Geschichten: „Bombay war zentral, war es vom ersten Moment seiner Entstehung an gewesen: das Mischlingskind einer portugiesisch-englischen Ehe und dennoch die indischste aller indischen Städte”. Bombay wird auch zum Synonym und zur Chiffre für unsere heutigen multikulturellen Städte und Gesellschaften.
Als Erzähler hat sich der letzte Nachkomme, Moor, der Sohn der Malerin Aurora und Abrahams, weise gemacht. Die intellektuelle Distanzierung von den Geschichten, die mit einem kühlen britischen Understatement ausgebreitet werden („Mann, bin ich heute in mitfühlender Stimmung! Und wissen Sie was? Selbst dieses arme Schwein tut mir leid...”) und die Geschichten selbst passen sozusagen nicht in das Wohnzimmerformat für Spielfilme, der Unterschied zwischen Rushdie und vielen anderen Schriftstellern ist wie der zwischen TV und Cinemascope, und gelegentlich kann man den Überblick verlieren, denn es ist kein gerader Erzählfaden, dem gefolgt wird, wenn die Geschichte der Gewürzhändlerfamilie vom Beginn des Jahrhunderts an ausgebreitet wird. Wer merkt sich in unserer atomisierten Gesellschaft noch die Geschichten dutzender Personen? Dabei wird der Leser vom Autor selbst auf die Probe gestellt, wenn plötzlich Eigenschaften angesprochen werden, deren Träger schon längst im Strudel der Erzählung nach unten gerissen wurden.
Der Erzähler selbst verlangt nichts Außergewöhnliches von seinen „Zuhörern”, er selbst hat freilich anscheinend seine Menschengalerie immer im Auge wie kleine Nippes-Figuren, darum hat er niemanden vergessen, die Lebenden ebensowenig wie die Ermordeten und die Verstorbenen, und Moor arbeitet darüber hinaus wie in Trance, in einem Traumzustand, fast wie Flory Zogoi-by? eine Großmutter Moors, die nach dem Tod ihres Mannes als Frau „der” Synagogendiener wird, die aus dem 12. Jahrhundert stammenden blauen Fliesen putzt, auf den Fliesen die Erklärung der Welträtsel zu finden glaubt und gelegentlich auch findet.
Die Muster und Arabesken formen sich zur Geschichte, je nach Licht, Laune, Tageszeit und Person, die sich darum bemüht: „Die einen sagten, wenn man sie lange genug absuchte, werde man auf einem der blauweißen Quadrate die eigene Lebensgeschichte finden ... Andere waren
überzeugt, daß die Fliesen Prophezeiungen enthielten, der Schlüssel zu ihrer Enträtselung aber im Laufe der Jahre verlorengegangen sei.”
Dieser Art zu erzählen entspricht auch die Dialogregie in diesem Monumentalepos, denn gesprochen wird vor allem in der ersten Hälfte des Ro-mans, bis zum Tod der letzten großen Frau der Dynastie, der Mutter von Moor, der Malerin Aurora, in einer Kunstsprache, in Verballhornungen und Anspielungen. Obgleich Arno Schmidt aus seiner Heide wahrscheinlich nie nach Indien gekommen ist, als „Übersetzer” und Helfer kann es nicht schaden, auch ihn zu Rate zu ziehen oder bei der Entschlüsselung auch an ihn manchmal zu denken. Weitere kulturelle Bezüge, die Moor in seinem Handgepäck mitträgt, aus der alten und der neuen Welt von Troja bis Shakespeare, von Filmen bis zu legendären Sportgrößen, lassen diesen Roman zu einem Erlebnis und einer Herausforderung für jeden werden, der diese Geschichte als Leser betritt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!