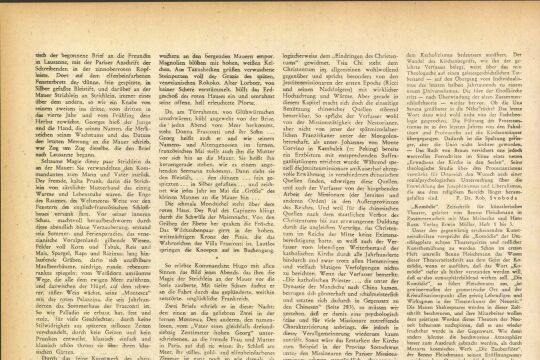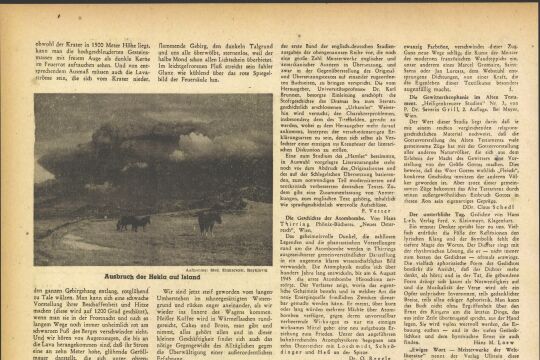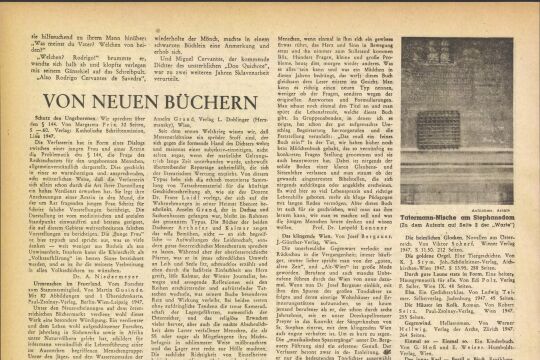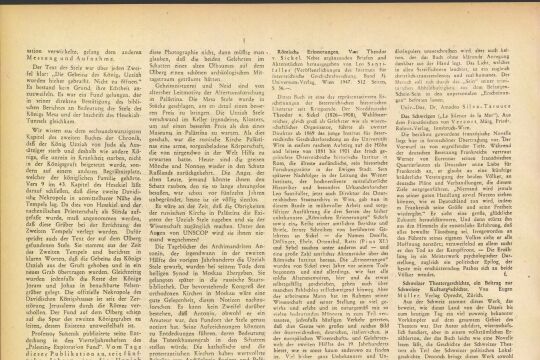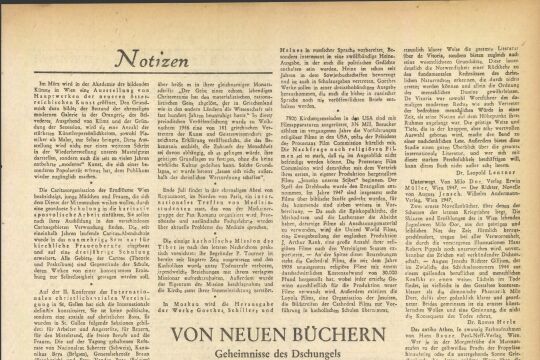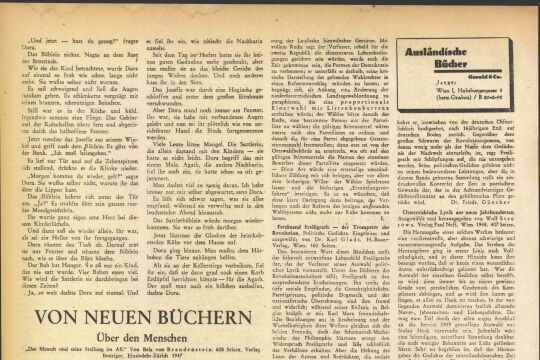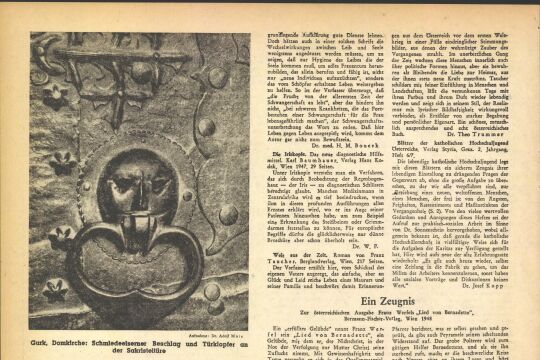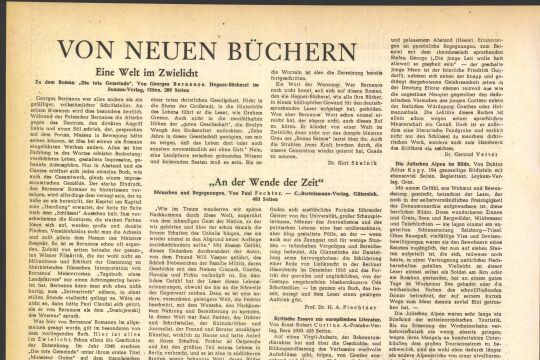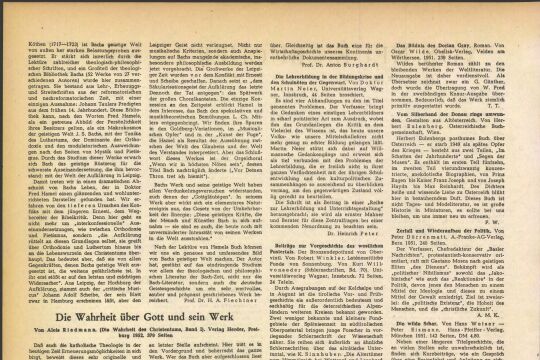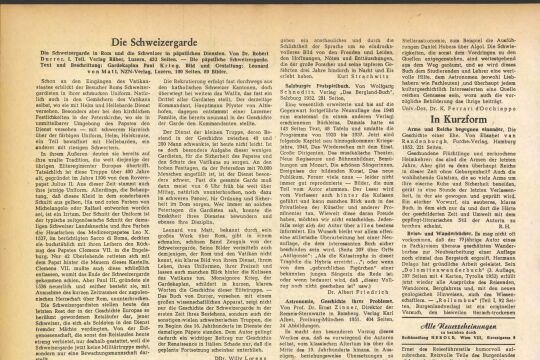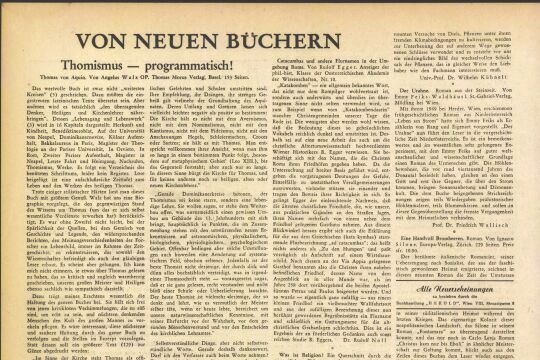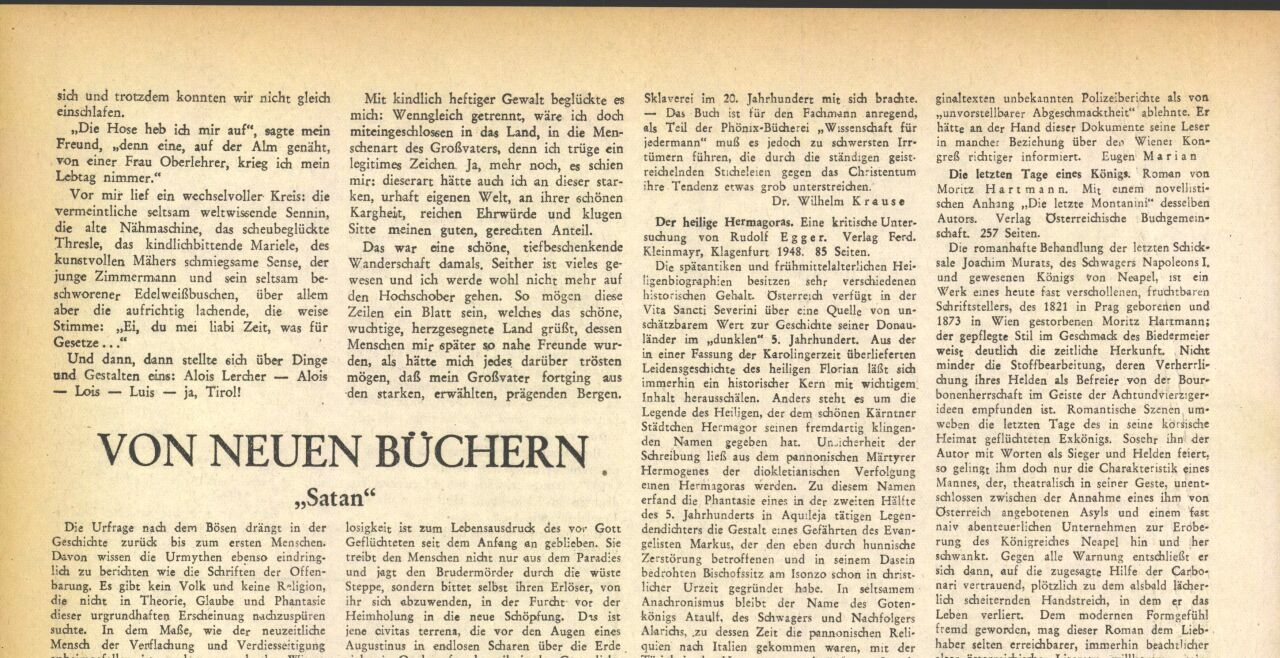
Die Urfrage nach dem Bösen drängt in der Geschichte zurück bis zum ersten Menschen. Davon wissen die Urmythen ebenso eindringlich zu berichten wie die Schriften der Offenbarung. Es gibt kein Volk und keine Religion, die nicht in Theorie, Glaube und Phantasie dieser Urgrundhaften Erscheinung nachzuspüren suchte. In dem Maße, wie der neuzeitliche Mensch der Verflachung und Verdiesseitigung anheimgefallen ist, verlor er auch das Wissen um die entscheidenden Tatsachen seines Daseins. Auch das gehört zu jenem unfaßbaren Geheimnis, daß es in stets neuer Verkleidung wirkt und den ahnungslos gewordenen Menschen in den Abgrund z;eht. Dichter mußten erst wieder aufstehen, die mit neuer Kraft davon Zeugnis ablegen und in die geheimen Falten des gegenwärtigen Geschehens hineinleuchten. Ärzte wie Naturwissenschaftler legen vor der Welt das Geständnis ab, daß entgegen aller Kunst und allem Wissen eine Macht den Geist des Menschen zu zwingen imstande ist und dessen innere Freiheit bedroht ist.
Wie hier um die Existenz des Menschen gerungen wird, davon bezeugt der Sammelband der „Etudes carmelitaines“ mit dem einfachen Titel „S ata n"(Ed. Desclfe de Brouwer, Paris 1948). Er nimmt den Kampf gegen jene Dunkelerscheinung auf. Ethnologen, Philosophen, Theologen und hellhörige Dichter testen unabhängig voneinander das Terrain der Welt ab und enthüllen die Machenschaften der Unordnung. Es ist ein erfreuliches Zeichen der Gegenwart, daß hier nicht die sogenannten Fachleute, die Theologen, allein das Wort führen, sondern selbst auf theologischem Boden ein Laie, Albert Franc-Duquesne, ein entscheidendes Wort spricht. Er tut es deutlich, denn der Kampf in dieser Welt ist jedem Menschen auferlegt. Die Kreatur ist in vielerlei Gestalt schon zum Instrument der Widermacht geworden und hat den wahren Gott mit den Götzen vertauscht. Sie hat dadurch ihre „Herrscherwürde“ verloren und „ihre Wohnstätte“ verlassen. Die geistige und vielfach die anschauliche Heimat losigkeit ist zum Lebensausdruck des vor Gott Geflüchteten seit dem Anfang an geblieben. Sie treibt den Menschen nicht nur aus dem Paradies und jagt den Brudermörder durch die wüste Steppe, sondern bittet selbst ihren Erlöser, von ihr sich ebzuwenden, in der Furcht vor der Heimholung in die neue Schöpfung. Das ist jene civitas terrena, die vor den Augen eines Augustinus in endlosen Scharen über die Erde zieht, in Qual seufzend, weil sie der Gottesliebe entsagt hat. Für sie ist Gott tot. Aber dieser Glaube ist keine Realität, sondern die große Täuschung. So oft und so lange man Gott schon totgesagt hat, die Kreatur bleibt doch seine immerwährende Schöpfung. Wenn das Böse noch immer die Menschheit bedroht, so ist seine Herrschaft doch schon gebrochen, auch wenn noch Triumphe aufscheinen.
Die Grundsätze des christlichen Glaubens erfahren in der Gegenwart eine neue Bestätigung. Die Enthüllung des Dämonischen, die durch den Gesandten Gottes vollzogen wurde, wird mit Eindringlichkeit und Wucht gezeichnet. Wohl schaut man da noch vieles gleichnishaft, wie in einem jener dunklen Spiegel der Antike, weil das große Licht noch verborgen ist. Wenn aber der die Dämonen umhüllende Schleier fällt und ihre volle W'idermacht am neuen Tag hervortritt, dann wird es auch offenbar werden, daß das Geheimnis des Bösen nur das Zerrbild vom Geheimnis der höchsten Liebe ist.
Dahin aber führt dieses Buch nicht mehr. Es ist sehr klug, sehr wissenschaftlich und sehr exakt geschrieben. Mag es gewollt oder ungewollt auf diesem Wege stehengeblieben sein. Albert Franc-Duquesne hat wohl in seiner großen biblischen Schau den tiefsten Sinn angedeutet, der im Kampfe Christi mit dem Dämon verborgen liegt. Seitdem aber Paulus 1 Kor 13 geschrieben hat, wissen wir, daß es keine größere Macht geben kann als die abgrundtiefe Liebe. Sie allein wird auch unsere Zeit und uns von dem Dämon befreien.
Dr. Leopold L e n t n e r
Das versunkene Volk — Welt und Land der Etrusker. Von Sibylle Cles-Reden. Verlag M. Fr. Rohrer, Innsbruck-Wien.
Als Ergebnis jahrelanger Wanderungen auf den Spuren des versunkenen Rätselvolkes der Etrusker legt die Verfasserin ein Budi vor, das nicht den Anspruch erhebt, neue Beiträge zu den vieldiskutierten und bis heute noch ungelösten Fragen der etruskischen Kultur und Geschichte zu liefern, sondern das die bisherigen Ergebnisse in einer ansdiaulich geschriebenen Darstellung vor dem Leser ausbreitet. Es füllt mit dieser allgemeinverständlichen und doch fachlich wohlfundierten Form eine Lücke in der deutschsprachigen Literatur, während ihm in der reichen italienischen Literatur am ehesten die Bücher der Etruskologen Bartolomeo Nogara . („Gli Etrusdii el la loro civilti“, 1933) und Pencle Ducati („Voci di Etruria“, 1939) verglichen werden Winnen. Mit den feinsinnigen Imp-essio- nen Ducatis verbindet das vorliegende Werk vor allem der Vorteil, daß hier die verschiedenen Seiten der etruskischen Geschichte im Zusammenhang mit den wichtigsten Stätten der tyrrhenischen Kultur dargestellt und so gleichsam in der toskanisch-umbrischen Landschaft verankert werden. Ein weiterer Vorzug liegt in der unter Zuhilfenahme von Wort und Bild geglückten Herausarbeitung des- Fortlebens etruskischer Traditionen und Formen über die römische Antike, das christliche Mittelalter, die Renaissance bis zur Gegenwart — ganz besonders auf dem Gebiet der bildenden Kunst. Hat doch einst schon Winckelmann die seltsame Verwandtschaft des von ihm so wenig geschätzten Michelangelo mit der etruskischen Kunsttradition erkannt. Die ausgezeichneten Abbildungen — größtenteils nach Photographien von Dr. Eugen Haas, Rom — bilden eine besonders begrüßenswerte Ergänzung des auch in der Ausstattung bemerkenswerten Buches.
Dr. Adam Wandruszka
Die Wissenschaft der Griechen und ihre Bedeutung für uns. (Von Thales bis Aristoteles.)
Von Benjamin Farrington. Neues Österreich, Wien. 112 Seiten.
Das vorzüglich übersetzte Werk geht von der Auffassung J. G. Crowthers aus: „Wissenschaft ist das System des Verfahrens, durch das der Mensch sich zum Meister seiner Umgebung macht.“ In dieser Beschränkung auf das rein Technische sieht er in den Griechen „kaum mehr als gelehrige Schüler der vorhellenischen Kulturen“. Die Beschreibung der Leistungen dieser „vor aller Zivilisation“ bestehenden Wissenschaft stützt sich auf eine Reihe hier zur Zeit nicht zugänglicher Werke, die das rein Technische der Mechanik, Chemie und Medizin berücksichtigen, aber konsequenterweise keine Notiz von der geistigen Leistung der Sprachschöpfung nehmen. Ackerbau und Viehzucht sind (im Widerspruch mit der Definition) ebenfalls nicht berücksichtigt. Nach der Darstellung der ägyptischen und mesopotamischen Technik folgt die' Schilderung der griechischen Wissenschaft von 600 bis 322 v. Chr. Ansprechend ist hier die ständige Bezugnahme auf das technische Element bei den Vorstellungen der Hylozoisten und die Betonung des Experiments in den hippokratischen Schriften, wodurch eine Reihe neuer Interpretationsmöglichkeiten in den platonischen Dialogen wahrscheinlich werden. Ebenso wichtig ist die Betonung der sozial so folgenschweren Trennung von Philosophie und Technik durch Pythagoras, Platon und Aristoteles und ihrer Verachtung der manuellen Arbeit bis zur metaphysischen Begründung der Sklaverei. Er sieht in ihnen die Vertreter der politisch-religiösen Tradition griechischen Denkens. „Theologische Astronomie und teleologische Physik stellen Verfälschungen der Wissenschaft dar, denen letztlich politische Bedürfnisse zugrunde liegen, nämlich die Volksmassen und die Sklaven in Schach zu halten“ (Seite 107). Von einer Überwindung Platons und Aristoteles’ in den für die Wissenschaft „am wenigsten bedeutenden“ (Seite 23) Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit durch das Christentum und der Heiligung der Arbeit durch dasselbe nimmt Farrington ebensowenig Notiz wie von der Tatsache, daß atheistischer „Humanismus“ die Erneuerung der
Sklaverei im 20. Jahrhundert mit sich brachte. — Das Buch ist für den Fachmann anregend, als Teil der Phönix-Bücherei „Wissenschaft für jedermann“ muß es jedoch zu schwersten Irrtümern führen, die durch die ständigen geist- reichelnden Sticheleien gegen das Christentum ihre Tendenz etwas grob unterstreichen.
Dr. Wilhelm Krause
Der heilige Hermagoras. Eine kritische Untersuchung von Rudolf Egger. Verlag Ferd. Kleinmayr, Klagenfurt 1948. 85 Seiten.
Die spätantiken und frühmittelalterlichen Heiligenbiographien besitzen sehr verschiedenen historischen Gehalt. Österreich verfügt in der Vita Sancti Severini über eine Quelle von unschätzbarem Wert zur Geschichte seiner Donauländer im „dunklen“ 5. Jahrhundert. Aus der in einer Fassung der Karolingerzeit überlieferten Leidensgeschichte des heiligen Florian läßt sich immerhin ein historischer Kern mit wichtigem Inhalt herausschälen. Anders steht es um die Legende des Heiligen, der dem schönen Kärntner Städtchen Hermagor seinen fremdartig klingenden Namen gegeben hat. Unsicherheit der Schreibung ließ aus dem pannonischen Märtyrer Hermogenes der diokletianischen Verfolgung einen Hermagoras werden. Zu diesem Namen erfand die Phantasie eines in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts in Aquileja tätigen Legendendichters die Gestalt eines Gefährten des Evangelisten Markus, der den eben durch hunnische Zerstörung betroffenen und in seinem Dasein bedrohten Bischofssitz am Isonzo schon in christlicher Urzeit gegründet habe. In seltsamem Anachronismus bleibt der Name des Gotenkönigs Ataulf. des Schwagers und Nachfolgers Alarichs, .zu dessen Zeit die pannonischen Reliquien nach Italien gekommen waren, mit der Tätigkeit des Hermagoras verknüpft. — Soweit in Kürze das- Ergebnis von Rudolf Eggers weitausholender Untersuchung, die sich durch Gründlichkeit der Quellenkritik wie Klarheit der Darstellung auszeichnet und allem Anschein nach den Schlußpunkt hinter ein umstrittenes Problem der oberitalienischen und österreichischen Kirchengeschichte setzt.
Univ.-Dozent Dr. Erich Zöllner
Der Wiener Kongreß. Über die Einigkeit unter Verbündeten. Von Harald Nicol son. Atlantis-Verlag, Zürich.
Eine brillante belletristische Leistung, die jedoch die Reihenfolge der beiden Teile des Titels nicht rechtfertigt, da Nicolson den Wiener Kongreß auf 108 von 335 Seiten abtut und sonst hauptsächlich die Tätigkeit Castlereaghs in den Jahren 1813 bis 1822 schildert. Für diesen recht aufschlußreichen Beitrag zur Geschichte der letzten Koalition gegen Frankreich und der Heiligen Allianz hat der Autor eingestandenermaßen das Standardwerk „The Foreign Policy of Castlereagh“ Charles Websters herangezogen. Leider zeigt er sich ebenso wie in der Rechtschreibung der Eigennamen in der Geschichte anderer Staaten nicht genügend beschlagen und stellt er über England einige recht befremdende Behauptungen auf: zwanzig Jahre habe es Blut (sic!) und Geld geopfert, allein gegen Napoleon Widerstand geleistet, seine Seeherrschaft „zu allseitigem Nutz und Frommen“ au-geübt. Ferner werden wir dahin belehrt, daß die „Balance of Power“ eine der „stabilsten Friedensgarantien“ gewesen sei und die englische Vorherrschaft 1814 bis 1914 „einen unermeßlichen Segen von Frieden und Wohlstand … auch auf die ganze Völkergemeinschaft der Erde ausgestreut hat“. In den Kapiteln über den Wiener Kongreß hätten wir allerdings gerne etwas mehr über die Politik Rußlands und Preußens erfahren. Sehr bedauerlich ist, daß Nicolson das Wiener Staatsarchiv nicht benützte und die ihm in den Ori ginaltexten unbekannten Polizeiberichte als von „unvorstellbarer Abgeschmacktheit“ ablehnte. Er hätte an der Hand dieser Dokumente seine Leser in mancher Beziehung über den Wiener Kongreß richtiger informiert. Eugen Marian
Die letzten Tage eines Königs. Roman von Moritz Hartmann. Mit einem novellistischen Anhang „Die letzte Montanini“ desselben Autors. Verlag österreichische Buchgemeinschaft. 257 Seiten.
Die romanhafte Behandlung der letzten Schicksale Joachim Murats, des Schwagers Napoleons I. und gewesenen Königs Von Neapel, ist ein Werk eines heute fast verschollenen, fruchtbaren Schriftstellers, des 1821 in Prag geborenen und 1873 in Wien gestorbenen Moritz Hartmann; der gepflegte Stil im Geschmack des Biedermeier weist deutlich die zeitliche Herkunft. Nicht minder die Stoffbearbeitung, deren Verherrlichung ihres Helden als Befreier von der Bourbonenherrschaft im Geiste der Achtundvierzigerideen empfunden ist. Romantische Szenen umweben die letzten Tage des in seine korsische Heimat geflüchteten Exkönigs. Sosehr ihn der Autor mit Worten als Sieger und Helden feiert, so gelingt ihm doch nur die Charakteristik eines Mannes, der, theatralisch in seiner Geste, unentschlossen zwischen der Annahme eines ihm von Österreich angebotenen Asyls und einem fast naiv abenteuerlichen Unternehmen zur Eroberung des Königreiches Neapel hin und her schwankt. Gegen alle Warnung entschließt er sich dann, auf die zugesagte Hilfe der Carbonari vertrauend, plötzlich zu dem alsbald lächerlich scheiternden Handstreich, in dem er das Leben verliert. Dem modernen Formgefühl fremd geworden, mag dieser Roman dem Liebhaber selten erreichbarer, immerhin beachtlicher alter österreichischer Literatur willkommen sein. Die angeschlossene Novelle wäre besser weggeblieben. Leider ist die Ausgabe von nicht wenigen störenden Druckfehlern heimgesucht.
f.
Hotel Zugvogel. Roman von Otto Fritz Beer. Ullstein-Verlag, Wien 1948. 278 Seiten.
Das Hotel mit dem sinnvollen Namen „Zugvogel" ist eine Art Arche Noah, in die sich im Frühjahr 1945 ein Dutzend Schiffbrüchige aus den wildbewegten Fluten des Weltgeschehens retten. Es ist eine ungleiche Gesellschaft von Idealisten und Bankerotteuren, Heimkehrern und ewigen Vaganten: Strandgut der zwei großen Kriegskatastrophen des Jahrhunderts. Einen ganzen zauberhaften Salzkammergutsommer lang preßt sie die erregte Zeit zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen. Neigungen und Leidenschaften flackern auf, die freilich fast zur Gänze im ersten Tau des Herbstes wieder zerfallen. Aber auch Gutes, Gesundes hat sich gesetzt, geklärt und wird weiterleben. — Ein interessantes, eigenwilliges Buch, in einzelnen Phasen sehr frei; doch springt alles Leidenschaftliche und Böse wie ein Funken aus der hochgespannten Zeit heraus. Das macht das Atmosphärische, das Wertvoll, das Dichterische dieses Buches aus. Dr. Roman Herle
Der Tänzer. Von Victor Scheiterbauer. Verlag Hans Fleischmann, Wien 1947.
Ein durchaus gelungener Versuch, die Kunst Harald Kreutzbergs durch Wort und Vers zu zeichnen, da er aus einer ungewöhnlich tiefen Einfühlung und einer wirklichen Ergriffenheit zu stammen scheint. Gerade weil das Ganze ge- geglückt ist, sei gestattet, festzustellen, daß bisweilen der Rhythmus etwas stockend ist und daß sich gelegentlich eine sprachliche Härte findet. Das muß deshalb gesagt werden, weil Verse von solcher Klarheit und Schönheit in dem schmalen Bändchen stehen, daß man beglückt empfindet: die hat ein wirklicher Dichter geschrieben.