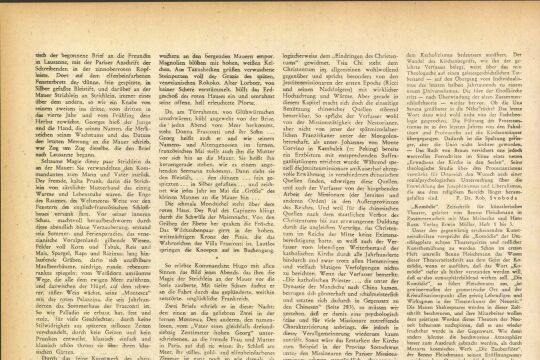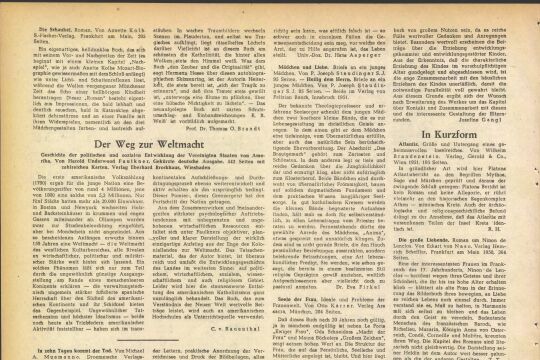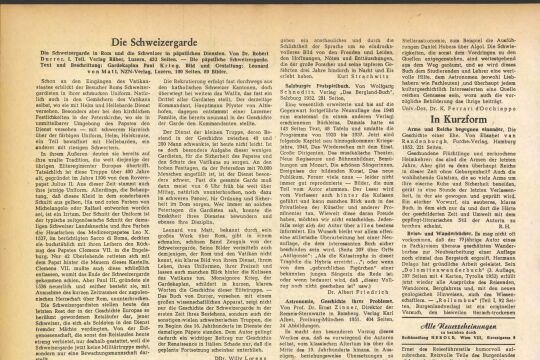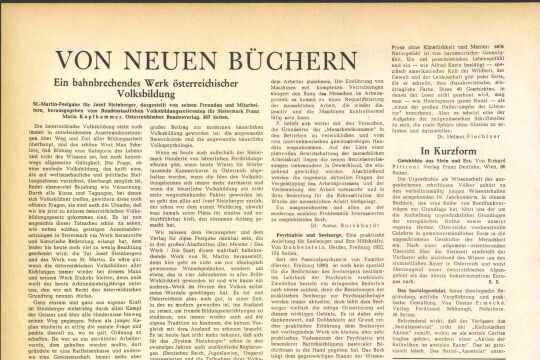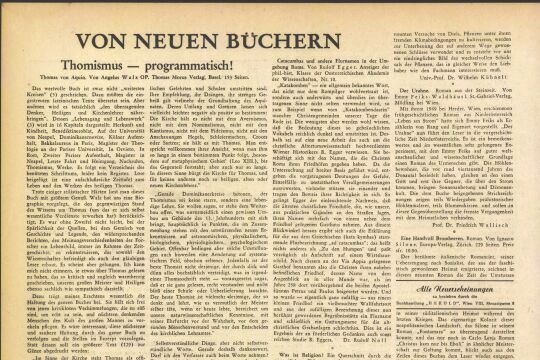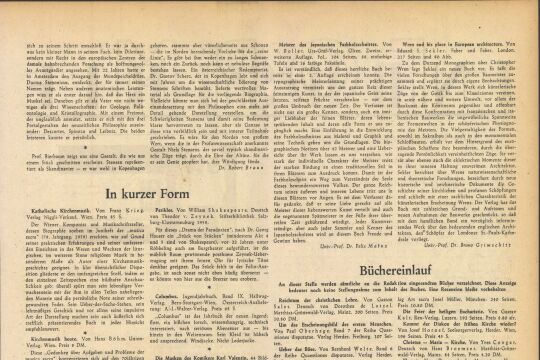VON NEUEN BÜCHERN
Von Universitätsprofessor Dr. Viktor von Ger amb
Von Universitätsprofessor Dr. Viktor von Ger amb
Der Direktor des Kärntner Landesarchivs Dr. Hermann W i e ß n e r hat uns ein schmales, aber inhaltsreiches Buch geschenkt*, das in gründlichster, wissenschaftlich fest unterbauter Arbeit zweitausend jähre der Entwicklungsgeschichte unserer Dorfgemeinden vor uns abrollen läßt. Die Schrift behandelt Siedlungs- und Dorfformen, Fluren und Ortsnamen, Grundherren und Dorfbewohner, Nachbarschaften und Wirtschaftsarten sowie die eigenrechtliche Entwicklung der Gemeinden bis herauf zur „freien Gemeinde im freien Staat“.
Neu sind für den Fachmann an dem Budi weniger die Einzelheiten als vielmehr ihre sorgfältige Zusammenfassung und die straffe Hinordnung 'auf die Lebensformen der Dorfgemeinde „als der wichtigsten ländlichen Siedlungsform und der bedeutsamsten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Körperschaft unseres Volkes“. Für den gebildeten Nichtfachmann aber bedeutet das Buch noch viel mehr: eine Summe von Erkenntnissen nach dem neuesten Stande der Forschung, die jeden angehen, den das keimkräftige Leben des Mutterbodens unseres Volkes interessiert.
Von solchen Erkenntnissen seien hier nur etliche Beispiele angeführt: Das Wort „Dorf“ (lateinisch turba, germanisch thorp, dorph und dorf) bedeutet eine gehäufte Niederlassung der Ackerbauer, im Gegensatz zum Einzelgehöft, dem Weiler oder den Siedlungsketten der Bergbauern und Viehzüchter. Daher begegnen wir dem Dorf von Anfang an vornehmlich in Landstrichen mit Getreidebau. Schon die Einwanderung der Bayern aus dem böhmischen Raum über die Sättel des südlichen Böhmerwaldes hatte (zwischen 488 und 550) das reidie Getreideland in Ufernorikum zwischen der Traun dem Inn und den Alpen zum Ziel. Vom oberösterreichisdien Donau- und vom österreichisch-bayrischen Inngebiet aus verbreiteten sich die Bajuvaren allmählich westlich bis Wim Lech, östlich zunächst bis in die Gegend von Melk und südlich in die breiten Talböden der Alpenflüsse von Tirol, Salzburg, Oberösterreich und später auch der Steiermark. Um 600 finden wir sie bereits um Bozen, von wo sie, ostwärts schwenkend, die Alpenslawen überschichteten. Von den vor 800 bezeugten Ortsnamen mit der bayrischen Endsilbe „— ing“ finden sich 1700 in Oberösterreich, aber nur 150 in Niederösterreich, 100 in Steiermark, 50 in Kärnten und 30 in Tirol. Von den Dorfformen stellt das unregelmäßige Haufendorf die ältere Art dar, wogegen die Zeilen-, Straßen-, Anger-, Rundling- und Platzdörfer jüngere planmäßige Anlagen sind.
Während man früher die Dorfgemeinde nach ihrem lateinischen Namen „familia“ aus der Familie und Sippe herleitete, erkennt man heute, daß dieses Wort „familia“ viel häufiger das gemeint hat, was die Bauern heute noch „die Freundschaft“ nennen, nämlich die Nachbarschaft. Auch ohne leibliche Verwandtschaft — die besonders in älterer Zeit gewiß mitgespielt hat — entwickelte sich unter den Dorfbewohnern ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Die Regelung der Gemeinwirtschaft im Dorfe selbst, wie zum Beispiel die Wassernutzung („Brunnengenossenschaft“), die Schutz-, Rechts- und Kultgemeinschaft, die gegenseitigen Hilfeleistungen, die gemeinschaftliche Erhaltung der Straßen, Wege, Brücken, Stege und Zäune, der Feldbestellungsplan, der alle anging, die gemeinsame Waldnutzung und Rodung, die Grenzbestimmungen und alle die gemeinsamen Lasten verschmolzen -solche Gemeinschaft immer enger. Ihr Ausdruck sind die Gemeindeversammlungen, die anfänglich unter grundherrlidiem Vorsitz standen, allmählich aber immer selbständiger wurden.
Doch wäre es falsch, diese Gemeinschaft als eine uniforme, durch Alltag und Lasten abgestumpfte Masse anzusehen. Dagegen schützte schon die Arbeit in Feld und Wald und die Mannigfaltigkeit der sozialen Schieb-' tung innerhalb der Dorfbewohner. Schon die „Bergler“ und „Riedleute“ (Bergbauern) unterschieden sich wirtschaftlich von denen „auf dem Lande“. Aber auch diese selbst waren nach den Besitzverhältnissen sozial in Voll-, Halb-, Viertel- und Achtelhöfner, in Häusler, Söllner, Pointner, Keuschler. Tagwercher und Einleger (Herberger) geschieden. Aus der Heranziehung der Gemeinleute zu Zeugenschaften in die Rechtshändel der Grundherren entkeimte — wie Wießner schön und eingehend darlegt — eine zunächst sehr besdieidene, dann aber immer kräftigere eigenrechtliche Entwicklung des Dorflebens. Die zahlreichen österreichischen Weistümer, die alle Gemeindeordnungen — sehr zum Unterschiede von den papierenen Erlässen späterer Zeiten — in prächtigem, volk-und bildhaftem Deutsch verzeichnen, lassen uns tiefe Einblicke tun in den gesunden Wirklichkeitssinn und in den treffenden Mutterwitz der „Gemein“. Da ist alles bildhaft klar und greifbar und jedem verständlich ausgedrückt: die Nachbarfelder zum Beispiel dürfen nur überfahren werden, „ehe das Korn oder Gras die Langwied (den Längsbalken an. der Unterseite des Wagens) berührt“ oder: die Hühner des Nachbarn dürfen nicht weiter herumgehen, „als einer vom Dachfirst aus mit einem schibeling (Armschwung) einen Handschuh werfen mag“ usw.
Im Wege des Gewohnheitsrechtes bildet sich mehr und mehr ein eigenes, immer selbständigeres Dorf gericht aus. mit Friedungsbezirk und Asylrecht, mit einem Dorfmeister und ehrenamtlicher. Dorfrechtsorganen (Dorfgeschworenen, Schergen, Gerichtsboten, Flurhütern, Alpmeistern und andere), zu denen noch die untergeordneten Gemeindedienstleute (Saltner, Wegmacher, Hirten, Albgänger, Wächter. Armenväter — genannt Spitaler — und Meßner) treten. Damit veränderte sich mehr und mehr das alte grundherrlich-bäuerliche Verhältnis bis zur völligen „Bauernbefreiung“, deren Geschichte den letzten Teil des Buches ausfüllt.
Alles in allem zeigt die zweitausendjährige Entwicklung unserer Dörfer „ein zähes, mitunter erbittertes Ringen“ um kluge Lebensformung und um die Freiheiten der Gemeinden, „nicht frei von Rückschlägen, aber schließlich doch von- Erfolg gekrönt, nicht weil die Macht, sondern die alles überwindende sittliche Idee des Rechtes auf der Seite des Dorfes und seiner Bewohner stand“.
„Die Formen unseres Denkens.“ Von Dr. Johann F i s c h 1. Band 1 der Reihe: Christliche Philosophie in Einzeldarstellungen. Verlag Anton Pustet, Graz.
Der Verfasser, Professor für Philosophie an der theologischen Fakultät in Graz, hat die Gabe, das an und für sich trockenste Gebiet der Philosophie, .die Logik, nicht nur in klarer und übersichtlicher, sondern auch in interessanter Weise darzustellen. Das Buch hat an sich keine wissenschaftliche Aufgabe, es wird um so mehr für Theologiestudenten und für interessierte Laien eine sehr wertvolle Einführung bieten. In einer Neuauflage würde man sich wünschen, daß in Fußnoten weitere Literatur zur Tieferführung der Probleme angegeben würden. P. Dr. L. S o u k u p
Emil Kofier: „Des Christen Glaube und Wandel.“ Ein Buch für denkende Leute. 1. Bd. 352 Seiten, 1946. Verlag Felizian Rauch Innsbruck.
Das Buch ist für einfache, aber denkende Leute bestimmt und will der reiferen Jugend und Erwachsenen zur Fortbildung im Anschluß in den Katechismus dienen. Es behandelt in klarer, nüchterner Sprache die Lehre von Gott, die Gebote und die Sakramente. Bewußt vermeidet es Art und Form der meisten modernen religiösen Bücher und spricht ob seiner ehrlichen
Geradheit an. Der Verfasser nennt die Christen-.ehre eine Volkshochschule für Moral, Apologetik und Sozialwissenschaft und strebt mit .einem Buch ein ähnliches Ziel an. Der Leserkreis, der ihm vorschwebt, wird juf seine Rechnung kommen. Drucktechnisch wäre die gestürzte Zeile Seite 152 zu vermeiden gewesen.
DDr. Karl E d e r, Linz
„Das Zeitalter Maria ^Theresias und ihrer Söhne (1740 — 1792).“ Von Otto Fraß. Heft 7/8 der „Geschichte Österreichs in Einzeldarstellungen“, herausgegeben von Dr. Ferdinand Tremmel. Steirische Verlagsanstalt, Graz-Wien, 1946.
Es ist erstaunlich, welche Fülle historischen Materials der Verfasser in dem ihm zu Gebote gestandenen Rahmen gesamrftelt hat. ohne seine Darstellungen durch den zweckbedingten. Kurzstil leiden zu lassen. Kam die große Kaiserin für die unter dem Berliner Gesichtswinkel geschriebene Geschichte fast nur als die Gegenspielerin Friedrich II. in Frage, so kommt hier in klarer, sachlicher und objektiver Schilderung zu vollster Geltung, wie sehr sie als Landesmutter für das Wohl ihrer Untertanen sorgte: :nnerpolitisch, in der Wirtschaft und auf dem Gebiete des Handels. Wertvoll sind auch die Rückblicke auf die Architektur, darstellende Kunst und das Musikschaffen jener Zeit
Alfred v. Koudelka
„Gespräche in Sybaris.“ Tragödie einer Stadt. Von ““Mechtilde Lichnowsky. Gallus-Ver-l.isr, Wien. 141 Seiten.
In 21 kleinen .Dialogen“ (bisweilen aber sind an ihnen auch mehrere Personen beteiligt, so daß die Bezeichnung „Dialoge“ nicht immer zutrifft) wird in dichterisch freier Vision dargetan, wie es zur Zerstörung der schönen, reichen Handelsstadt Sybaris gekommen sein mag. Zugleich wird eine gründliche Ehrenrettung ihrer Einwohner unternommen, denn die Sybariten nnd hier keineswegs die hemmungsloser Genußsucht fröhnenden, verweichlichten Schlemmer, zu denen das Sprichwort sie gestempelt hat, es sind Menschen von einer höchst verfeinerten, ja überfeinerten Kultur aller Lebensformen, der Kleidung, des Wohnens, des Essens, aber auch des Körpersports und nicht minder1 auch des Denkens und der durchgeistigten Geselligkeit, es sind Menschen von vornehmster Kultur des Herzens. Wir finden die Männer eifrig mit der Erörterung künstlerischer und philosophischer Probleme beschäftigt, und ihre schönen Frauen zeigen ausnahmslos edles Gehaben. Dem Krieg sind sie im tiefsten Grunde ihres Wesens abgeneigt, sie machen sich überhaupt keine Vorstellung, was Krieg eigentlich ist, er scheint ihnen gar nicht im Bereiche gefährlicher Möglichkeiten zu liegen. Und so fallen sie fast ahnungslos und wehrlos dem räuberischen Angriff der Krotoniaten zum Opfer, deren brutaler Anführer, jener sagenhafte Muskelmensch Milon, sich heimtückisch den nötigen Kriegsvorwand schafft, indem er seine eigenen, nach Sybaris entsendeten Boten dort meuchlerisch hinmorden läßt und so die Sybariten mit dem Verdacht belastet, diese Untat begangen zu haben. Damit tritt die Tragödie in fühlbare Beziehung zu gewissen Vorgängen, die in unserer nahen Vergangenheit mehrfach den gesuchten „Kriegsgrund“ abgeben mußten für Überfälle auf friedliche Nachbarvölker. — Diese Dialoge bewegen sich auf einer ungewöhnlich hohen geistigen und gedanklichen Ebene und Xbedieneh sich einer überaus gepflegten, dichterisch beschwingten Sprache. Da sich aber die Handlung der Tragödie nur zögernd aufbaut, da ihre Form so ziemlich allen überkommenen Gesetzen der Dramaturgie zuwiderläuft und da ihre anspruchsvollen Regie-anweisüngen kaum restlos erfüllbar sind, so steht es leider sehr in Frage, ob unser Theater etwas mit ihr anzufangen weiß, es müßte denn eine Bühne sein, die das Experiment wagen darf im Vertrauen auf einen Kreis ausgewählter Feinschmecker, sozusagen literarischer Sybariten.
Stiftegger
„Versöhnung.“ Roman von Georg Jantschge. Friedr.-Scheibl-Verl., Wien, 1946, 452 Seiten. Preis S 12.—, Ln. S 26.—.
Der erste uns bekannte Versuch, in einer (hier Roman genannten) Erzählung die Überfülle der Ereignisse und Schicksale als Erleben zu schildern, die aus der ersten Vorkriegszeit durch Krieg, Zusammenbruch, Revolution und das schwere Ringen der ersten Republik hindurch zur Vergewaltigung Österreichs, Hitlers Krieg gegen die ganze Welt und endlich zur Befreiung führten. Oft überdeckt der Annalist den Erzähler, dessen Vaterlandsliebe nicht müde wird, in immer neuen Einzelheiten und Personen den Lebens- und Freiheitswillen der Österreicher erglänzen zu lassen. elm.
„Geschichte der Pfarrgemeinde Mauerbach.“ Von Georg Grausam. Verlag Pfarre Mauerbach bie Wien.
In einer nett gehaltenen Festschrift werden wir mit dem Schicksal der einst bekannten und blühenden Kartause in der unmittelbaren Umgebung Wiens vertraut gemacht. In den Jahren 1616 bis 1631 im Barockstil vollkommen neu aufgebaut, wurde sie von den Zeitgenossen „wegen ihrer Schönheit und Pracht nicht als eine Wohnung von Mönchen, sondern als kaiserlicher Palast gehalten.“ Türkenkriege und Unglücksfälle ließen das reiche Kloster verarmen, und seit Josef II. aufgehoben, wurden seine Einrichtungen und der Besitz j in alle Winde zerstreut. Mit Mühe und Fleiß wurde die neue Pfarre aufgebaut und ist in stetem Anwachsen begriffen. Auch davon erzählt die Festschrift in plastischer Weise.