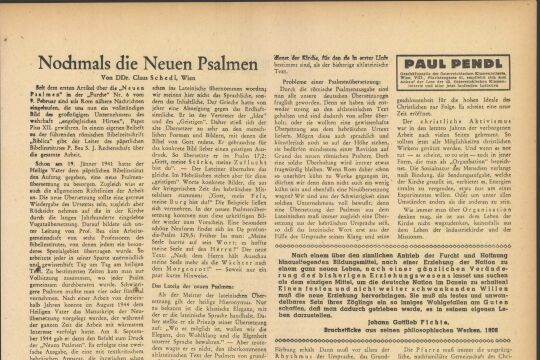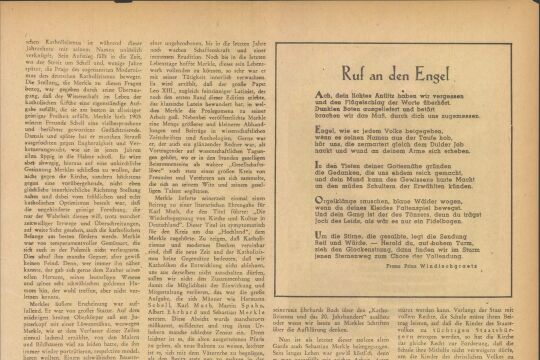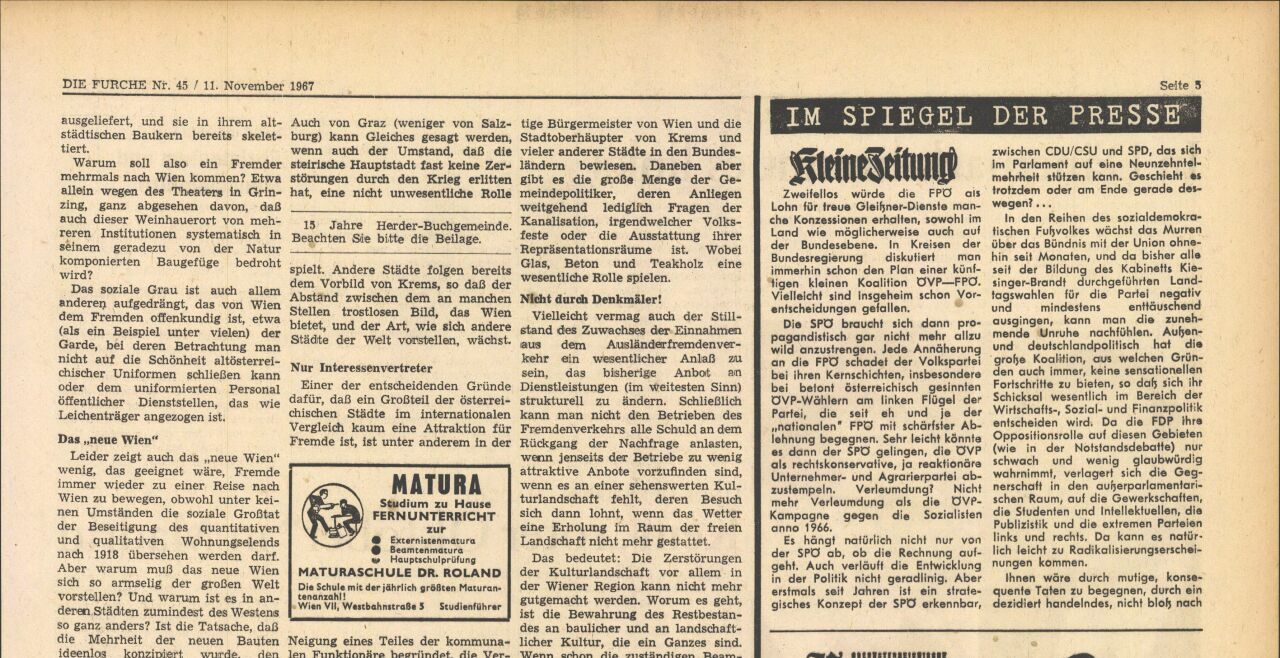
ausgeliefert, und sie in ihrem altstädtischen Baukern bereits skelet-tiert.
Warum soll also ein Fremder mehrmals nach Wien kommen? Etwa allein wegen des Theaters in Grin-zing, ganz abgesehen davon, daß auch dieser Weinhauerort von mehreren Institutionen systematisch in seinem geradezu von der Natur komponierten Baugefüge bedroht wird?
Das soziale Grau ist auch allem anderen aufgedrängt, das von Wien dem Fremden offenkundig ist, etwa (als ein Beispiel unter vielen) der Garde, bei deren Betrachtung man nicht auf die Schönheit altösterreichischer Uniformen schließen kann oder dem uniformierten Personal öffentlicher Dienststellen, das wie Leichenträger angezogen ist.
Das „neue Wien“
Leider zeigt auch das „neue Wien“ wenig, das geeignet wäre, Fremde immer wieder zu einer Reise nach Wien zu bewegen, obwohl unter keinen Umständen die soziale Großtat der Beseitigung des quantitativen und qualitativen Wohnungselends nach 1918 übersehen werden darf. Aber warum muß das neue Wien sich so armselig der großen Welt vorstellen? Und warum ist es in anderen Städten zumindest des Westens so ganz anders? Ist die Tatsache, daß die Mehrheit der neuen Bauten ideenlos konzipiert wurde, den Architekten anzulasten oder dem System?
Nun ist die weitgehende Liquidation des Sehenswerten in Wien glücklicherweise ein Einzelfall — zumindest geblieben. Krems ist in der Erhaltung seines Stadtkernes ein Vorbild, nicht nur für Österreich.
Auch von Graz (weniger von Salzburg) kann Gleiches gesagt werden, wenn auch der Umstand, daß die steirische Hauptstadt fast keine Zerstörungen durch den Krieg erlitten hat, eine nicht unwesentliche Rolle
spielt. Andere Städte folgen bereits dem Vorbild von Krems, so daß der Abstand zwischen dem an manchen Stellen trostlosen Bild, das Wien bietet, und der Art, wie sich andere Städte der Welt vorstellen, wächst.
Nur Interessenvertreter
Einer der entscheidenden Gründe dafür, daß ein Großteil der österreichischen Städte im internationalen Vergleich kaum eine Attraktion für Fremde ist, ist unter anderem in der
Neigung eines Teiles der kommunalen Funktionäre begründet, die Vertreter von kurzfristigen Interessen, und nur dies zu sein.
Daß es auch anders sein kann, dafür gibt es glücklicherweise Beispiele in unserem Land. Wie sehr ein Politiker mit seinem Amt auch auf der Ebene der Gemeindepolitik wachsen kann, haben der gegenwär-
tige Bürgermeister von Wien und die Stadtoberhäupter von Krems und vieler anderer Städte in den Bundesländern bewiesen. Daneben aber gibt es die große Menge der Gemeindepolitiker, deren Anliegen weitgehend lediglich Fragen der Kanalisation, irgendwelcher Volksfeste oder die Ausstattung ihrer Repräsentationsräume ist. Wobei Glas, Beton und Teakholz eine wesentliche Rolle spielen.
Nicht durch Denkmäler!
Vielleicht vermag auch der Stillstand des Zuwachses der Einnahmen aus dem Auisländerfremdenveir-kehr ein wesentlicher Anlaß zu sein, das bisherige Anbot am Dienstleistungen (im weitesten Sinn) strukturell zu ändern. Schließlich kann man nicht den Betrieben des Fremdenverkehrs alle Schuld an dem Rückgang der Nachfrage anlasten, wenn jenseits der Betriebe zu wenig attraktive Anbote vorzufinden sind, wenn es an einer sehenswerten Kulturlandschaft fehlt, deren Besuch sich dann lohnt, wenn das Wetter eine Erholung im Raum der freien Landschaft nicht mehr gestattet.
Das bedeutet: Die Zerstörungen der Kulturlandschaft vor allem in der Wiener Region kann nicht mehr gutgemacht werden. Worum es geht, ist die Bewahrung des Restbestandes an baulicher und an landschaftlicher Kultur, die ein Ganzes sind. Wenn schon die zuständigen Beamten und Politiker mangels „Grundstimmung“ kein ausreichendes kulturelles Verständnis haben, sollten sie zumindest die Bedachtnahme auf den Kommerz veranlassen, den Ruf unseres Landes notdürftig wieder herzustellen. Nicht aber durch Denkmäler!
Im Jänner dieses Jahres fand in Wien eine Enquete statt, bei der zahlreiche Fachleute nach Möglichkeiten zur Behebung des akuten Mangels an Krankenpflegerinnen suchten. Eine Reihe von Rationalisierungsmaßnahmen wurden erwögen und auch die Einführung eines freiwilligen Sozialjahres für Mädchen zur Diskussion gestellt. Bedauerlicherweise wurde in der österreichischen Presse die Diskussion kaum aufgenommen, es wurde lediglich berichtet oder „entschieden abgelehnt“. Ehe man den Plan jedoch endgültig verwirft, aber auch ehe man an seine Konkretisierung denkt, sollte man sich damit jedoch ernsthaft auseinandersetzen — wie es schon seit geraumer Zeit in der Presse der deutschsprachigen Nachbarländer geschieht — und die Für und Wider gewissenhaft gegeneinander abwägen.
Wo liegen die Ansatzpunkte für eine solche Diskussion?
• Das Faktum des Personalmangels in Spitälern, Heimen, Kindergärten, ganz allgemein in sozialen Einrichtungen, ist allgemein bekannt und beunruhigt die Fachleute. Ebenso bekannt ist die Überlastung der Mütter in kinderreichen Familien und vieler Bäuerinnen. Daß es wenig sinnvoll ist, diesen Mangel fortgesetzt zu beklagen, weil sich an den Berufen Interessierte sonst als soziale Lückenbüßer ansehen müssen und Lückenbüßer zu sein noch nie erstrebenswert war, man die betreffenden Berufe mit diesen Klagen also kaum attraktiver macht, steht auf einem anderen Blatt. Das Sozialjahr könnte aus zwei Gründen eine spürbare Erleichterung bringen. Zunächst direkt, durch den Einsatz der Mädchen selbst, dann aber auch indirekt, durch eine zu erwartende Zunahme des Interesses an sozialen Berufen bei der Berufswahl, bedingt durch den persönlichen Kontakt und die eingehendere Information.
Für ein freiwilliges Sozialjahr?
• Obligatorisch oder freiwillig? Einerseits hätte man im Bundesheer das männliche Gegenstück zum „sozialen Pflichtjahr für Mädchen“. Anderseits sprechen eine Reihe von
Umständen gegen das „Pflichtjahr“. So gehört der „Reichsarbeitsdienst“ noch nicht zur bewältigten Vergangenheit. Nimmt man Geschichte ernst, hat der Einwand Gewicht Weiters dürfte es in der Praxis schwierig, unrationell, wenn nicht sogar unrealisierbar sein, einen Apparat mit den für ein Pflicht jähr erforderlichen ! Dimensionen zu schaffen. Auch könnte sich der Zwang, unter dem ein Mädchen „sozial“ tätig wird, recht unangenehm für die Betreuten auswirken und außerdem eine unzumutbare Belastung für die Einführenden bedeuten. Zu bedenken wäre noch, ob damit nicht die Gefahr einer allgemeinen Diskriminierung dieser Berufe verbunden und der oben angenommene Werbeeffekt in Frage gestellt wäre. Die berechtigten und unberechtigten Widerstände gegen ein Pflicht jähr wären — soweit sich die Situation abschätzen läßt — heute unüberwindbar groß. Entscheidet man sich dagegen für das freiwillige Sozialjahr, haben Proteste
aus den verschiedenen Lagern von vornherein keinen Wind in ihren Segeln, denn dagegen, daß andere freiwillig ihre Zeit und Kraft der Gesellschaft zur Verfügung stellen, kann man kaum sachlich gerechtfertigt protestieren.
• Fragen wie Dauer, Höchst- und Mindestalter, Sozialversicherung, Entgelt, Anrechenbarkeit, Amtshaftung und Amtsverschwiegenheit, Abgrenzung der Einsatzmöglichkeiten, Betreuung durch geeignete Fachkräfte usw. wären eindeutig und unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen beider Seiten zu regeln.
• Haben überlastete Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen, Erzieher und Sozialarbeiter überhaupt Zeit, neben ihrer Arbeit junge Mädchen einzuführen und anzuleiten? Das scheint eine berechtigte Sorgte zu sein. Trotzdem wird dabei etwas Wesentliches übersehen: Es ist
für sozial Tätige oft Bedürfnis und Freude, interessierten jungen Menschen ihre Arbeit zu zeigen, eigene Erfahrungen weiterzugeben und die persönliche Einstellung verständlich zu machen. Diese Feststellung darf ich auf Grund einiger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen aus sozialen Berufen machen. Es kommt noch dazu, daß bei vielen einfachen Handreichungen und Hilfeleistungen die Mädchen von Anfang an wertvolle Mitarbeiter sind, die qualifizierte Kräfte von zeitraubenden Arbeiten entlasten.
Erlebnis des Helfens
• „... daß bei vielen Mädchen die Gefahr besteht, durch wochenlangen Anblick all der körperlichen und psychischen Leiden in ihrem seelischen Gleichgewicht erschüttert zu werden“, wie es die Schweizer Frauenorganisationen formulierten, gilt nur bei Überforderung und ungenügender Einführung und Betreuung. Diese Vorstellung unterschätzt auch die gesunden körperlichen und geistigen Kräfte des jungen Menschen und geht von der falschen Annahme aus, daß Neigung und Eignung der Mädchen bei der Art des Einsatzes keine Berücksichtigung finden.
Daß es so viel Elend und Not gibt, von denen der Durchschnittsbürger nichts weiß, ist für jeden, der es erlebt, erschütternd. Zugleich aber ist es für jeden, der es bewußt erlebt, aufbauende Erfahrung. Man nimmt seine eigenen Leiden, sein Ich nicht mehr so wichtig und wird reifer. Das Helfendürfen ist für junge Menschen ein Erlebnis, das Erlebnis, das ihnen selbst oft viel mehr bedeutet als denen, denen sie geholfen haben. Auch diese Behauptung steht auf dem Boden praktischer Erfahrung. Der Kontakt mit Menschen aus anderen Gesellschaftsschichten ermöglicht oft erst den Abbau von Vorurteilen und das gegenseitige Verständnis. Darüber hinaus kann das Erlernen gewisser Dienstleistungen bei alten und kranken Menschen, in Kindergärten und Säuglingsheimen, in Haushalten und in der Landwirtschaft dem Mädchen helfen, den Anforderungen des späteren Lebens besser gewachsen zu sein.
Jungen Menschen den Dienst am Mitmenschen zu ermöglichen, überlasteten Helfern die Arbeit zu erleichtern, Kindern, Kranken und alten Menschen, kinderreichen Müttern und Bäuerinnen zu helfen — es wäre wahrhaft Grund genug, um ernsthaft an den Start eines freiwilligen Sozialjahres zu denken. Ob der Versuch erfolgreich sein wird? Es kommt auf den Versuch an.
Zweifellos würde die FPO als Lohn für treue Gleisner-Dienste manche Konzessionen erhallen, sowohl im Land wie möglicherweise auch auf der Bundesebene. In Kreisen der Bundesregierung diskutiert man immerhin schon den Plan einer künftigen kleinen Koalition ÖVP—FPO. Vielleicht sind Insgeheim schon Vorentscheidungen gefallen.
Die SPÖ braucht sich dann propagandistisch gar nicht mehr allzu wild anzustrengen. Jede Annäherung an die FPÖ schadet der Volkspartei bei ihren Kernschichten, insbesondere bei betont österreichisch gesinnten ÖVP-Wählern am linken Flügel der Partei, die seit eh und je der „nationalen“ FPÖ mit schärfster Ablehnung begegnen. Sehr leicht könnte es dann der SPÖ gelingen, die ÖVP als rechtskonservative, ja reaktionäre Unternehmer- und Agrarierpartei abzustempeln. Verleumdung? Nicht mehr Verleumdung als die ÖVP-Kampagne gegen die Sozialisten anno 1966.
Es hängt natürlich nicht nur von der SPÖ ab, ob die Rechnung autgeht. Auch verläuft die Entwicklung in der Politik nicht geradlinig. Aber erstmals seit Jahren ist ein strategisches Konzept der SPÖ erkennbar,
das für die Volkspartei eine tödliche Gefahr bilden könnte. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie die ÖVP darauf reagiert, und ob sie überhaupt auf diese Gefahr reagiert. Mit einer Kopfjägerei in den eigenen Reihen ist es nicht getan. Darin kann sich das „Die-Konsequenzen-Ziehen“, von dem In der ÖVP nun immer häufiger die Rede ist, nicht erschöpfen. Was der Volkspartei derzeit fehlt, ist das gewisse ÖVP-Bewufjf-sein. Jeder Bund will nur Bund sein, jede Gruppe nur Gruppe, niemand will offenbar mehr Partei sein.
Ja, es gibt einige Ausnahmen. Es gibt Leute in der ÖVP, die mahnen, die Partei müsse mehr sein, als ein „Inferessentenhaufen“, man müsse sich mehr auf das besinnen, was allen als Gedankengut gemeinsam ist, nämlich auf die Ideologie. Dieses Wort hat im bürgerlichen Bereich gewiß einen Klang. Aber noch hat niemand die Frage beantworten können, wie anders als mit Hilfe ideologischen Existenzminimums eine Massenpartei ihr Anhänger bei der Stange halfen könnte, wenn die Leuchtkraft der „Persönlichkeiten“ an der Spitze nachläßt. (V.: „Die einfache Rechnung“)
Geht ein Gespenst um in der Bundesrepublik — das Gespenst politischer Radikalisierung? Arbeiter schwingen auf der Straße neuerdings wieder rote Fahnen und singen die Internationale (wenigstens die erste Strophe); Studenten huldigen dem Mao- und Guevara-Kult. Am anderen Rand des politischen Spektrums macht die rechtsradikale NPD Adolf von Thaddens in den letzten Monaten so alarmierende Fortschritte, dafj man für 1969 mit ihrem Einzug in den Bonner Bundestag zu rechnen beginnt. Das alles geschieht, während in Bonn eine der stabilsten Regierungen Nachkriegsdeutschlands sitzt, das Kabineft der Großen Koalition
zwischen CDU/CSU und SPD, das sich im Parlament auf eine Neunzehntelmehrheit stützen kann. Geschieht es trotzdem oder am Ende gerade deswegen? ...
In den Reihen des sozialdemokratischen Fufjvolkes wächst das Murren über das Bündnis mit der Union ohnehin seit Monaten, und da bisher alle seit der Bildung des Kabinetts Kiesinger-Brandt durchgeführten Landtagswahlen für die Partei negativ und mindestens enttäuschend ausgingen, kann man die zunehmende Unruhe nachfühlen. Aurjen-und deutschlandpolitisch hat die grofje Koalition, aus welchen Gründen auch immer, keine sensationellen Fortschritte zu bieten, so dafj sich ihr Schicksal wesentlich im Bereich der Wirtschaffs-, Sozial- und Finanzpolitik entscheiden wird. Da die FDP ihre Oppositionsrolle auf diesen Gebieten (wie in der Notstandsdebatte) nur schwach und wenig glaubwürdig wahrnimmt, verlagert sich die Gegnerschaft in den außerparlamentarischen Raum, auf die Gewerkschaften, die Studenten und Intellektuellen, die Publizistik und die extremen Parteien links und rechts. Da kann es natürlich leicht zu Radikalisierungserscheinungen kommen.
Ihnen wäre durch mutige, konsequente Taten zu begegnen, durch ein dezidiert handelndes, nicht bloh nach
Popularität schielendes Regieren in Bonn. Es scheint sich aber die gegenläufige Tendenz durchzusetzen ...
(Peter Meiert „Radikalisierung in der Bundesrepublik?')
Die konfessionelle Mischehe dagegen ist in zahlreichen Ländern, darunter auch in Deutschland, ein brennendes Problem, das breite Volksschichten bewegt. Seine Behandlung ist in letzter Zeit nicht selten als „Testfall für die ökumenische Gesinnung der katholischen Kirche“ hingestellt worden. Mit einiger Hoffnung, wenn auch nicht mit allzu grofjen Erwartungen mag vor allem der direkt betroffene Personenkreis das Berafungsergebnis der Synode zu diesem Punkt erwartet haben. Wurde diese Hoffnung erfüllt?
Es fällt schwer, auf diese Frage mit Ja oder Nein zu antworten. Auf der einen Seite hat die Diskussion in der Synode deutlich gemacht, dafj die katholische Kirche im Grundsätzlichen nach wie vor unbeweglich bleibt. Auf der anderen Seite wurde das verstärkte Bemühen erkennbar, die kirchlichen Gesetze nicht abstrakt, sondern im Blick auf die Menschen anzuwenden, die von ihnen betroffen werden. Prinzipiell soll nach der Ansicht der Synode die Mischehe weiterhin weder erlaubt noch in ihrer nichtkanonischen Form gültig sein. Wer sie als Katholik trotzdem eingehen und wer sie vor einem nichtkatholischen Geistlichen schliefen will, braucht die Dispens (Ausnahmegenehmigung) der zuständigen kirchlichen Autoritäten, die von Garantien (Kautelen) abhängig gemacht wird. In der Gewährung solcher Ausnahmegenehmigungen soll allerdings — und das ist die positve Essenz der Synodalvorschläge an den Papst und die römische Kurie — in Zukunft großzügiger verfahren werden als bisher.
(Romanus: „Es lebe das Prinzip!')