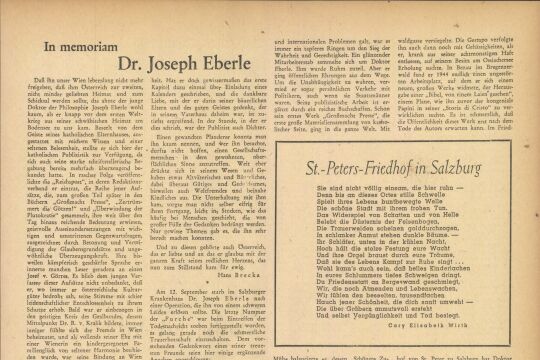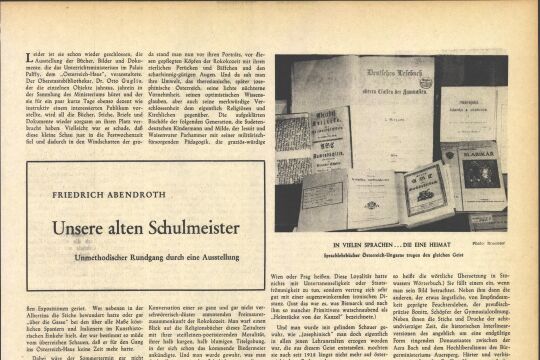„Die österreichische Furche“ beschließt im folgenden die Teilveröffentlichung der Erinnerungen ihres Herausgebers Doktor Friedrich Funder. In den letzten beiden Ausgaben schilderte der Verfasser seine Kindheit in der Steiermark und seine Schulzeit in Löbtau und Dresden. Es ijst in Österreich viel über den Wert der Knabenseminarerziehung als Vorstufe der theologischen Alumnate diskutiert worden. Diese Anstalten sammelten begabte junge Menschen, die zu jener Zeit vorwiegend aus der ländlichen Bevölkerung stammten, in ihren Räumen, behüteten sie vor schädlichen Einflüssen der Außenwelt, markierten schon frühzeitig die Bestimmung durch dunkle Kleidung und das anerzogene allgemeine Gehaben. Durch acht Jahre trennte die räumliche Distanz, nur durch die Som- derferįen unterbrochen, den jungen Menschen von den Gleichaltrigen in der großen Laienwelt und von dem normalen, gesellschaftlichen Leben in Stadt und Land. Ohne einen anderen Übergang trat der Neunzehnjährige in das Alumnat, wo sein Verkehrsraum nicht viel größer war als bisher. Die Menschenkenntnis, die Kunst des Umganges mit andersgearteten Und andersgerichteten Menschen, mit lauen oder bloßen Traditionschristen, mit gutwilligen Unwissenden, mit Heiden und Spöttern, mußte da von dem jungen Priester erst später mit der Seelsorgepraxis erworben werden. Viele haben den Lehrgang, den sie da zu durchschreiten hatten, in hartem Ringen glücklich bestanden. Nicht wenige haben die ganze Höhe nie erreicht und versanken in soziale Isolierung, zuweilen zu Sonderlingen geworden, einzelne gingen daran zugrunde, der Welt, die sie umringte, nicht gewachsen und von ihr überwältigt.
Aber diese Seminarerziehung hat im Durchschnitt der von ihr geleiteten Mittelschuljugend eine wissenschaftliche Ausbildung gegeben, die im Durchschnitt den Seminaristen vor seinen sonstigen Altersgenossen durch ihre Gründlichkeit und höhere Leistungsfähigkeit auszeichnete. Sie vermittelte dem Jüngling eine religiöse, sein Denken durchdringende Disziplin, die er, auf sich allein gestellt, selbst im Kreise einer katholischen Familie Schwer sich hätte aneignen können. Dem steigenden Personalbedürfnis der kirchlichen Organisation half das österreichische Knabenseminar ab, indem es die Wahl des geistlichen Berufes für saubere junge Menschen erleichterte und ungeeignete rechtzeitig erkannte und ausschied, Ausgezeichnete Männer, große Bischöfe, Seelsorger von bestem Format, priesterliche Gelehrte hohen Ranges, Schriftsteller und Dichter, Pädagogen, Männer der praktischen Sozialreform und auch der Staatskunst sind daraus hervorgegangen. Und noch mehr: als Stürme kamen, die Furchtsame um das Haus der Kirche in den österreichischen Aipenlän- dern zittern ließen, hielt dieser aus Seminarian hervorgegangene Klerus ehern stand. Wann hat je ein blutbesprengter Olberg weniger Iskariote gesehen?
Jede Zeit hat ihre besonderen Maßregelt und Einrichtungen. Knabensemi- narieij sind kein wesentlicher Bestandteil der fcirchlichen Organisation. Ob sie künftig immer notwendig sein werden? Im wilhelminischen Deutschland bestehen sie sdit langem nicht mehr. Aber dies ist keine Antwort auf die Frage. Wir leben in einer Zeit, die viele neue Erkenntnisse bringt, aber auch alte mit mächtigem Siegel bestätigt. Die Kirche wird daraus in Weisheit wählen.
Was waren das für prachtvolle Menschen, die ich in der dritten und viertenKlasse des Grazer fürstbischöflichen Knabenseminars zu Lehrern hattel Aus Latein und Griechisch Professoren, die später an die Hochschule berufen wurden, für Geschichte und Geographie den Fortsetzer der Weißschen Weltgeschichte Dr. Vockenhuber, für Deutsch den alten Spiritual der Anstalt, der vor Begeisterung über eine schöne Metapher Tränen vergießen konnte.
Dem Lehrkörper und den geistlichen Präfekten, denen in den Studiersälen je zwei Klassen unterstellt waren, war Direktor Dr. Stradner vorgesetzt, der — ein Mann mit einem goldenen Herzen — als Chef des Hauses schon deshalb unsere Ehrfurcht gewonnen hatte, weil er zauberisch schön lateinisch stenographieren konnte.
In der beim Geographieunterricht gepflegten Heimatkunde erlernten wir eine Bergkenntnis, der vom Semmering bis zur Silvretta die genaue Höhenbestimmung keiner nennenswerten Bergspitze, keines Passes und keines Saumweges entging. Die Naturfreude, die die Schilderungen des Geographielehrers erweckten, führte uns zu großen Ferienwanderungen in einer Zeit, wo das Wanderwesen erst gering entwickelt war. Schon in der ersten sommerlichen Vakanz nach der dritten Klasse unternahm ich mutterseelenallein mit kaum zwei Gulden im Sack von Kindberg aus eine Fußwanderung über den Gebirgsstock der Hohen Veitsch nach Mariazell. Der strömende Regen in den Bergen ließ keinen Faden trocken, der Nebel in den Wäldern erlaubte nur, die naßtriefenden nächsten Bäume zu erkennen. Der Hunger war bissig. Das alles kam nicht in Betracht. Nach geltender Scholarensitte durfte man mit dem Schulzeugnis in der Hand bei Pfarrherren und Stiften anklopfen, bekam Speis und Trank, vielleicht auch einNachtlager oder ein Viatikum. So hab auch ich es zuweilen, zwar etwas zaghaft, unternommen. In Mariazell stellte ich mich dem Herrn Prälaten vor und bekam einen Silberzwanziger, der zur Dek- kung des Nachtlagers in einem billigen, mit gutem Vorbedacht gewählten Wallfahrerquartier reichte. Das war zwar muffig, und die rotkarierten Bettüberzüge waren weit entfernt, ihren letzten Waschtag zu verraten, aber das Bett kostete nur zehn Kreuzer. Bei der Heimkehr blieben mir sogar ein paar Batzen von meinen zwei Gulden übrig.
Die folgenden Ferien der Mittelschule führten mich auf solchen Fußwanderungen weithin über Flur und Feld, über Almen und Gletscher, durch die alpenländischen Kronländer Österreichs, über die Grenzen Bayerns, der Schweiz und Italiens. Man lernte Land und Leute kennen, menschenfern im Hochgebirge Gefahren begegnen und stählte Körper und Geist. Die Studen- tenherbergen, die damals der Deutschösterreichische Alpenverein zu organisieren begann, erleichterten diese Wanderschaft. Es geschah, daß eine freundliche Wirtin den jugendlichen Gästen, die von einem Marsch über Fels und Eis in den Hohen Tauern mit talergroßen Löchern in den Schuhen ins Drautal nach Greiffenburg herabgestiegen kamen, die gefährlich hohe Zeche erließ und die Kellnerin bedeutete: »Buben, küßt der Frau Wirtin die Hand, von Leuten, die so zerrissene Schuh haben, nimmt sie nichts!“ Oder daß Fürstbischof Dr. Kahn die beiden Studentlein in den schäbigen Röckeln und den zerrissenen Schuhen bei ihrer Vorstellung in seinem Klagenfurter Palais an seinem Tische speisen und in schönen, alten Gemächern eine Woche lang beherbergen ließ. Der Seminardirektor sah die Wanderlust seiner Jugend gern. Mehr als einmal rief er mich am Ende des Schuljahrs: »Schlankei, da hast ein Zehrgeldfür eine Reis" und drückte mir ein paar Banknoten in die Hand, die mich finanzieller Reisesorgen bei bescheidenen Ansprüchen überhoben. Sither war ich nicht der einzige, dem es so erging.
Die Klassen des Obergymnasiums hatten zu jener Zeit die Zöglinge des Knabenseminars an dem öffentlichen Staatsgymnasium zu besuchen. Für die „Fünfte" geschah dies an dem Ersten Staatsgymnasium, das sein Direktor, der bei Lehrern und Schülern in hohem Ansehen stehende Zisterzienserpater vom Stift Hohenfürst, Pater Dr. Maurer, im Geiste humanistischer Überlieferung leitete. Das Gymnasium war von den Söhnen des steirischen Hochadels mit Vorzug frequentiert. Ich bin den ehemaligen Kollegen später in ihren Stellungen als Diplomaten und Ministerialbeamte und auch in der Literatur begegnet. Der Geschichtsunterricht an dieser Anstalt war eigenartig. Er lehrte uns die Welt und das Völkerschicksal an Charakterbildern studieren, den Menschen, seine Begabungen, seine Leidenschaften al« Former von Glück und Leid für die Gemeinschaft erkennen. Die Jahrhunderte, die da vor uns aufstanden, waren von brausendem Leben erfüllt. Daß wir daraus in die staubige Schulstube zurückfanden, dafür sorgte der Professor für das Griechische, der als Verfasser einer griechischen Grammatik uns beinahe beigebracht hätte, daß die Sprache des Thukydides und Sophokles eine wasserlose Wüste sei, in der normale Menschen verdursten müßten. In heimlicher Liebe bin ich aber trotzdem mit Odysseus über das Meer gezogen, und es fiel mir leicht, aus Herodot die beste Maturaarbeit der Klasse zu schreiben.
Vielleicht hat es in meine Lebensgestaltung eingewirkt, daß wir als Professor für deutsche Sprache am II. Staatsgymnasium in Prof. Dr. Reis einen Lehrer erhielten, der uns junge Leute zu schlichter Satzbildung zwang. Der nüchterne Vorarlberger trieb uns die lateinischen Konstruktionen in deutschen Aufsätzen gründlich aus. Es tat not. In Dresden war es eine Art Fleißaufgabe gewesen, korrekt einen möglichst langen Satz aufzubauen. Ich hatte es glücklich nach besten lateinischen Vorbildern auf 49 Nebensätze eines einzigen Hauptsatzes gebracht. Diesem Satzungeheuer war aber doch noch ein anderer um eine Pferdelänge vorausgekommen. Er hatte zu meinem Schmerz, erinnere ich mich recht, sechs Nebensätze mehr.
Das österreichische Gymnasium verlangte damals ernstes Studium. Es gab ein gründliches Wissen mit und hielt uns doch von Uberbürdung frei. Wer haus- hielt mit seiner Zeit, hatte genügend Raum für Privatlektüre, Spiel und Sport.
Bei mir krümmte sich der Haken früh. In der fünften Klasse wurde ich Mitgründer der literarischen Gesellschaft „Der Eichenbund“. Sie war geheim und durfte statutengemäß nur aus fünf Mitgliedern bestehen. Wir sind unser aber nur drei geblieben: der Seminarist aus der „Sechsten“, Karl Reitterer, und wir zwei aus der »Fünften“: mein erster Wandergenosse Karl Mayerhofer und ich. Den vierten oder fünften Würdigen fanden wir nicht. Aufgabe der Gesellschaft war unsere literarische Bildung. Wir schrieben deshalb lange Aufsätze, die wir einander zu lesen gaben. Diese Aufsätze waren sehr gelehrt und geschwollen. Die beiden Leser waren zum Unterschied vom jeweiligen Verfasser der Meinung, daß sie auch langweilig seien, überdies fehlte das Salz einer Kritik, denn seine wahre Mei-nung wagte doch keiner der Eichenbünd- ler dem Verfasser zu sagen. An den Wirkungen der langen Aufsätze ging der Eichenbund noch im Gründungsjahre ein.
Dennoch ist Karl Reitterer ein militanter Schriftsteller geworden, der als Führer des Landbundes in Südböhmen die Wochenschrift „Der Landbote“ herausgab und meinen dortigen politischen Freunden viel zu schaffen gab. Auf verschiedenen Wegen gehend, haben wir uns in Briefen zuweilen noch kameradschaftlich getroffen. Am 24. Oktober 1917, zu Beginn der zwölften Isonzoschlacht, traf ich ihn als Stationskommandanten zu Kronberg in Kärnten am Fuße der neuerbauten Erzherzog - Eugen - Hochgebirgsstraße nach Flitsch.
Aus der Art schlug der dritte, Karl Mayerhofer, der nicht Schriftsteller oder Redakteur, sondern ein großer, vielgesuchter Zahnarzt in Wien wurde, eine kinderreiche Familie begründete, schon ein hoher Fünfziger, mit kirchlichen Dispensen in die Gesellschaft vom Göttlichen Wort eintrat, zuerst als Arzt im Fernen Osten und kurz vor seinem Tode in Rom das Priestertum erreichte. Aus Sturm und Drang sich befreiend, war er einen ungewöhnlichen Lebensweg gegangen.
Nach dem Ende des Eichenbundes startete im Studiersaal der „Fünften" des Knabenseminars eine Klassenzeitung. Es war mir gelungen, die führenden Köpfe der Klasse von deren Notwendigkeit zu überzeugen. In das Redaktionskomitee wurden von der Klasse deren anerkannter Primus, der fröhliche Franz Puchas, Johann Seidl, der eine schöne Schrift und eine polemische Ader hatte, und der Antragsteller Friedrich Funder gewählt. Die Zeitung sollte Aufsätze, Gedichte, polemische Auseinandersetzungen über sachliche Streitfragen, die uns Jungen beschäftigten, aktuelle Notizen und Witze enthalten. Es durfte nichts Abgeschriebenes sein. Nach Überwindung großer Schwierigkeiten, welche die Titelwahl verursachte, wurde auf meinen Vorschlag mit Stimmenmehrheit der nicht allzu bescheidene Name „Walhalla" gewählt. Das Blatt erschien bis zur achten Klasse während des Schuljahres in der Regel jeden zweiten Sonntag. Einzelne Nummern gediehen gut, andere waren öde. Man lernte an dem Benützen der verschiedenen Federn das Abwägen des geschriebenen Wortes, die stilistische Eigenart verschiedener Temperamente, man machte Gehversuche in heiterer und satirischer Polemik. Die Zeitungsauflage bestand in einem sauber geschriebenen Exemplar. Den größten Teil des Inhaltes hatten die Mitglieder des Redaktionsstabes zu. bestreiten. Sozusagen den Satz und Druck hatten pflichtgemäß die besten Kalligraphen der Klasse zu besorgen, soweit die Autoren selber dafür nicht taugten. Als ich sechs Jahre später eine 'streitbare Auseinandersetzung für eine wirkliche Zeitung schrieb, urteilte beifällig der Chefredakteur: „Sie haben eine starke polemische Ader!" Und ich hatte doch nur geübt, was ich in der „Walhalla" gelernt hatte. Die Seminarvorgesetzten ließen uns mit freundlicher Dtildung gewähren.
Der liebe Gott hat uns drei vom Redaktionskomitee der „Walhalla“ beim Wort genommen. Johann Seidl wurde während seiner priesterlichen Laufbahn der Verfasser einer Reihe ausgezeichneter Volksaufklärungsschriften, Dr. Franz Puchas der Leiter des „Sonntagsboten', jenes Wochenblattes, das sich in der steirischen Bauernschaft durch Jahrzehnte einer sehr großen Auflage und Volkstümlichkeit erfreute. Der verdiente Publizist wurde dann vom katholischen Presse- Verein für Steiermark als Generaldirektor an die Spitze des großen katholischen Verlagshauses „Styria" berufen, in dem auch das katholische Tagblatt „Grazer Volksblatt" herauskam. Erst als Propst des Grazer Domkapitels, schon Mitte der Sechziger, nahm Dr. Puchas vom Verlagsund Zeitungswesen Abschied.
In der sechsten Gymnasialklasse wagte ich mich ins Dramatische vor. Ich hatte zwar mit Ausnahme der Königlichen Oper in Dresden, in der man an jenem Abend die „Königin von Saba“ gab, noch nie ein wirkliches Theater von innen gesehen, hatte von Bünenerfordernis und Bühnenwirkung nicht mehr Ahnung, als ich aus Lessings „Hamburgischer Dramaturgie“ wußte. Aber man riskiert es eben. Der Faschingssonntag war im Seminar zu allerhand Scherz freigegeben. Für ihn schrieb ich eine Posse „Der Teufelstod“, eine Episode aus meiner frühesten Jugend mußte als Stoff herhalten. In einer Grazer Vorstadt war einem Tierliebhaber ein Affe entsprungen. Zur Osterzeit war das Tier in eine mit Eiern, Schinken und Süßigkeiten wohlgefüllte bäuerliche Vorratskammer eingedrungen und wurde dort zum Schreck der Bewohner entdeckt. Der Gemeinderat des Dorfes versammelte sich in der Schenke, um Kriegsrat gegen das zähnefletschende, unheimliche Wesen zu halten.
Vergeblich aufgeklärt durch einen spleenigen Naturforscher, der den aufgeregten Dörflern darwinistische Ideen vortrug, beschloß der Gemeinderat, den verheerend unter den österlichen Leckerbissen hausenden Feind, der gewiß der Teufel sei, zu erschießen. Die Schlußszene hatte die Befreiungsfreude des Dorfes und den Jammer des gelehrten darwini- stischen Steckenreiters zu schildern. Der Musiklehrer des Instituts, der als Komponist bewährte Prof. Dr. Faist, schrieb die Musik zu den eingestreuten Liedern. Kameraden verschiedener Klassen übernahmen die Rollen. Im Festsaal war eine Bühne vorhanden, die bisher nur selten verwendet worden war. Die paar bescheidenen Kulissen genügten, die Kostüme bereiteten keine Schwierigkeiten. Das Spiel hatte die Lehrer, Präfekten und
Schüler aller Klassen als Publikum. Es gab große Heiterkeit. Die Zuschauer waren noch anspruchsloser als das Stück. In meiner Rolle als behäbiger Vorsitzender des Gemeinderates ersah ich von der Bühne herab plötzlich etwas, was mich erstarren ließ vor Staunen: da unten in der ersten Reihe saß einer, der sich die Seiten hielt vor Lachen. Und dieser höchst belustigte Zuschauer war niemand anderer als der Naturgeschichtsprofessor der Anstalt, den ich in unserer Posse zur Zielscheibe loser Anspielungen gemacht hatte. Ich hatte ihn nicht gemocht, seitdem er mir in der fünften Klasse eine Ungezogenheit mit einer Anzeige beim Direktor vergolten und ein paar grimmige Tachteln von meinem Vater eingewirtschaftet hatte. Dieser Semi-Darwinist mit seinen hausbekannten Abstammungstheorien war gerade der Rechte für eine Karikatur in diesem Faschingsspiel. Und nun saß das Opfer dieses Streiches und lachte Tränen. Da überkam mich denn doch ein Schämen vor so viel Duldsamkeit und gutem Humor und ich schämte mich noch viel mehr, als von jenem Tage an mir der hochwürdige Herr Professor dauernd eine freundliche Gesinnung zuwandte und Böses mit einem großherzigen Maß Güte vergalt. Der politische Journalist hat im Gefecht zuweilen die Satire anzuwenden — einem zweiten Professor Dr. Eigl bin ich leider nicht mehr begegnet.
Die Aufnahme, die der „Teufelstod gefunden hatte, ermutigte mich in der siebenten Klasse zu einem Ritterdrama „Die Letzten von Stattegg". Zeit: die Schlacht auf dem Marchfeld, Ort der Handlung: die Umgebung von Graz. Unser Präfekt Dr. Schellauf, der nachmalige gelehrte Propst der Grazer Stadtpfarrkirche, wurde zum Regisseur. Der Zeichenlehrer Ritter Kurtz von Goldenstein malte die Kulissen, Kostüme wurden von der Anstalt bestell^ Professor Faist komponierte die Musik zu mehreren Liedern, Es ging hoch her in den Vorbereitungen. Zur Aufführung waren vornehme Freunde der Anstalt geladen. Der Chefredakteur des „Grazer Volksblattes“, Msgr. Dr. Zaple- tal, war in eigener Person erschienen. Für reichlichen Beifall sorgten schon die Kameraden vom Seminar. Die Aufführung brachte mir von selten des Direktors Dr. Stradner als „Dichtersold , wie er sagte, eine große Schaumtorte und im katholischen Tagblatt Steiermarks eine spaltenlange Rezension ein. Der Kritiker nahm den Versuch ernst, bemängelte und lobte. Daß unser Deutschprofessor am Staatsgymnasium, Dr. Reis, ein paar Tage darauf das Stück zu lesen wünschte, schien mir die Krone zu sein. Der erfahrene Lehrer verabreichte mir eine gesunde Medizin, Er ließ mich zwei Monate lang auf sein Urteil warten. Da fing man an, zu begreifen, daß es gut sei, sich aus den dichterischen Sphären eines Septimaners zur Wirklichkeit zurückzufinden und zu verstehen,'daß man noch viel zu lernen habe. Zwar stimmten die fünffüßigen Jamben, und die Monologe, in denen sich die Ritter ergingen, waren gesättigt von Weisheitssprüchen, bestimmt, von künftigen Mittelschülern auswendiggelernt zu werden. Zwar sprachen die Helden viel von ihrer gegenseitigen Tapferkeit und ihren einstigen Ruhmestaten, man sah nur nichts dergleichen. Zwar kam die romantische Handlung zu einem feierlichen Finale, aber bei Licht besehen waren die Menschen, die da mit Schwert und Brünne heroisch oder in einem finsteren Kerker als Verbrecher greulich taten, aus Weltunkenntnis und jugendlichem Überschwang geborene unwirkliche Geschöpfe. „Die notwendige Lebenserfahrung wird schon kommen", verhieß mir Dr. Reis.
Es war eine weise Einrichtung des alten Gymnasiums, daß es dem Mittelschüler nicht erlaubt war, unter seinem Namen in Zeitungen und Zeitschriften Beiträge zu veröffentlichen. Doch durfte ich weiterhin in der siebenten und achten Gymnasialklasse dem Zug zum Literarischen anonym als „Friedrich Günther folgen. Der „Wahrheitsfreund", die älteste, noch von 1848 (dem ersten Jahr der Pressefreiheit) her stammende katholische Wochenschrift Österreichs, der damals noch in Graz erschien, veröffentlichte unter diesem Namen Gedichte, der „St.-Josefs-Kalender" aus dem Verlag „Styria“ eine Erzählung. Wichtiger war es, daß ich vom „Literarischen Anzeiger“, der im gleichen Verlag herauskam, zur Literaturkritik herangezogen wurde. Mein ehemaliger Seminarlehrer Prof. Dr. Gutjahr hatte als Leiter des Blattes den Mut, mich zu einigen Proben und dann meine ständige Mitarbeit zuzulassen. Es ist zu erwägen, daß es ein Seminarzögling war, ein Mittelschüler vor der Reifeprüfung, der sich an wechselnden Aufgaben versuchen durfte, dem man eine Bühne — und wenn es auch nur eine Institutsbühne war — zur Verfügung gestellt und die Kosten der Bühnenausstattung wortlos gewährt hatte. Man erlaubte ihm den Verkehr mit Redaktionen und half in seiner Ausbildung mit, obwohl sie vielleicht abseits von den Aufgaben eines Diözesanknabenseminars und der Vorbereitung zum Theologiestüdium führen konnte. So verstanden diese priesterlichen Erzieher ihrAmt. Enge und ungesunde Weltferne der Seminarien? Wenn ich Bischof wäre und hätte in der Diözese kein Knabenseminar, ich würde eines gründen, so wie es das meine war.
In die Zeit der letzten Gymnasialjahre fielen für meine Kameraden und mich die ersten starken Eindrücke aus dem öffentlichen Leben der heimatlichen Umgebung. Vor allem beschäftigten uns, je mehr wir uns der Universität näherten, die Vorgänge an den Grazer Hohen Schulen. Die deutschen Universitäten in Österreich waren von einer krankhaften Unruhe befallen. Ein großer Teil der deutschen studierenden Jugend war in eine geistige Krise geraten. Die Ursachen waren ebenso ernst, wie die hervorgerufenen Erscheinungen gefährlich waren. Die ersteren lagen auf nationalpolitischem Gebiet.
Die hier hereinspielenden Probleme Altösterreichs waren kompliziert und stehen von dem Heute anscheinend weit ab. Dennoch umschlossen sie die Wurzel von Erscheinungen, die durch vjele Jahrzehnte das politische Raisonnement unter den Deutschen Österreichs verwirrten, eine dem Gesamtwohl förderliche Auseinandersetzung über die existentiellen Zukunftsfragen im Staate behinderten und einen nicht geringen Teil der intellektuellen jungen Generation auf Abwege brachten. Ohne die psychologische Analyse des Geschehens kann man kaum verstehep, wie es geschah, daß soviel Idealismus, soviel Energien zum Schaden des deutschen Volkes in Österreich und des Gesamtstaates mißleitet und in einem hochgezüchteten Chauvinismus einem unheilvollen Ende zugetrieben werden konnten.
Nur eine kleine Minderheit war es gewesen, die sich zur. Zeit der ersten österreichischen Verfassungsversuche in den Fünfzigerjahren des 19. Jahrhunderts aus dem traditionellen nationalen Denken des österreichischen Deutschen losgelöst hatte, losgelöst von dem großdeutschen Konzept eines unter österreichisch-habsburgischer Führung stehenden Gesamtdeutschland, und einem neuen Deutschland unter dem Primat Preußens zustrebte, zu dem in irgendeiner Gestalt die deutschsprachigen Gebiete Österreichs angegliedert sein würden, über eine schmale bürgerliche Schichte der Intelligenzberufe reichte die Anhängerschaft dieser „Kl ein deutsch en Lösung“ nicht hinaus. Bei der Rückkehr Kaiser Franz Josephs vom Frankfurter Fürstentag hatten ihn noch Wiener Burschenschaften „in voller Wichs“ begrüßt.
Ein anonymer, angeblicher Deutschösterreicher schrieb im Sinne der kleindeutschen Auffassung in seiner 1871 bei Otto Wigand, Leipzig, erschienenen Broschüre „Das Deutschtum in Österreich":
„Neben dem auf österreichischen Grundlagen begründeten deutschen Bewußtsein entstand aber auch schon in dieser Zeit (vor 1866) teils in einzelnen Individuen, teils in Gesellschaften, die behufs Besprechungen der politischen Ereignisse sich zusammenfanden, jene echt nationale Gesinnung, die mit Hintansetzung aller Sym- und Antipathien in Preußen den berufenen Leiter Deutschlands erkannte. In vielen Fällen waren es Norddeutsche, die über die norddeutschen und speziell die preußischen Verhältnisse berichteten und belehrten, und so die Anregung zur Annahme des (kleindeutschen, der Verf.) Gothaer Programms gaben… Meistens trafen sie nur auf Spott und Schmähung, welche sich aber binnen kurzem in laute Bewunderung der Voraussicht derselben verkehrten, als die Ereignisse des Jahres 1866 alle die Hoffnungen erfüllten, die jene auf Preußen gesetzt hatten.“
In der Tat bedeutete 1866 für Österreich eine Umwälzung tragischen Ausmaßes. Der alte Kaiserstaat hatte nicht nur einen blutigen Krieg und seine Stellung im Deutschen Bunde und in Italien verloren, sondern auch seine Funktion als die mitteleuropäische Vormacht, die in gleicher Weise dem Westen wie dem Südosten durch ihre Geschichte, ihre Kultur, ihren Organismus und durch ihre wirtschaftlichen Verflechtungen zugewandt war. Mit einem Schlage waren zu gleicher Zeit neun Millionen Deutsche aus der bisherigen Verbindung mit der stammverwandten deutschen Volksmasse staatsrechtlich herausgefallen, auf eine andere politische Lebensform gewiesen, aus der bisherigen großdeutschen Staatsaufgabe entlassen, damit aber audi anscheinend ärmer geworden an der Staatsidee, die ein Volk zur Entfaltung seiner seelischen Kräfte im Dienste der Gemeinschaft braucht. Und diese neun Millionen waren ja doch bisher das führende Staatsvolk Österreichs gewesen, dazu berufen durch Begabung und eine historische Rolle, die große Verdienste bezeugte.
Diesem Jahre 1866 folgte dann der große deutsche Sieg gegen Frankreich, der einen Aufstieg Preußen-Deutschlands einleitete, dem ein Staatsmann von der Größe Bismarcks noch höheren Glanz verlieh.
Wo war der Mann, der in dieser Lage mit Riesenkräften das Steuer des Habs- burg^rreičhes in neue Bahnen lenkte, einem großen, neuen Ziel entgegen, an dem sich Hoffnung und Mut nach Niederlagen und schwersten Verlusten, Zuversicht, Heimatstolz und Vaterlandsliebe entzünden konnten? Das Beste, das die neue Wirklichkeit zunächst zuließ, war das Unternehmen, nach dem Erlittenen die ipnere Befriedung in der Monarchie herzustellen und mit gesammelten Kräften der neuen Situation zu begegnen. Das geschah durch das österreichische Verfassungswerk und die Schaffung der dualistischen Verfassung für das Gesamtreich. Das Geschehene war für das Reich eine Notlösung, der Dualismus unzureichend, stellenweise zweideutig, einer langen Dauer nicht gewachsen; aber diese Lösung ließ den Deutschen in Österreich eine bedeutende politische Mission, die, wohlverstanden, ihre Träger mit dem befriedigenden Bewußtsein einer großen Verantwortung vor dem eigenen
Staate begaben und auch noch bei der staatsrechtlichen Trennung von Deutschland mit einer Aufgabe zum Nutzen des deutschen Gesamtvolkes und des europäischen Friedens betrauen konnte. Niemand anderer als Bismarck war es, der den Deutschen in Österreich nicht nur im Berliner Vertrag und durch das internationale Mandat für Bosnien-Herzegowina, sondern in wiederholten eindeutigen Ratschlägen an seine österreichischer! Verehrer auf den Weg hinwies, der in die Zukunft Österreichs führte. Immer noch war dem Donaureiche eine große europäische Aufgabe im Nahen Osteji gestellt, ihr gemäß waren zunächst im Inneren des Reiches alle Hindernisse abzubauen, die einer organischen Neuordnung für die von der Monarchie umschlossenen kleinen Völker entgegenstanden, eine Neuordnung, die beispielhaft die friedsame Neueinrichtung des Balkans vorbereiten konnte.
An dem Auftrag, der hier einer großen, in der Staatsführung' stehenden Partei zukam, scheiterte die Partei des deutschen Liberalismus der siebziger Jahre, die lange allmächtige, die seit dem Beginn, der Verfassungsära Österreich tüchtige Kräfte gegeben hatte. Es scheiterte aber an dem Auftrag auch die vom deutschen Liberalismus geschaffene Staatsschule, ein schwungloses, blutleeres Geschöpf, das gerade noch die Jugend zu einer kantonalen Heimatliebe erzog, jedoch nicht imstande war, ihr ein österreichisches Staatsbewußtsein einzupflanzen, das mutig den großen Veränderungen im Bilde Europas und der eigenen Gemeinschaft gegenübertrat. Aus einer weitverbreiteten lauen Atmosphäre dieses färb- und lustlosen Erziehungssystems ging ein müdes, resigniertes Osterreicher- tum hervor, soweit nicht der Geist der Familie, die Persönlichkeit tüchtiger Pädagogen, das Milieu des kaiserlichen Wien, die Schulautonomie einzelner Bundesländer, namentlich Tirols und Vorarlbergs, dagegen immunisierten. Aber das Gesamtergebnis wurde dadurch nicht wesentlich geändert. — Da konnte es kaum ausbleiben, daß regsame Elemente der heranwachsenden Generation von den Eindrücken gefangengenommen, wurden, die von dem jungen, aufblühenden Deutschen Reich ausgingen und Phantasie und Idealismus einer begeisterungsfähigen akademischen Jugend gefangennahmen.
Bis zum ersten Weltkrieg machte sich an vielen staatlichen deutschen Mittelschulen eine Geheimbündelei breit, die, schon in der Altersstufe der Vierzehn-, Fünfzehnjährigen beginnend, den Idealismus der jungen Menschen auf ein verherrlichtes Preußen-Deutschland richtete. Diese Bünde, „Pennalien“, waren in ihrem Aufbau den Burschenschaften und Verbindungen der Hochschüler nachgeahmt und imitierten auch deren Trinksitten und politisches Gehaben. Das sogenannte „Schönerianertum“, nach dem Führer der alldeutschen Richtung Georg Schönerer genannt, war seit Mitte der achtziger Jahre an den meisten Mittelund Hochschulen im Flor. Man trug als Abzeichen die Kornblume, die Lieblingsblume Bismarcks, im Knopfloch und womöglich Bismarcks Konterfei verstohlen — solang man an der Mittelschule war — an der Uhrkette und sang auf den Kneipen die „Wacht am Rhein". Die Geheimbünde waren in den Schulordnungen streng verpönt, wo sie entdeckt wurden, regnete es strenge Strafen. Es gehörte eine nicht allzu große Zahl von Schülern diesen Bünden an, aber sie genügte, die Klassen stimmungsmäßig zu durchsetzen. Selbst einzelne von katholischen Orden geleitete Privatgymnasien waren von solchen Einflüssen nicht ganz frei. An der Hochschule trat man dann einer Burschenschaft, einer Landsmannschaft, einem Verein bei, die einwandfrei durch ihre Richtung und ihre öffentlich getragenen Abzeichen und Farben ihre alldeutsche Gesinnung bekundeten.
Die steirische Hauptstadt, nahe der Sprachgrenze und ihren unfriedlichen Geräuschen, hat immer zu quecksilbriger Unruhe geneigt. Um den Beginn der neunziger Jahre stand Graz im Zeichen heftiger Auseinandersetzungen der auf dem Boden des österreichischen Staatsgedankens verbliebenen Deutschnationalen mit den alldeutschen Schwarmgeistern. Daß am 30. Jänner 1889 der Verein der Deutschnationalen an den kaiserlichen Statthalter Freiherrn von Kübeck aus Anlaß des Todes des Kronprinzen Erzherzog Rudolf eine Beileidskundgebung gesandt und dann in seiner Jahresversammlung „des verstorbenen Kronprinzen mit warmen Worten gedacht" hatte, wie es in dem Zeitungsbericht hieß, hatte um den Verein einen leidenschaftlichen Bürgerkrieg zwischen Deutschnationalen und unbedingten „Schönerianern“ entfacht. Der tonangebende Teil der studierenden Jugend, die „Inkorporierten“, standen auf der Seite der Radikalen. Uns „Kameraden" aus dem Knabenseminar schützte gegen diese Strömungen eine vernünftige Erziehung und mit zunehmendem Alter die weltanschauliche Festigung. Von unseren Institutsvorgesetzten hörten wir nie ein Wort über Politik und Parteitreiben. Wir konnten ungezwungene Beobachter sein. Da war viel, das uns zu denken gab.
Im Frühsommer 1892 kam der Abschied vom Gymnasium und dem Knabenseminar, das uns Heim und zweites Vaterhaus gewesen war. Auf die Reifeprüfung hatte man sich ein Jahr lang in strenger Arbeit vorzubereiten gehabt. Man trat an sie heran mit der frohen Neugierde des Fußballspielers, der vor einem großen Wettkampf ein hartes Training hinter sich hat. Der Abschied von den liebgewordenen Menschen und Räumen ging nahe. Die Dankbarkeit kann man guten Lehrern und Erziehern nie voll abstatten.
Als wir Seminaristen des Maturajahrganges 1892 a.us der Mittelschule hinaustraten, wußte ein jeder von uns, daß ihn da draußen in der Welt kein leichtes Schicksal erwarte. Kämpfe? Ich freute mich dessen, obwohl ich Theologe werden sollte.