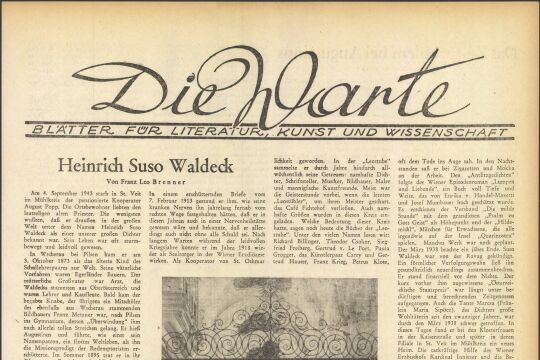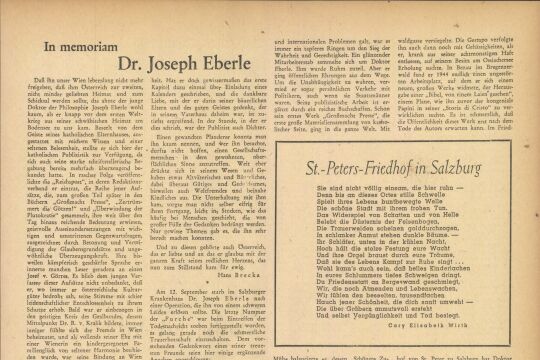1926 schrieb ich noch immer an meinem Roman. Ein dickgeratener Band, „Johannes oder die Genesung“, war fertig. Ein wildes, expressives Malerbuch in Ich-Form. So wild, daß ein jüngerer Lektor eines großen, deutschen Verlages, den jemand auf meinen Roman gehetzt hatte, schockiert, ja entsetzt war und so etwas wie einen getarnten Anarchisten als Autor vermutete. Die gängigste Literatur wollte weder vom Expressionismus noch von sozialen Problemen wissen. Ich war aber nicht mit dem Krieg fertig geworden und steckte mitten in „Elegie der Gemeinschaft“, einem Zyklus von Gedichten, in denen ich damals alles einfangen wollte, was mich erregte, beflügelte, empörte, erschütterte, in Glut und Wut hielt. Nicht die kleine „große“ Politik der Parteien, nicht einmal der hinter allem schwelende Kulturkampf — es war die hohe Zeit der Freidenker und der Kirchenaustritte, die Zeit, in der alles, was uns das 19. Jahrhundert an primitivstem Positivismus beschert hat, als höchster Fortschritt gepriesen wurde — das andere Leben war e, die Pflicht, man selber zu sein und doch in der Gemeinschaft zu stehen. Pflicht gegen Pflicht, die Unfähigkeit, mich ganz für eine Seite zu entscheiden, für den nackten Egoismus des Ichselberseins oder die rauschhafte Hingabe an die Masse. Was vor meinen Augen geschah, war ja zumeist getarnte Demagogie. Ein grausiges Spiel zwischen Diktatur und Diktatur. Damals begann es. Denen der rote Terror recht war, mußten die Frontkämpferaufmärsche und Schießereien billig sein. Eine komische Meinung, solange man nicht überzeugt ist, daß der rote Terror auf jeden Fall als „fortschrittlich“ zu entschuldigen, auch zu billigen sei. Wo aber war der „Fortschritt“? Damals begann die Entwicklung zur Katastrophe 1934. Mit Waffenlagern, Sprengröhren, Bunkern und Exerzierübungen, mit reaktionären und fortschrittlichen Uniformen. Ich war zu gut informiert, als daß ich nicht vor den kommenden Dingen gezittert hätte. Schrecklich aber war, daß eine große Idee, der Neubau der Gesellschaft, der wahre Sozialismus, daß das alles von ehrgeizigen Demagogen zerstört wurde, ehe es noch über die ersten Ansätze hinauskam.
Ein öffentliches Abrücken von den Brandstiftern am 15. Juli 1927, von Grundbuchzerstörern, Plünderern und kommunistischen Rowdies und Drahtziehern, hätte mehr eingerenkt als die Spannung zwischen Polizei und Arbeitern, Seipel und Otto Bauer, Austerlitz und Funder. Der Weg über sinnlos geopferte Menschen zum Ausbau der militärischen Positionen und damit zum Bürgerkrieg war nun frei.
Vielleicht waren Verse aus Angst und Trauer, Wut und Jubel, das große Mitschwingen mit einem Arbeiteraufmarsch und die Verzweiflung darüber, daß auch die echten, die berechtigten Forderungen einer neuen „Klasse“ an demagogischen Funktionären scheitern sollten, für jene verboten, die im Grunde nur ihre eigene, höchstpersönliche Vollendung suchen. Für mich war diese Auseinandersetzung das zentrale Erlebnis. Tage .und Jahre hindurch.
Die „Elegie der Gemeinschaft“ steht im Mittelpunkt meines ersten Gedichtbandes, „Unter Brüdern und Bäumen“. Er erschien am 24. Dezember 1928, 11 Uhr vormittags bei Robert Haas in seiner kleinen, aber graphisch ausgezelcn-neten „Officina Vindobonensis“ nach den „Antlitzgedichten“ von Heinrich Suso Waldeck und dem ersten Gedichtband von Otto Stoessl, „Antike Motive“. Robert Haas war „offizieller“ Verleger der „Leostube“. Doch über die Gedichte Suso Waldecks und meinen Band hinaus gedieh nicht sehr viel. Immerhin machten diese Gedichtbände Furore. Heinrieh Suso Waldeck war mit den „Antlitzgedichten“ sogleich in die erste Reihe der Lyriker deutscher Sprache vorgerückt. Ob der um 15 Jahre jüngere, aber durch seine Gedichte und seinen freiwilligen Tod im Feldlazarett berühmtere Trakl auf ihn gewirkt hat, oder ob beide die gleiche Melodie in sich getragen haben? Andere Ähnlichkeiten gibt es kaum. Auch in dem Zyklus „Das böse Dorf“ war Suso Waldeck immer noch und erst recht Priester, und weit weg von jedem kultivierten Verfall. Keiner von den „Priesterpoeten“, die auf Bergen und Burgen die Leier zupften und in Viktor von Scheffel den unübertrefflichen Ausbund allen Dichter-tums sahen. Der Mann aus dem Böhmerwald, mit bürgerlichem Namen Augustin Popp (Waldeck war der Mädchenname seiner Mutter), war Redemptorist, dann Weltpriester, Spitalseelsorger und Religionslehrer an einer Mittelschule, all das ein wenig durcheinandergewirbelt, ein Bohemien, der im Kaffeehaus daheim war und Freunde um sich brauchte, immer aber ein wahrer Priester, ein wirklicher Dichter. Die Zahl seiner Wohnungen, meist Untermietzimmern, steht hinter jener Beethovens kaum zurück. Wenn er auszog, aus Geldmangel oder weil ihm der Weg ins nächste Cafe zu beschwerlich war, die Vermieterin nicht paßte oder die Luft seiner Angina pectoris nicht gut tat, ließ er Bücher und einen Haufen halber und ganzer Gedichte zurück. Seine „Antlitzgedichte“ konnten erst gedruckt werden, als Oskar Katann, damals Direktor der Stadtbibliothek, hinter Suso her diese Blätter einsammelte und dann einfach zu einem Bande vereinigte.
Der Erfolg in Wien, in Deutschland behagte ihm freilich. Ob die Idee einer eigenen Runde von ihm ausging? Ich entsinne mich nur, daß er eines Tages in seiner ganzen Größe in unserer neuen, um ein Kabinett erweiterten Wohnung, in der Webergasse auftauchte und mich bat, als „Ursasse“ bei der Gründung einer literarischen Kaffeehausrunde, der „Leostube“, mitzutun. Das war viel Ehre für mich, der ich ja außer meiner Dissertation und einigen Artikeln nur ein paar Gedichte gedruckt hatte. Damals war ein junger Dichter, wenn er einen Verlag finden oder überhaupt durchkommen wollte (Wettbewerbe, Förderpreise oder gar Stipendien mit Altersgrenze gab es noch nicht), auf das Wohlwollen und die Protektion eines Alten angewiesen. Heute müßte sich der Fünfzigjährige einen Zweiundzwanzigjährigen als Protektor suchen.
Jeden Freitag trafen wir dann einander im Extrazimmer eines Cafes in der Fichtegasse. Es war keine Konkurrenz zum Cafe Central. Es wurden weder Aufträge noch Zertifikate für den Nachruhrh vergeben, noch wurde öffentlich und bewußt auf Anekdoten und Literaturgeschichte gemacht. — Wer waren wir auch gegen die berühmten Feuilletonisten und Kritiker? Wir waren keine Clique mit Manifesten, weder Avantgardisten, noch Bahnbrecher, Erneuerer der Dichtung. So hoch hinaus wollte keiner. Ein Abend unter Freunden, Dichtern, Künstlern und Freunden der Kunst, unter Christen. Nach Leo XIII., nach der „Leo-Gesellschaft“, die in Wien ein paar Jahrzehnte lang das katholische kulturelle Leben bestimmte, wie im Rheinland die Görresgesellschaft, wurde die Freitagrunde „Leostube“ benannt. Ich denke, es gab weder vorher noch seither, noch zur gleichen Zeit in Wien eine literarische Runde, bei der es so streng herging. Suso Waldeck war ein Fanatiker von Gewicht und Klang, Maß und Schwung eines Wortes, einer Zeile, eines Verses, eines Kapitels Prosa. Jeden Freitag wurde gelesen und erbarmungslos gewogen und gemessen. Siegfried Freiberg, Gisela von Berger, Carry und Trude Hauser, Paula Von Preradovic, Ernst Scheibelreiter, Richard Billinger, Fritz Wodke, Fritz Michaelis, Robert Haas, Oskar Katann. Freunde und Gäste aus den Ländern, aus dem Ausland, Hans Leifhelm, Jakob Kneipp, Franz Herwig, Leo Weißmantel. Es kam nie auf die Zahl an. Noch heute sehe ich Susos prüfende, leicht verschmitzte Augen vor mir, wenn ich einen Vers hinschreibe. Eine nur so hingesagte, in Zeilen abgeteilte Prosa war für ihn und uns kein Gedicht. Ich bringe auch heute kein Gedicht ohne einen inneren Rhythmus zustande. Wenn ich Prosa schreiben will, dann schreibe ich Prosa. So sehr verdorben wurden wir damals.
Suso war ein Bohemien. Wir erreichten für ihn beim Kardinal montlich 100 Schilling. Er schenkte das Geld irgendeinem Konvertiten und blieb wieder die Miete schuldig. In ein Heim für alte Priester, ein „Defizientenheim“, hätten ihn keine zehn Rösser gebracht. Später, als die Krankheit bös wurde, hatte er in einem Kloster an der Westbahn die Messe zu lesen und am Sonntag zu predigen. Die Schwestern umsorgten ihn wie ein Kind. Er aber fuhr jeden zweiten Tag nach Wien. Ohne Kaffeehaus konnte er nicht leben. Dabei war er nicht einmal ein Kaffeehausliterat. — Von St. Veit im Mühlkreis, wo er nicht weniger von Schwestern umsorgt wurde, könnte er nicht mehr ausbrechen. Dort starb er nach zwei Jahren.
Großartig war der junge Billinger, wenn er seine bäuerlichen Gedichte aufsagte. Ein Bär, der ein Stück Zucker auf der Zunge zergehen läßt. Diese Hände, dieser Corpus, und alles noch echtes Innviertel ohne Schwabinger Zutaten. Als Pensionär bei den alten Ludwigs, die alle Balkankönige mit Stilmöbeln versorgten, nach dem Erfolg der „Rosse“, schrieb er damals für Salzburg das „Perchtenspiel“. Eine Billinger-Parodie für einen Faschingsabend mit dem Titel „Die Sau“ habe ich verloren. Es war eine Parodie unter vielen, denn Josef Leb, der ständig nach Lesefutter hungrige Leiter der „Volkslesehalle“, hatte knapp zuvor bei einem Vortrag eine Dichterschule angeregt, in der die christlichen Autoren lernen sollten, wie man jene Bücher schreibt, nach denen die lesewütigen Leute in den Volksbüchereien verlangen. Meine Parodie war als Aufnahmsprüfung in diese Dichterschule aufgezogen und als Szene für eine satirische Komödie „Die Grottenbahn“.
Rund um uns war das Zeitalter der literarischen Idylle angebrochen. • Kindernovellen, Ministrantengeschichten, Romane yon kreuzbraven Bauern und verruchten Großstädtern. Der Expressionismus war tot, jede geistige Auseinandersetzung mit der Zeit galt als überflüssig und unpoetisch. Das Christliche, das Katholische lag in einem biederen Bauerntum, in Volksbräuchen — hier mit heidnischen wohlgemischt —, vielleicht noch im dämonisch Triebhaften, das allem Heldentum innewohnt. Es fehlte nur, daß die Dichter als Schäfer kostümiert umgingen. Ein paar hundert Autoren im Lande bekannten sich als katholische Dichter, doch nur bei Peguy und Bernanos, bei Bloy und Claudel fanden wir, was wir suchten, bei unseren eigenen Versen natürlich, aber doch gehemmt durch die allgemeine Verachtung, die damals jedem Nichtidylliker zuteil wurde, jedem, der von einem geistigen Erlebnis ausging. Auf Stifter beriefen sie sich, auf das „sanfte Gesetz“. Daß der wirkliche Stifter alles andere war als ein sanfter Idylliker, bemerkten sie nicht.
1927 hatte ich im „Volkswohl“ die Frage: „Vor einem neuen katholischen Literaturstreit?“ gestellt. Eine Äußerung Franz Herwigs in der „Literarischen Welt“, eine ganze Reihe von Stimmen und Gegenstimmen, zeigte, daß die Auseinandersetzung „Gralbund“ gegen „Hochland“ keineswegs „bewältigt“ war. Es gab keine Gralbündler mehr, Kralik selbst hatte sich auf seine Dienstagrunde zurückgezogen, der „Gral“ wurde von dem von uns allen verehrten P. Friedrich Muckermann SJ ausgezeichnet geführt, der Geist der Enge aber lebte in den Redaktionen klerikaler Blätter, der Ruf nach Bewahrung vor der „bösen“ Welt war überall zu hören, die Warnung vor jedem literarischen Kunstwerk, und sei es um den Preis eines neuen Gettos, in dem neben Erbauungsbüchern von der süßlichen und langweiligsten Sorte nur eine großangelegte Kalendergeschichtenproduktion zugelassen war.
Meine Frage zielte nicht auf diese Geschichtenschreiber. Das Erbe der Gralbündler wurde wiederum lebendig, die Angst Vor jeder, das Maß des „Volkstümlichem“ . übersteigenden Kunst, die völlige Interesselosigkeit am Formalen.
Für einen „neuen Literaturstreit“ freilich war der eine mögliche Streitpartner bereits zu schmalbrüstig geworden, und das Streitobjekt, „Katholisches Schrifttum“, den Kalendermachern, den Beckmessern eines angeblich gefährdeten Kirchenvolkes und allen, die vor Sachgerechtigkeit und Freiheit ehrlich Angst hatten, längst über die Köpfe gewachsen. Die Frage war nicht mehr, ob der Inhalt oder die Form allein den Wert eines Kunstwerkes bestimme, oder wie man die Schäflein am besten gegen die giftigen Abgase des weltläufigen Literaturbetriebes schütze. Eine leidenschaftliche, in der Form unantastbare, durchaus moderne, nicht modernistische Dichtung kam heraus, aus dem Glauben, aus der natürlichen und göttlichen Wertordnung, eine Dichtung des zwanzigsten und nicht mehr des neunzehnten Jahrhunderts, das die Metaphysik ausgeklammert, oder wie es glaubte, liquidiert hatte. Die Frage war, ob diese Dichtung gegen oberflächliche Idylliker und gegen all das bestehen konnte, was sich als weltläufige Literatur anbot und zumeist über jene Humanität nicht hinauskam, die in nichts der explosiv ausbrechenden Barbarei gewachsen war.
Meine erste Begegnung mit Richard von Kralik wurde vor diesem Hintergrund ohne mein Zutun gespenstisch. Zur Vorbereitung des 75. Geburtstages sammelten sich zwei Dutzend Verehrer und Verehrerinnen. Im Auftrag meines Chefs sollte ich den guten Leuten beistehen. Sie wiegten die Köpfe und neigten sich und sagten einzeln, im Halbchor und Chor: „Der Meister, unser Meister!“ Aber Vorschläge hatte keiner bei sich. Ich schlug einen Abend im Mozartsaal und eine Gratulationscour vor, auch eine Information für die Presse und die Aufführung eines Puppenspiels, mit dem Erfolg, daß sie mir alle Vorbereitungen übertrugen. Ich mußte also schleunigst den Meister selbst sprechen. Am Vortag meines angekündigten Besuches aber erschien — diesmal ohne Verspätung — mein auch gegen seine alte „Gralbundwelt“ gerichteter Aufsatz.
Kralik empfing mich freundlich, wie ein alter Autor einen allzu kritischen, sehr viel jüngeren empfängt, führte mich in den Musiksalon, setzte sich ans Klavier und spielte und sang mir eine neue Komposition vor. Man stelle sich vor: Der Autor singt das von ihm geschriebene und vertonte Gedicht und begleitet sich selbst am Klavier. Dies in einem großen Zimmer, daß er selbst in einem Gemisch von Nazarener- und Jugendstil mit einem breiten Fries aus „Tannhäuser“, „Parsifal“ und den „Ring der Nibelungen“ ausgemalt hat. Dabei hatte Kralik als Verfasser der „Kulturstudien“, als Erneuerer der Wiener Volksbühne und des Puppenspiels tatsächlich große Verdienste. Hätte er doch nie diese Massen von Gedichten geschrieben und noch weniger seine romantisierenden geschichtlichen Märchen! Eine zweibändige Ausgabe könnte vielleicht das Gute, Kluge und für die Zeit Wichtige aus seinem höchst diffusen Werk herausschälen und retten.
Zum Abschied sagte er schlicht und beschämend freundlich: „Ich habe vorhin Ihren Artikel gelesen.“
Aua , .Fügung und Widerstand“ von Rudolf Kens. Stiasny-Verlae Gra und Wion.