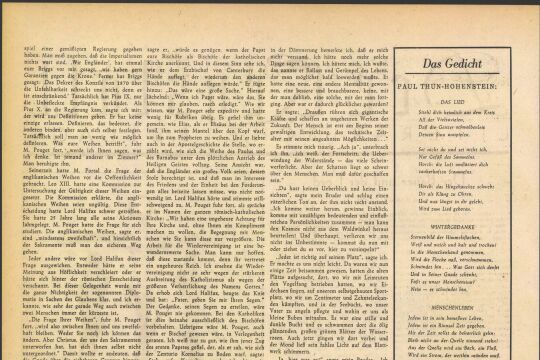Wenn In unserem Landhäuschen in Henndorf bei Salzburg ein Huhn oder eine Ente geschlachtet werden sollte, dann mußte die Nachbarbäuerin, die Riedermüller-Mariedl, herüberkommen und die blutige Arbeit tun, denn die Köchin weigerte sich und der Hausverwalter, ortsamtlicher Totengräber von Beruf, verabscheute es, ein Geschöpf vom Leben zum Tode zu bringen.
Ich selbst ging gelegentlich Rebhühner oder Fasanen schießen. Sie fielen — falls ich traf — von Schrotkörnern durchbohrt in die herbstlichen Stoppeln, und wenn der Hund sie apportierte, waren sie fein säuberlich, fast ohne ein Blutströpfchen, wie, ausgestopfte Vögel anzusehen. Nie hatte ich daran gedacht, selbst einen Hahn zu schlachten. Ich hätte mir aber auch nicht träumen lassen, daß ich einmal das Leben eines Farmers in Amerika führen würde — und zwar, ich sage es mit Stolz, das eines „dirt-Farmers“.
Wir hatten uns das „Farmen“ ganz nüchtern und sachlich vorgestellt. Nach all den Jahren voll Unruhe, Wechsel und Wanderschaft, ein Ort zum Bleiben, eine geregelte Tätigkeit, eine solide Lebensweise. Kein Pathos, keine Romantik, nicht zu viel Aufregung. Laß Herz und Seele ruhen, und reg die Muskeln. Feste Arbeitsstunden, sauber zwischen Stall, Feld und Schreibtisch geteilt. Planmäßig und zweckentsprechend '— die Hände voll Blasen und ein freier Kopf.
Unsere Farm liegt eine Stunde vom nächsten Ort, inmitten der Wälder, sie war viele Jahre lang nicht bewirtschaftet worden, und der steile Zufahrtsweg verwandelte sich schon im November in einen Gletschersturz.
„Glaubt Ihr wirklich, daß Ihr den Winter hier aushalten könnt?“ fragte einer der Dorfbewohner, als wir einzogen.
„Warum nicht“, sagte ich kühn, „andre Leute haben es vor uns getan, und ein paar von ihnen haben es überlebt.“
„Sie haben es überlebt“, sagte der Mann, „aber das waren eingeborene Vermonter. Und selbst für Eingeborene —“
Er sprach den Satz nicht zu Ende, sondern zuckte die Achseln und wandte sich ab, wie von dem traurigen Anblick eines unvermeidlichen Unglücksfalls.
Jetzt liegen drei Winter hinter uns — (idi seh sie liegen wie unzerschmelzbare Eisblöcke). Wir leben noch. Und ich habe einiges gelernt. Vor allem, wie nie zuvor in so kondensierter Form, was ein einzelner Mann ohne Hilfe leisten kann — und was er definitiv nicht kann. Er kann zum Beispiel, während einer Kältewelle zwischen 40 und 50 unter Null, in einem alten Haus mit Holzöfen und sturmdurchrüttelten Scheunen, es gerade noch schaffen, daß ihm die Wasserleitung, der Viehbestand und die Familie nicht einfriert Er kann mitten in einem Blizzard eine zusammenkrachende Stalltür reparieren. Er kann seinen Nachschub an Futter- und Lebensmitteln in einzelnen Füntzig-Pfund-Lasten drei Meilen weit auf Schneeschuhen herbeischleppen. Aber gleichzeitig ein Buch oder ein Stück schreiben, das kann er nicht. Oder es soll mir einer vormachen. „Dichter und Bauer“ mag eine schöne Oper sein — ich kenne nur die Ouvertüre — in der Praxis geht es nicht zusammen. Wenigstens dann nicht, wenn man wirklich beides selber tun muß, und sich nicht eine Farmhilfe leisten kann, die einem vielleicht die Bücher schreibt, oder einen Schriftsteller, der einem die Stallarbeit macht.
Das Schlimmste aber sind die getauften Tiere. Natürlich mußten wir unserm ersten einzelnen Farmtier einen Namen geben. Es war Gussy — die verrückte Ente. Wir waren noch gar nicht fertig mit Reparieren,Zäune bauen, Dächer ausflicken, es war unsere erste „suggaring season“, und wir wollten keine Farmtiere anschaffen, bevor sie richtig untergebracht werden konnten. Aber eines Sonntags besuchten wir einen befreundeten Nachbarfarmer und schnupperten auf dem Geflügelhof herum, um etwas Praxis aufzuschnappen. Dort, auf einem vereisten Misthaufen, der in der Frühlingssonne funkelte wie ein kristallner Thron, saß Gussy. Sie hieß noch nicht Gussy. Man nannte sie dort einfach die „verrückte Ente“. Ihre Federn waren in Selbstverteidigung gesträubt und mit Blut besprenkelt, aber sie zeigte einen gewissen Ausdruck von Herausforderung und Angriffslust. Von Zeit zu Zeit stürzte sich ein Teil des „normalen Geflügels“ über sie her — nicht ohne von ihr durch Zischen, Aufplustern und Flügelschlagen gereizt worden zu sein — und peckte auf sie los, aber Gussy peckte zurück, daß die Federn stoben, und wenn man von ihr abließ, hatte sie noch nicht genug, sondern verfolgte ihre Verfolger in wütenden Gegenangriffen über den ganzen Hof. Dann, nachdem sie etwas mehr Blut und Schönheit aber nichts von ihrer Ehre eingebüßt hatte, kehrte sie auf ihren Misthaufen zurück, um sich in königlicher Einsamkeit irgendwelchen größenwahnsinnigen Träumen hinzugeben.
„So war es immer“, sagte der Farmer, „seit sie ausgefedert ist.“ Er hatte keinerlei Erklärung für ihre Unbeliebtheit. — „Vielleicht ist sie ein Genie“, sagte ich, „ihrer Zeit voraus, oder so ähnlich. Eines Tages werden die anderen ihr ein Denkmal bauen
— auf jenem Misthaufen.'*' — Der Farmer schüttelte skeptisch den Kopf. „Die anderen können sie nicht leiden“, sagte er, „und sie kann die andern nicht leiden. Sie verhungert lieber, als daß sie mit ihnen gemeinsam frißt. Sie werden sie noch totbeißen. Schade drum. Sie ist eine gute Ente.“ Es bedurfte nicht langer Überredung — und wir hatten sie in einem Korb verpackt mit einem kleinen Vorrat an Körnern. Der Farmer schien erleichtert, sie los zu sein — und für uns war es ein Anfang. Warum soll man ein Geschenk zurückweisen? Schließlich war sie eine gute Ente — und eine ausgesprochene Persönlichkeit.
Das letztere war sie unbedingt. Wir hatten eine harte Anfangszeit mit ihr. Trotz aller . Fürsorge, aller Anerkennung und allen Respekts vor ihrer Individualität, benahm sie sich wie ein schwer erziehbares Kind. Zur regelmäßigen Zeit verweigerte sie ihr Futter und stieß ihren Wasserkübel um, aber eine Stunde später tat sie als ob sie verhungern und verdursten müsse. Wenn meine Frau sie mit Weißbrot und Milch zu füttern versuchte, biß sie ihr dankbar in den Finger, Immer wieder rannte oder flog sie davon und man hatte die größte Last, sie in einsamen Waldbächen oder Sumpflachen wieder einzu-fangen und zurückzubringen. Einmal flog sie, offenbar aus Mangel an gefiederter Gegnerschaft, in den Hundezwinger und begann meine beiden Wolfshunde zu attackieren (was ich keiner Wildkatze raten möchte). Ich konnte sie ihnen erst im letzten Moment aus den Zähnen reißen, und meine Frau hätte mit einem Holzklotz, den sie nach den Hunden zu werfen versuchte, beinah mich erledigt. Gussy jedoch schien ausgesprochen gekränkt über unsere Einmischung.
Ein Geflügelhof wuchs um sie auf, von Hühnern, Gänsen, Enten bevölkert; Gussy blieb wie sie war, asozial, egozentrisch, boshaft, angriffslustig und eigenbrötlerisch
— mit einem Wort verrückt. Eines Tages war sie spurlos verschwunden, und nach langem anstrengendem Suchen gaben wir sie auf. Aber als etwa vier Wochen vorbei waren, hörte man plötzlich ein ungeheures Gequake, Gezisch und Gezirpe unter den vermorschten Flurbrettern der großen alten Scheune — und heraus kam Gussy, gefolgt von elf gelbflaumigen, eben ausgebrüteten Entlein.
Die Mutterschaft änderte nichts an ihrer Verrücktheit. Sie benahm sich scheu und wild wie immer, vermied die allgemeinen Futterplätze und versuchte, ihre Brut zur gleichen asozialen und weltverachtenden Haltung und Selbstabsonderung zu erziehen. Sobald aber die jungen anfingen, sich wie „normale“ Enten zu benehmen, biß sie ihre Sprößlinge rücksichtslos von sich weg und schaute sich nach einem einsamen Misthaufen um, auf dem sie der Welt Trotz bieten könne. — „Normal“ ist natürlich ein zweifelhaftes Wort — für jede Art von Geschöpf. Wenn jemand glauben sollte, daß Tiere im allgemeinen „normal“ seien — normaler als Menschen — so denke ich mir, daß er nichr viel von Tieren versteht. Auch nicht von Menschen wahrscheinlich.
Was füt ein Glück, daß man auch ein paar Tiere hat, die keinem ökonomischen Zweck dienen, sondern nur um ihrer selbst willen existieren dürfen und sollen, solang sie gesund bleiben. Ich fand Liesi, mein „Deer“ (zoologisch eher eine Hirschkuh als Reh zu nennen), mitten in der Wildnis, wo sie sich in einem von Gebüsch überwucherten alten Viehdraht verfangen hatte und hilflos mit gebrochenem Hinterlauf festhing. Sie war ein Jährling und schon ziemlich stark. Trotz ihrer Verletzung und des Blutverlustes schlug sie mit den gesunden Läufen verzweifelt um sich, und es war gar nicht leicht, sie auf den Schultern heimzutragen. Der „Gamewarden“ (Jagdschutzaufseher) und der Ortsveterinär rieten mir, sie zu erschießen. Niemand glaubte, daß man sie heilen oder auch nur zutraulich genug machen könne, um sie an Fütterung zu gewöhnen. Ich hatte aber beobachtet, daß sie, wenn man sie in der großen Scheune, in der ich ihr ein Lager zurecht gemacht hatte, allein ließ, frisches Wasser leckte und ein bißchen Heu zu zupfen begann. In den Dämmerstunden, morgens und abends, näherte ich mich ihr vorsichtig (und in meinem ältesten Stallanzug, in dem bestimmt keine menschliche Witterung von mir ausgeht), legte ein paar Karotten, Apfelstücke, einen Maiskolben in ihre Nähe und Heß sie allein. Nach ein paar Tagen fraß sie bereits alles auf, was ich ihr hinstellte, aber nur wenn sie sich unbeobachtet fühlte. Gleichzeitig bemerkte ich, daß die Wunde an ihrem gebrochenen Lauf immer schlimmer wurde und gefährlich zu eitern begann. Sie konnte zwar bereits auf den drei anderen stehen und ein paar Sprünge machen, aber von der offenen Splitterstelle drohte Brand und Blutvergiftung. Mir war klar, daß etwas Radikales geschehen mußte, um sie zu retten. Es war ein kalter, stürmischer Sonntagmorgen im November. In der Früh hatte ich stundenlang mit Gummistiefeln im vereisten Teich herumwaten müssen, um ein paar Enten zu befreien, die über Nacht eingefroren waren Es war einer jener Tage, kurz vor Wintersanbruch, an denen alles schief zu gehen scheint. Wortlos — da ich wußte, daß mir dabei niemand helfen kann — schärfte ich eine Axt, bereitete etwas Verbandzeug, Lysol und Wundsalbe vor, ging in die Scheune hinüber und warf mich sofort über das Tier, ehe es aufspringen konnte. Tndem ich es mit meinem Körpergewicht niederhielt, trennte ich mit einem raschen Schlag ihren heillos zersplitterten Lauf ab, reinigte die Wunde und machte einen blutstillenden Verband. Dann stellte ich ihr etwas frisches Wasser hin und ging. Ich wußte, es war das einzige, was man versuchen konnte, — ob es Erfolg haben werde, ahnte ich nicht.
„Was ist passiert?“ fragte meine Frau, als ich herüber kam. „Du bist ganz grau im Gesicht “ „Wo ist der Applejack“, antwortete ich heiser und nahm einen tiefen Schluck.
Als ich am Nachmittag wieder in die Scheune kam, da stand Liesi auf ihren gesunden Läufen, das frisch amputierte geschickt nach rückwärts ausgestreckt, und schaute mir ganz ruhig, fast ohne Scheu, entgegen. Ich selbst mag wohl vor Erregung gezittert haben. An diesem Abend nahm sie zum erstenmal ihr Futter von meiner Hand und ich konnte ihr ohne Mühe den Verband wechseln. Nach zehn Tagen war die Wunde geheilt, sie lernte auf ihren drei Läufen so rasch und sicher herumspringen, als sei sie ein komplettes Deer, hört auf ihren Namen und läuft mir überall nach. Sie lebt in einem kleinen Haus dicht beim Hundezwinger, mit dessen wild ausschauenden Insassen sie eine intime Freundschaft gechlossen hat. Viele Leute kommen an Sonn- und Feiei tagen herbeigewandert um das zahme Deei zu sehen — und während ich das niederschreibe, komme ich auf die Idee, ich soLte einen Nickel Eintritt nehmen, und einen Dirne für Streicheln und Füttern. Dann könnt ich vielleicht das Hühnerschlachten aufgeben — und all meinen Tieren Namen geben.