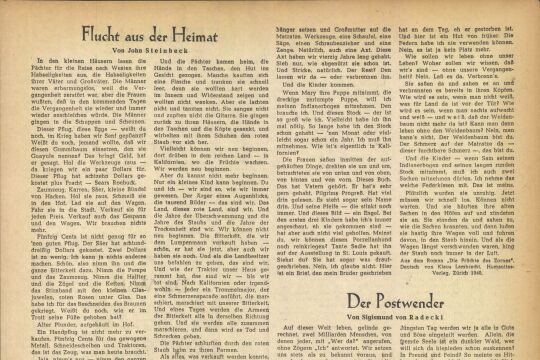Der Mensch ist mit allem in der Welt, besonders aber mit dem Menschen, durch Fragen verbunden und von allem durch Fragen getrennt. Insoweit es Antworten gibt, dienen sie meist bloß dazu dem Frager den Atem abzuschneiden oder ihn auf leidliche Art loszuwerden. Die Jugenderziehung besteht in der Regel aus eilfertigen Fragebeantwortungen, die in Wahrheit keine sind und an deren Abbau aus dem Winkelwerk des Geistes- und Seelengebäudes der Mensch zeitlebens die größte Mühe setzen muß. Die Bollwerke von Vorurteilen auf dem Schauplatz der menschlichen Tragödie sind auf beflissenen Fragebeantwortungen während der Jugendzeit gegründet.
Das Fragen — und ich sehe vom neurotischen „Fragezwang” ab, der auf anderes als die direkte Beantwortung des Frageinhalts abzielt — gilt als Ausdruck der Wißbegier oder des Interesses. Das Antworten wäre — philosophisch betrachtet — eigentlich nur Formalität, zumal ja jede bis ins letzte analysierte Frage ihre Beantwortung in sich enthält. (Sokrates: Lernen ist Wiedererinnerung.) In alt gewordenen und konventionalisierten Gemeinschaften bestehen auch konventionalisierte Fragen, hinter denen weder Wißbegier noch Interesse steht und deren Beantwortung Befremden erregen würde, weshalb sie auch mit der Frage selbst wieder beantwortet werden. (How do you do? — How do you do?) Nimmt man es streng, so scheint alles Fragen nur die indiskrete Frucht der Ungeduld, die dem eigenen Denken wenig zutraut und ein allmähliches Herausreifen der Antwort nicht abwarten will. Behördliche Fragebögen bekunden Mangel an Lebensart.
Sir Osbert Sitwell wies einmal einen amerikanischen Fragesteller darauf hin, es gebe zwischen Menschen überhaupt nur einen einzigen Unterschied, den nämlich zwischen schöpferischen und unschöpferischen. Der schöpferische Mensch kann den unschöpferischen allenfalls verstehen, der unschöpferische jedoch niemals den schöpferischen. Was hiebei dem Verständnis entzogen erscheint, sind weniger die Werke selbst als ihr Entstehungsprozeß, die Wesensform und Produktionsweise der Dichter oder Künstler. Diese sind deshalb mancherlei Fragen ausgesetzt, auf die hin zwar irgend etwas gesagt werden könnte, die aber, indem sie gestellt werden, sich bereits unbeantwortbar machen. Es ist nämlich nicht so, als ob verschiedene Denkebenen einander an einer Schnittlinie berührten (trotz des sofortigen Auseinanderstrebens im gleichen Winkel, in dem sie sich einander näherten, entstünde da doch für ein Weilchen das Phänomen der Interferenz); es ist vielmehr so, daß die Denkebenen windschief zueinander bleiben und ihre Koinzidenz auf unerreichbare Unendlichkeiten angewiesen wäre. Im Grunde fühlen dies auch die ebenerdigen Fragesteller und verhören den Dichter meist nur aus vorgetäuschtem Interesse oder in mechanischer Übung entleerter Konventionen.
Nun aber ist es an der Zeit iu werden. Von den bislang mehr als sechs Jaürzdintetf meine? Lehens vergingen mehr als vier in literarischem Bemühen. Obwohl sich dies bereits ziemlich herumgesprochen und herumgedruckt hat, wurde ich doch hier in Amerika, wo ich nun fast zwanzig Jahre lebe, schon mindestens hundertmal, also durchschnittlich alle zehn Wochen (Statistik belustigt mich!), gefragt: „Schreiben Sie noch immer?” Wäre die Frage bösartig gemeint, so hätte sie allenfalls ihre Berechtigung, denn es stünde legitimes Mißfallen dahinter. Aber die Frage ist wohlmeinend gestellt und verstärkt durch einen Unterton von Mitgefühl mit meinen einstmaligen und vielleicht gar noch gegenwärtig statthabenden Schreibeanwandlungen. Der Unterton will sagen: „Sie schreiben doch hoffentlich nur ab Hobby, nicht? In Wirklichkeit haben Sie einen Beruf, nicht?” (Als Beruf gilt lediglich, was den Gegenwert von Eisbein mit Sauerkraut abwirft.) Ich wünsche dem vorliegenden Aufsatz genügend Verbreitung und hoffe, von ihm eine entsprechend große
Zahl von Sonderdrucken zu erhalten, um für den Rest meines Lebens jener Frage (samt Unterton) mit der Feststellung beikommen zu können: „Jawohl, ich schreibe noch immer, als Hobby und zugleich als Beruf.” (Dieses „zugleich gehört jener für viele unbegreiflichen und daher mitunter verdrießlichen 31ücksebene an.)
Die Frage kann aber auch in anderer Form gestellt werden, ivie zum Beispiel von jenem älteren Ehepaar aus meiner Nachbarschaft, da vor einiger Zeit im Sonntagsstaat vormittags unangesagt bei mir vorsprach, um mir liebenswürdigerweise sinen (übrigens beiläufigen) Gruß auszurichten. Nichts erfreut einen in New York mehr, als der unerwartete Besuch eines unbekannten älteren und liebenswerten Ehepaares im Sonntagsstaat. Obschon man selbst noch unrasiert und im Schlafrock ist, würde es einem nicht im entferntesten beikommen, die Gäste auf das Talmud-Wort zu verweisen: „Besuche deinen Nächsten nicht in der Stunde seiner Erniedrigung “ Vielmehr bittet man das Ehepaar, doch nur ja näher zu treten. Es tritt denn auch ein und bewundert sogleich die Bücher, unter denen es auch einige mit meinem Namen wahrnimmt. Und alsbald erfolgt, wie aus einem Munde, der fröhliche Ruf: „Ah, Sie Schriftstellern auch!” (Das „auch” bezieht sich nicht etwa auf andere „schrift- stellernde” Persönlichkeiten, sondern soll nur die Hoffnung der Gäste andeuten, daß ich mich im eigentlichen einer sinnvollen Betätigung widme und sonst nur ..auch” schriftsteilere.) Dieses „auch” versetzt mich sogleich in den Zustand tiefer Beschämung, und ich antworte: „Ja. so gelegentlich, ein wenig gewissermaßen.” Es ist das eine unredliche Antwort, aber zu meiner wenigstens teilweisen Rechtfertigung darf ich vielleicht sagen, daß ich doch das ältere und so liebe Ehepaar nicht mit der Entdeckung schrecken wollte, es sei da völlig unverschuldet an einen Full Time (professionellen Schriftsteller) geraten, oder — was noch beängstigender wäre — gar an einen Dichter.
Diejenigen, die mich bereits endgültig verloren geben, gestalten ihre Fragen drohend. „Was schreiben Sie jetzt?” Es ist dies eine unangenehme Frage, die sich auch nur selten genau beantworten läßt, da ich niemals nur an einer Sache arbeite und da, was ich arbeite, während des Entstehungsprozesses meist undefinierbar ist, wozu noch kommt, daß sich Autoren überhaupt nicht gerne festlegen. Ich trachte daher, möglichst auf ein anderes Thema hinzulenken und sage etwa: „Ich bereite meinen neunzigsten Geburtstag vor.” Würde ich nämlich wahrheitsgemäßer antworten: „Ich schreibe einen Roman”, dann wäre ich unverzüglich einem Niagara von weiteren Fragen ausgesetzt: „Wie lautet der Titel? Wo spielt er? Wieviel Seiten wird er haben? Wann erscheint er? In welchem Verlag? Wer wird ihn verfilmen?” Es wäre ein Irrtum, anzunehmen, der Fragesteller wünschte dies alles wirklich zu wissen. Wenn mir aber die Zunge ausgleitet, so pflege ich gleich hinzuzusetzen: „Der Titel lautet iDie. Wahlverwandtschaften. Die Handlung spielt in Hollywood. Das Buch wird 2000 Seiten haBen. Es wird nächste Woche eir scheinen. Metro-Goldwyn-Mayer wird es übernächste Woche verfilmen. Musik von Franz Lehar.” Derartiges hören Fragesteller mit Unlust. Sie wittern darin Ironie. Sie wollten doch bloß ihr Interesse bekunden, und sie werden dieses Interesse später, sobald das Buch erschienen sein wird, mit der von mir — und gewiß auch im ähnlichen Fall von anderen Autoren — besonders geschätzten Frage zum Ausdruck bringen: ..Wo kann man sich Ihr Buch ausleihen?”
Manche Fragesteller setzen nach Erscheinen des Buches — mit dessen Existenz man sich also nun abzufinden hat — gerne ein bedeutendes Gesicht auf und fragen: „Wann wird es denn auf Englisch herauskommen?” Deutsch haben sie es noch nicht gelesen. Es gibt soviel wichtigere Sachen. Aber auf Englisch! Das wäre etwas. Sie sind dann enttäuscht, wenn ich andeute, ich hielte nicht viel von Übersetzungen, da die meisten ja doch inadäquat ausfielen. Aber die Fragesteller raffen sich bald wieder auf, diesmal zu heftigem Interesse: „Wie geht Ihr Buch? Trägt es viel?” Da man derartige Fragesteller, besonders wenn sie dem Kaufmannsstand angehören, nicht zu Tränen rühren möchte (diese Art von Tränen zu bewirken, ist nicht die Sendung des Autors), tut man wieder gut, das Thema zu wechseln.
Aber der Fragende läßt nicht locker. Er sieht, daß man aus- weichen will. Und da beginnt er nun Ratschläge zu erteilen. „Warum veröffentlichen Sie nicht in der Saturday Evening Post?” — Ja, wirklich, warum veröffentliche ich nicht in der Saturday Evening Post? — „Na sehen Sie”, sagt der Ratgeber, „ich kann Ihnen gleich eine großartige Idee für eine Erzählung überlassen.” „Was Sie nicht sagen”, rufe ich hocherfreut, „wo ich doch an einem derartig argen Ideenmangel leide.” „Dem Mann kann geholfen werden”, sagt er und beginnt, seine „Idee” auszukramen. „Schreiben Sie das doch”, sagt er dann abschließend, „für Sie ist das eine Kleinigkeit.” Ich wage nicht einzuwenden, daß ich mich nur ungern mit Kleinigkeiten befasse. Vielleicht wird der Mann in späten Tagen, wenn ich am Straßenrand um milde Gaben betteln werde, mir im Vorüberfahren aus seinem Cadillac zurufen: „Das kommt davon, daß Sie damals meine herrliche Idee nicht aufgegriffen haben!”
Nichts ist beglückender, als mit einem bedeutenden Menschen über einfache Dinge zu sprechen; und nichts ist qualvoller, als von einem Banausen oder Böotier über schwierige Dinge belehrt zu werden. Da ergeben sich dann Wendungen wie: „Ein Genie ist schließlich auch nur ein Mensch”; oder: „Nicht alle Gedichte Goethes sind gut”; oder: „Kafka muß doch seelisch krank gewesen sein.”
Jawohl, Madam, Genies sind Menschen. WaTum aber „schließlich” und warum …nur”? — Gewiß, Herr Böotier, nicht alle Gedichte Goethes sind gut. Aber fast alle. — Und warum, meine Dame, glauben Sie, Kafka müsse seelisch krank gewesen sein? — „Nun”, sagt die Dame, „nichts als Fragmente. Nie etwas zu Ende geschrieben.” — „Aber denken Sie doch an Michelangelo, Hölderlin, Novalis.” — „Mein Mann”, sagt die Dame, „macht immer alles fertig.” — Allgemeine Stille. „Was macht denn Ihr Herr Gemahl?” frage ich betreten. — „Hüte”, antwortet die Dame. (Ich berichte Erlebtes. Erfinden ließe es sich nicht so gut.) Hüte sind wichtig. Mit fragmentarischen Hüten ließe sich nicht viel aufstecken.
Hier aber offenbart sich ein bedeutsamer Unterscheidungsfaktor zwischen banausischer und künstlerischer Leistung. Jene erlangt ihre Daseinsberechtigung einzig durch das Erzielen eines Endzustandes. Diese aber kommt niemals zu Ende. Sie erreicht höchstens einen scheinbaien Abschluß. Immer ist sie ein Tor und ein Anfang. Hat die „Ilias”, hat die Neunte Symphonie ein Ende? Sie sind Pforten zu jener Ewigkeit, darin die Genies beheimatet bleiben, obwohl sie auch Menschen sind. Sie haben etwas mit uns gemeinsam. Aber nicht wir mit ihnen.