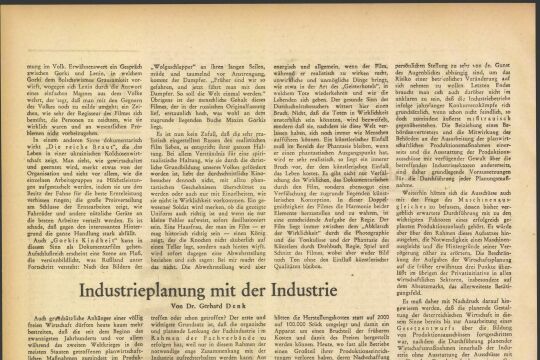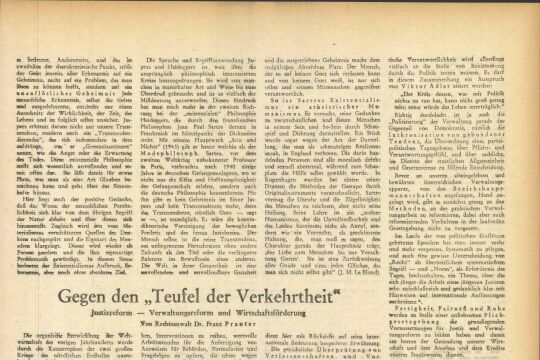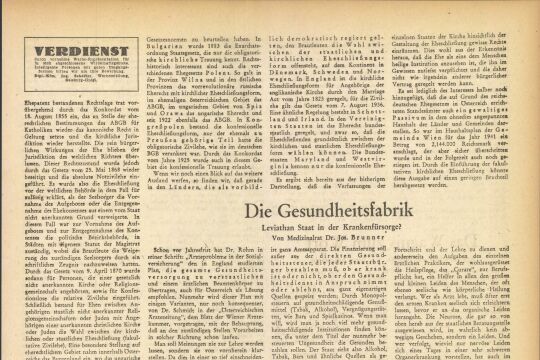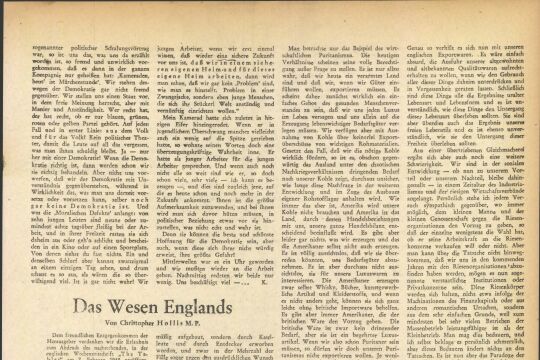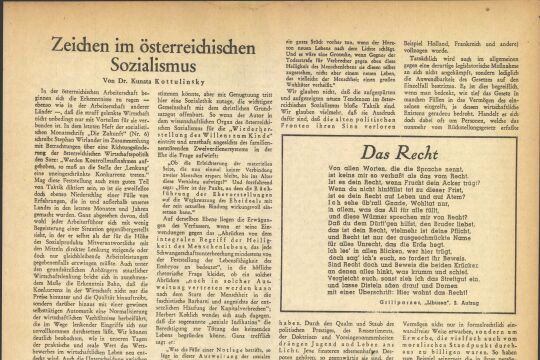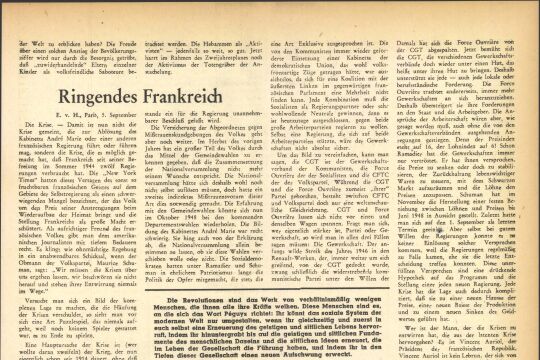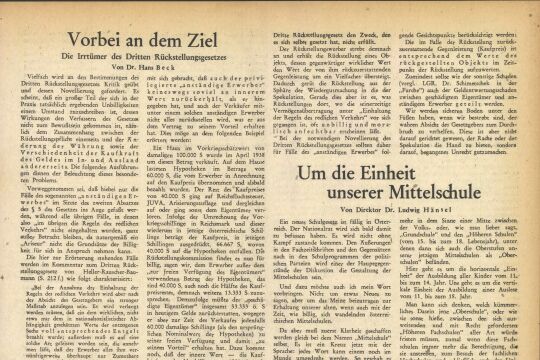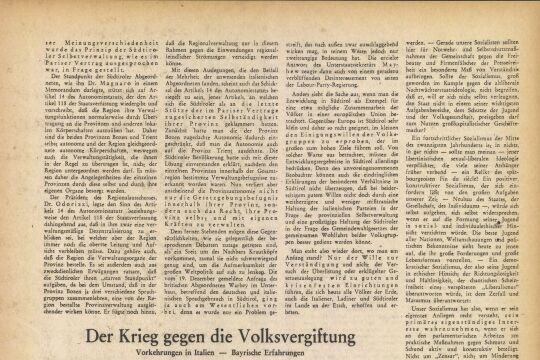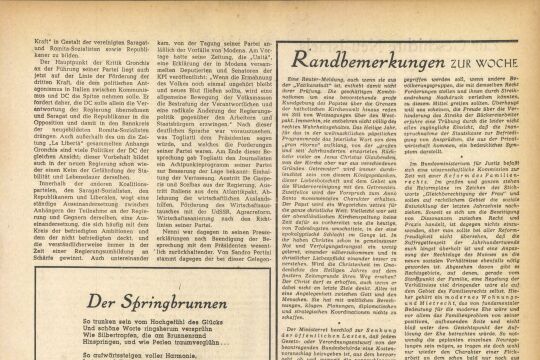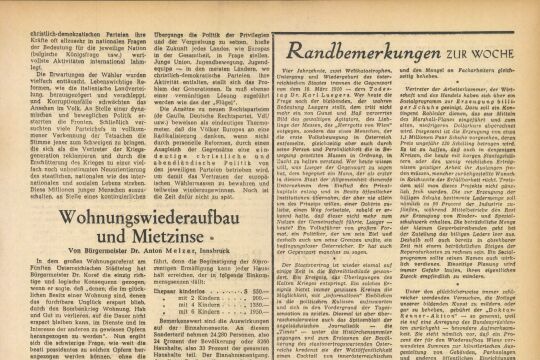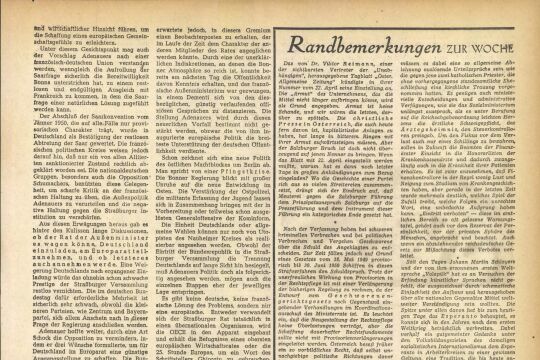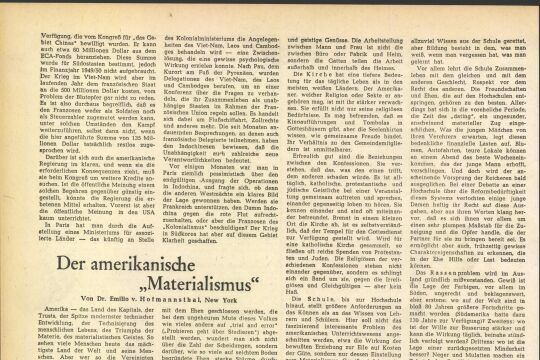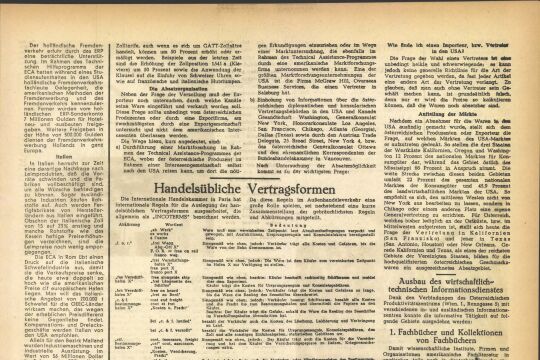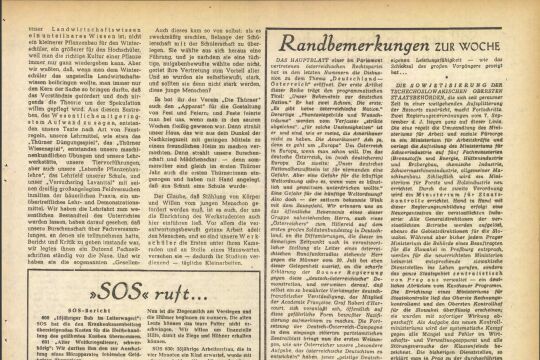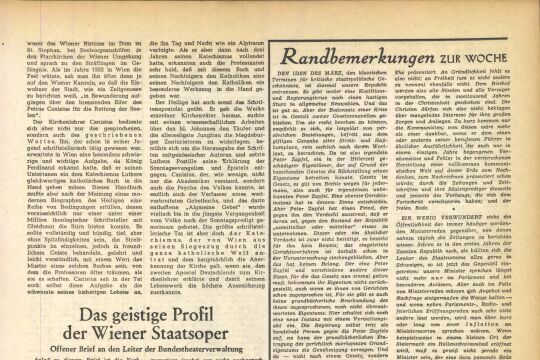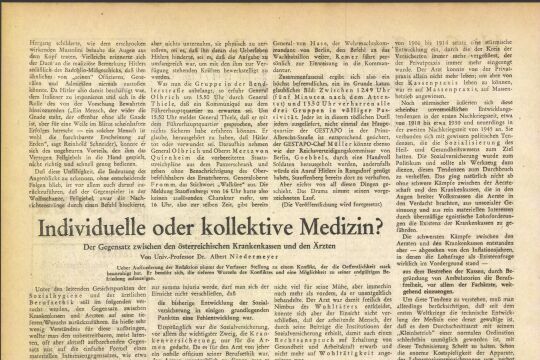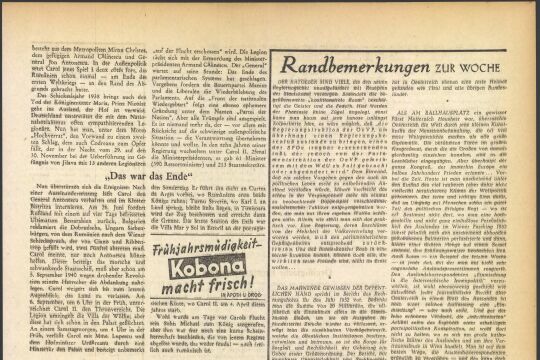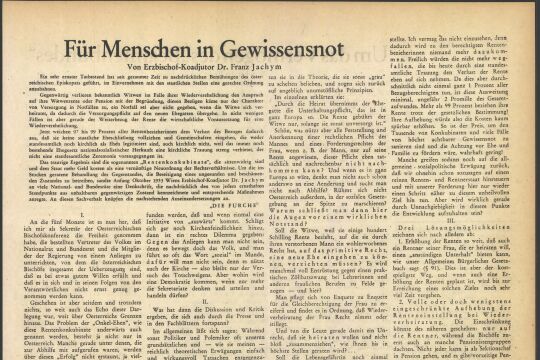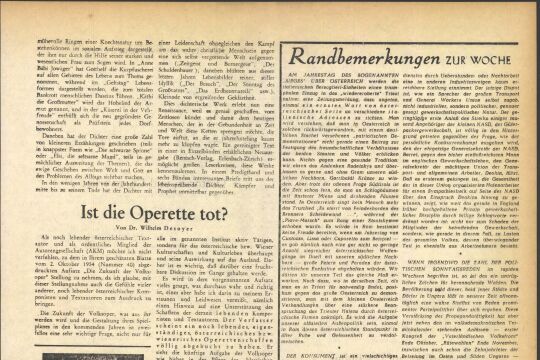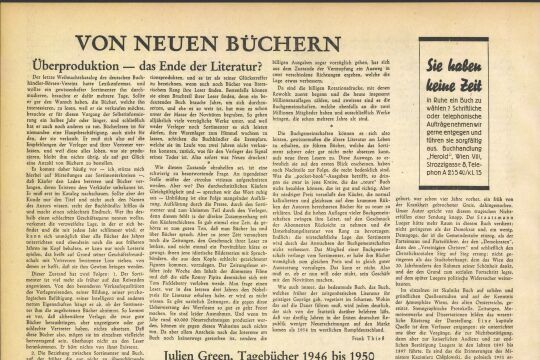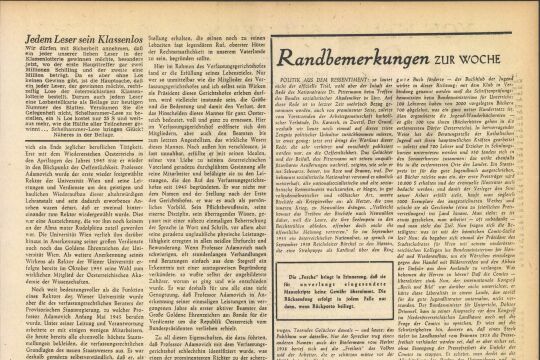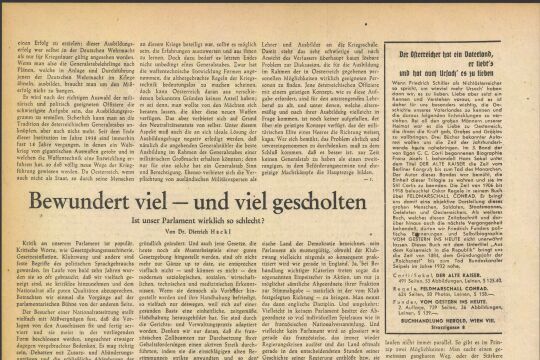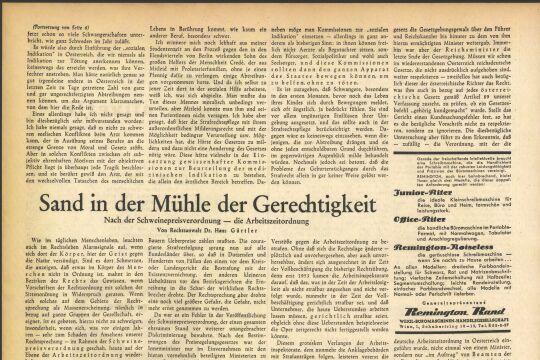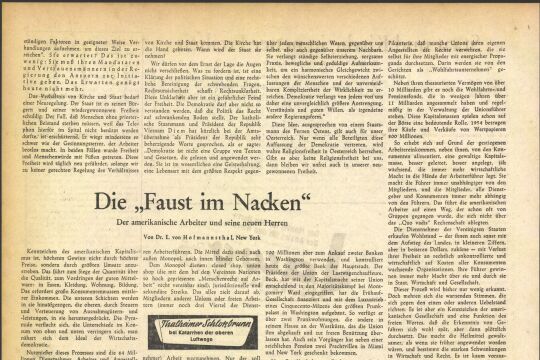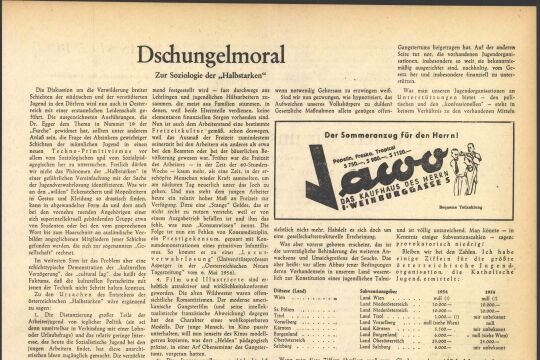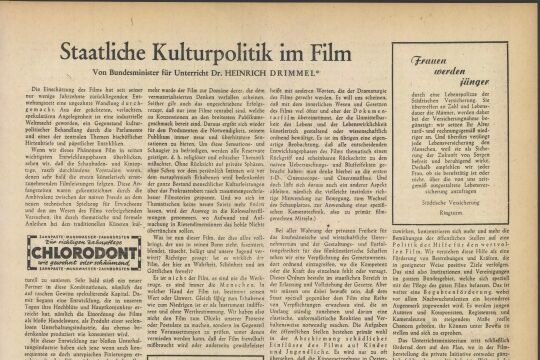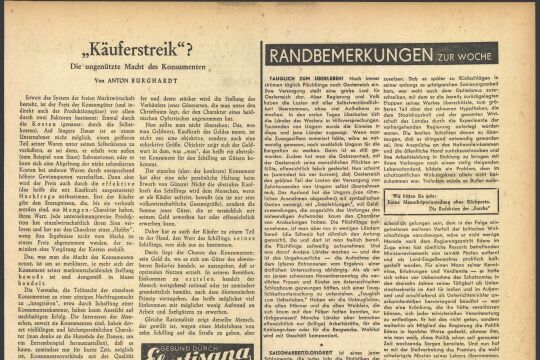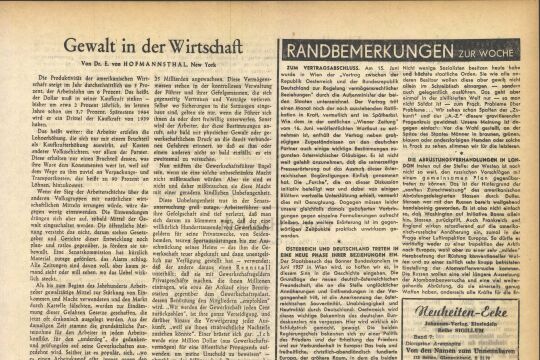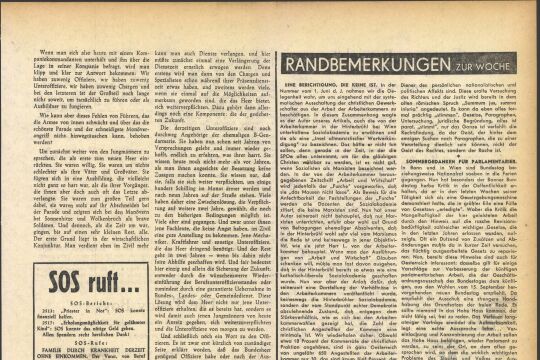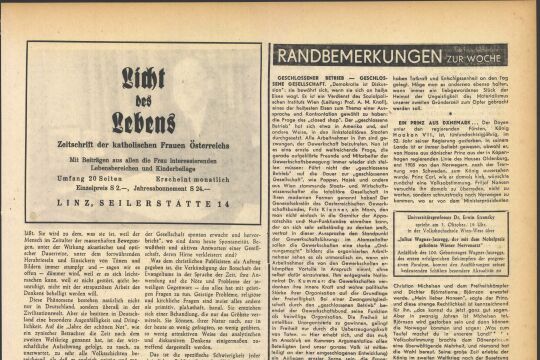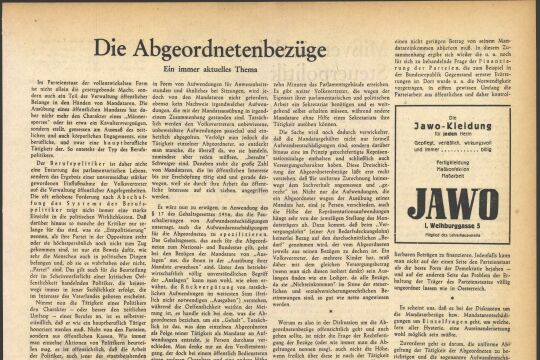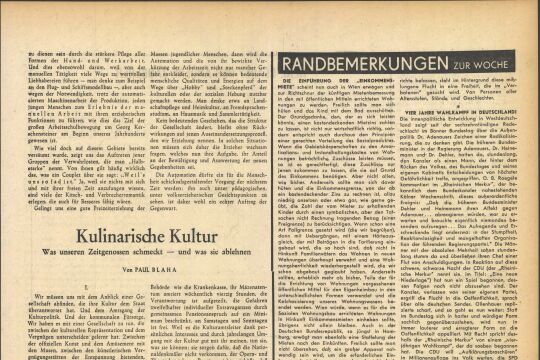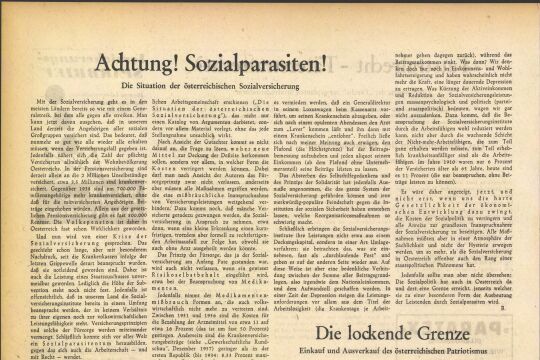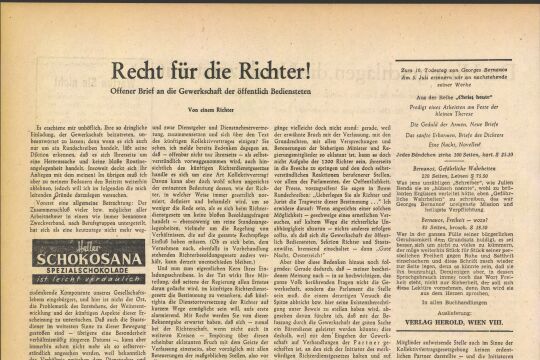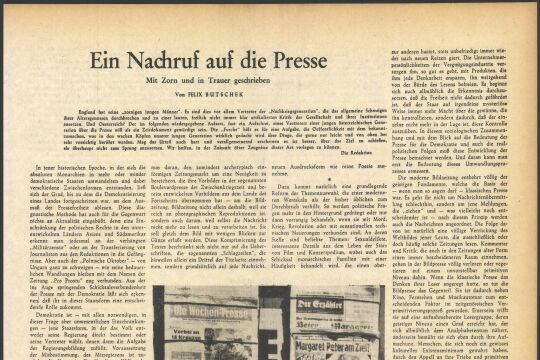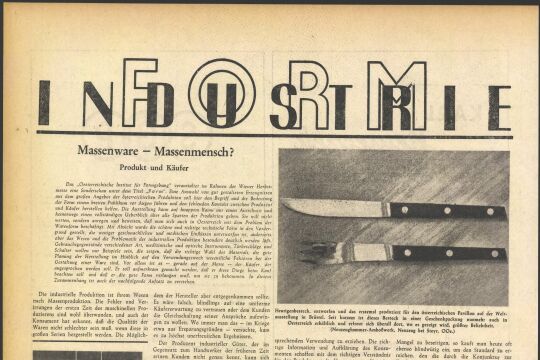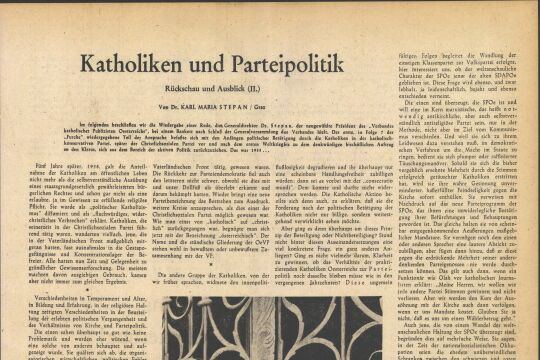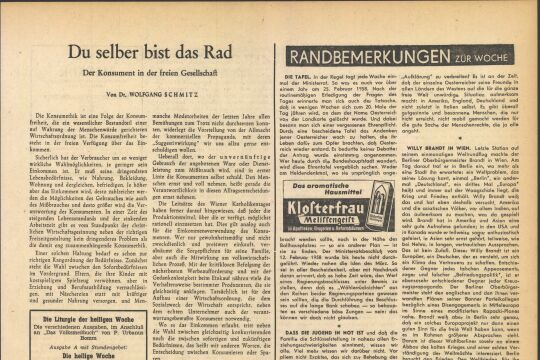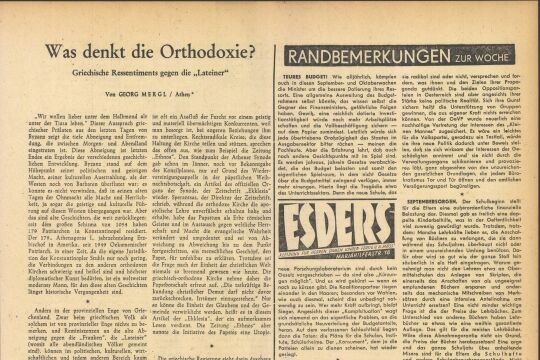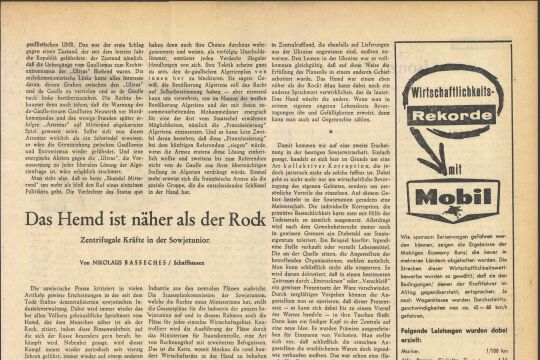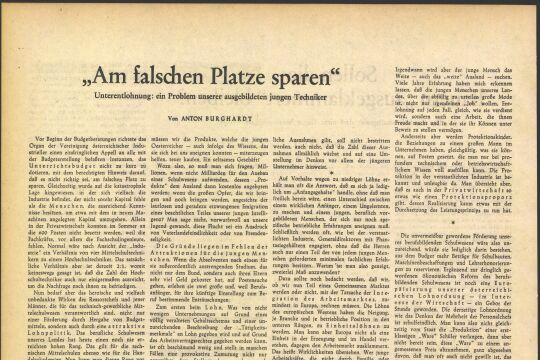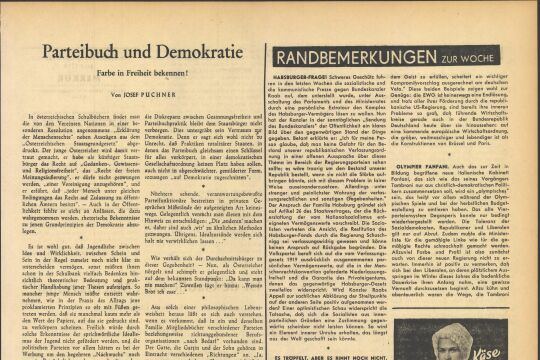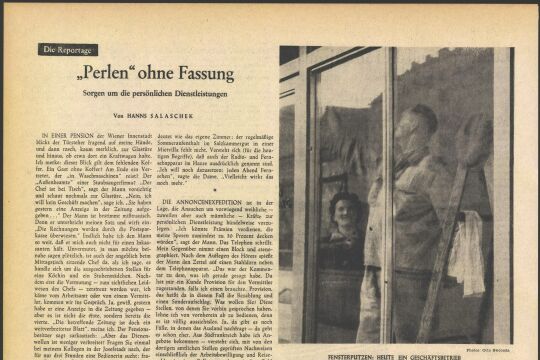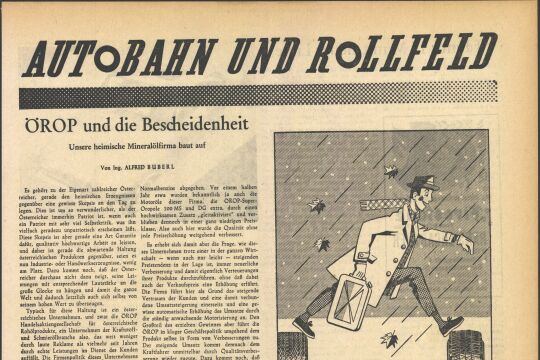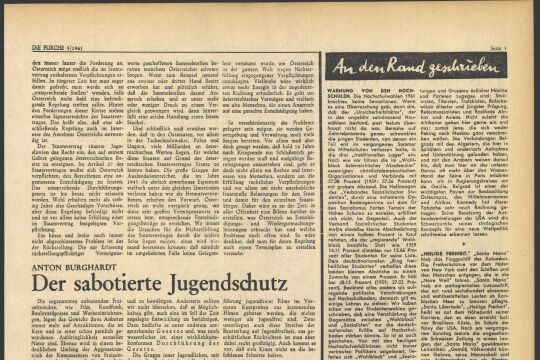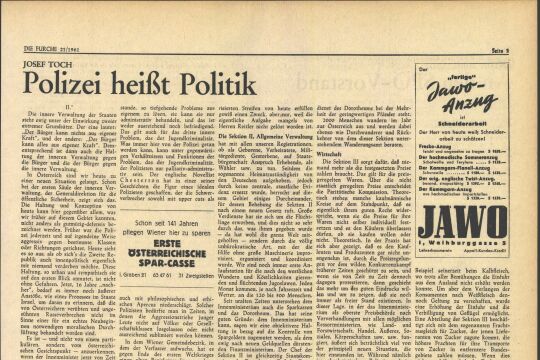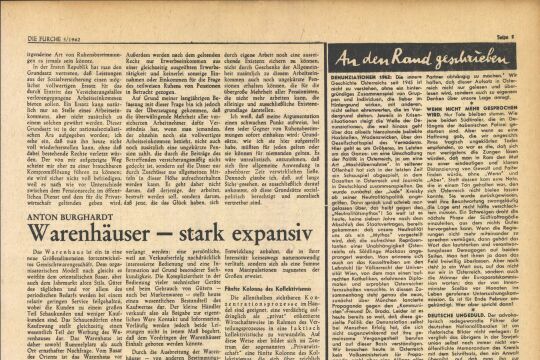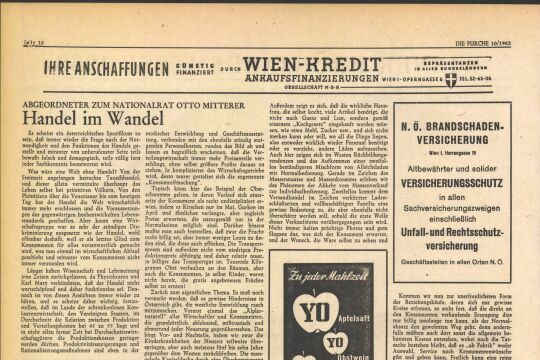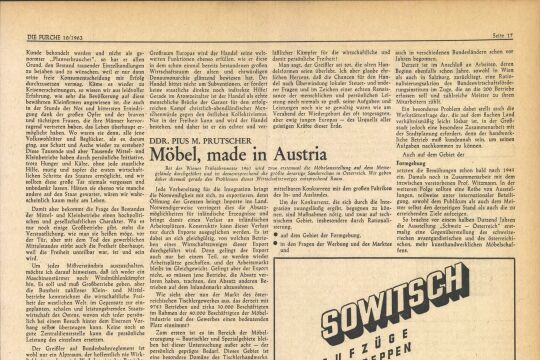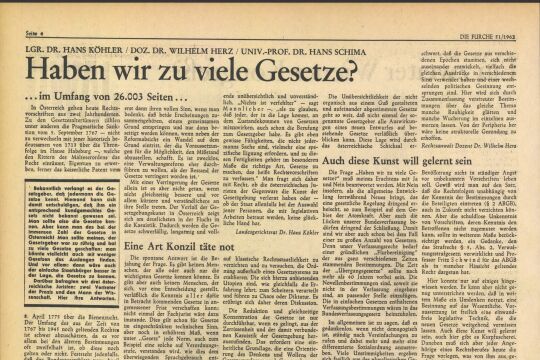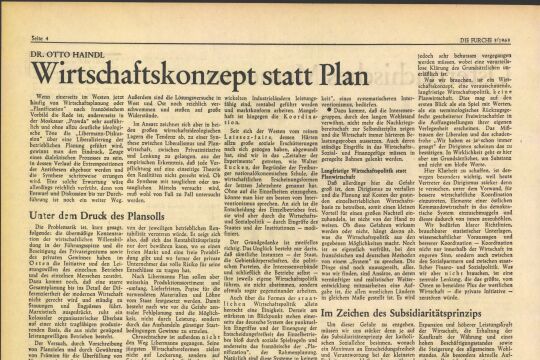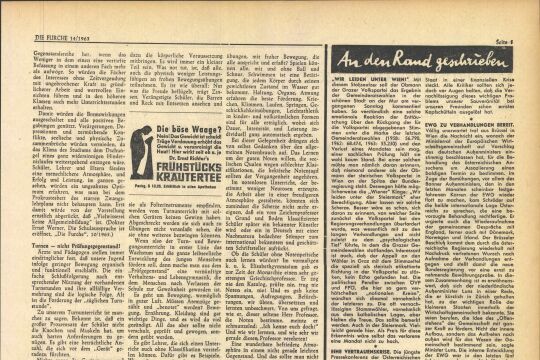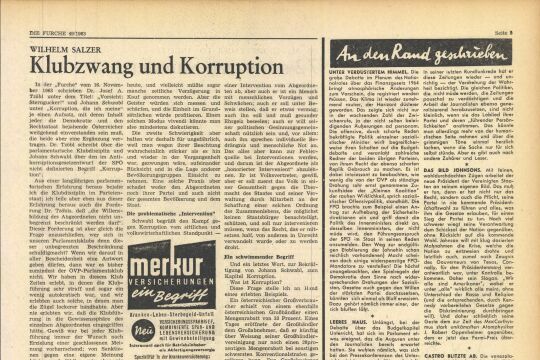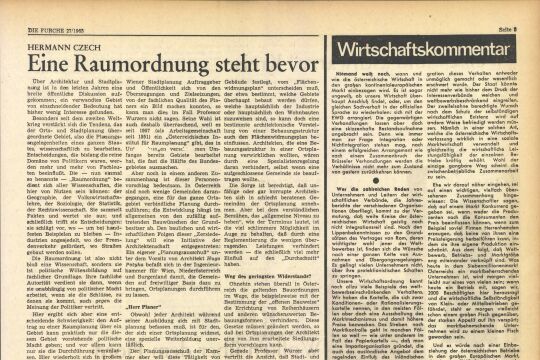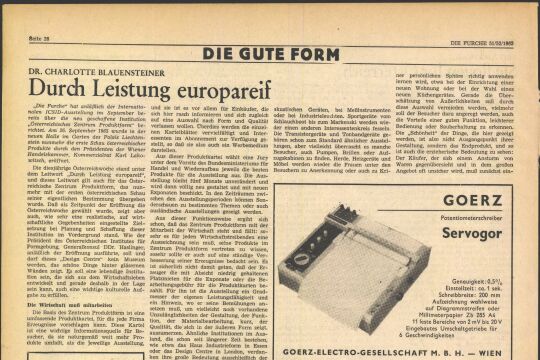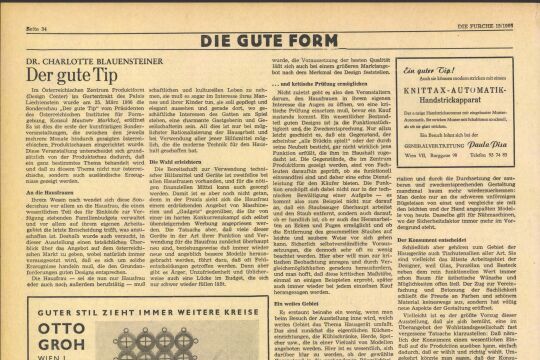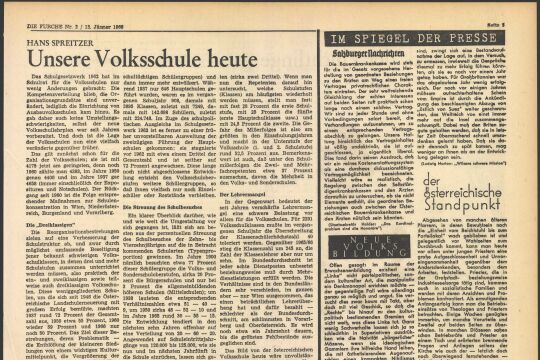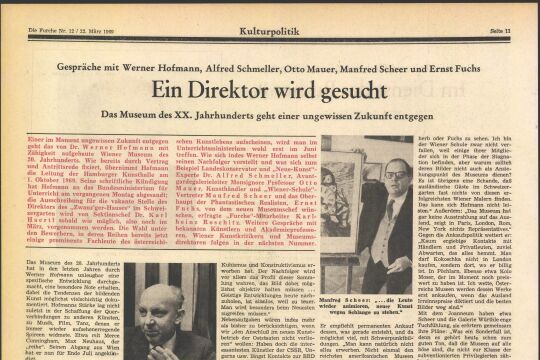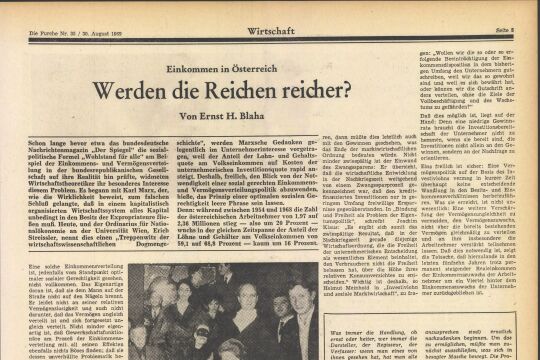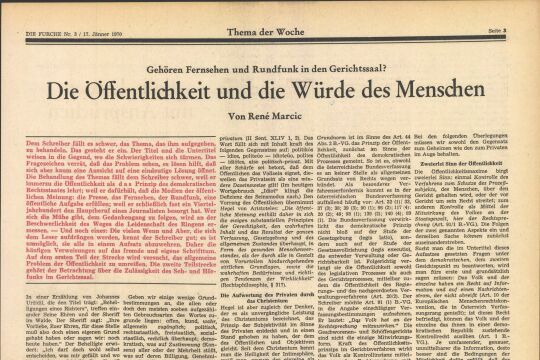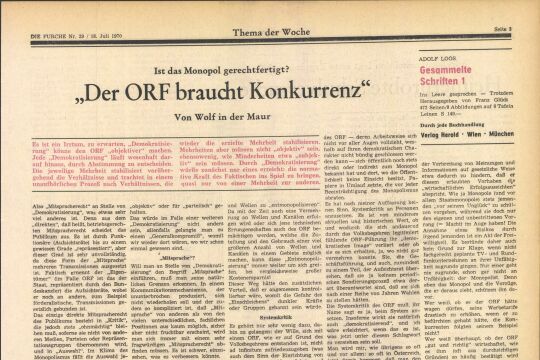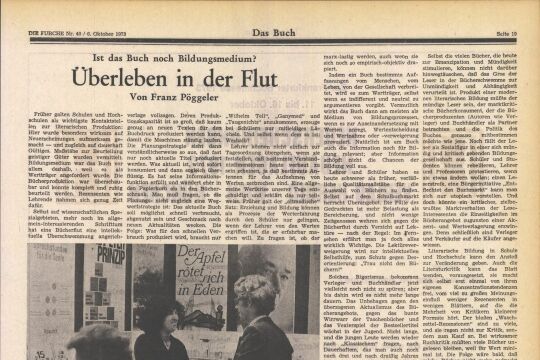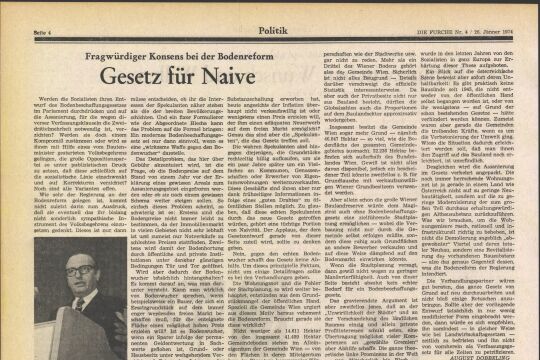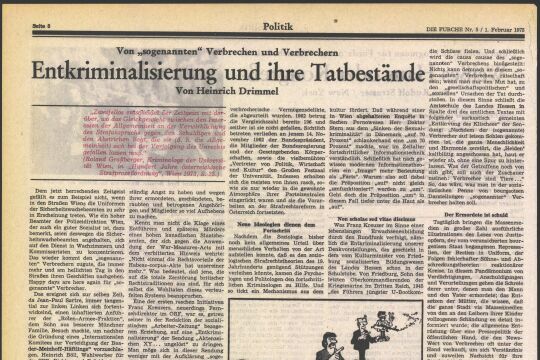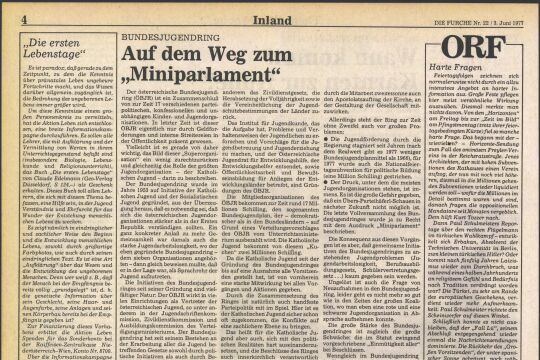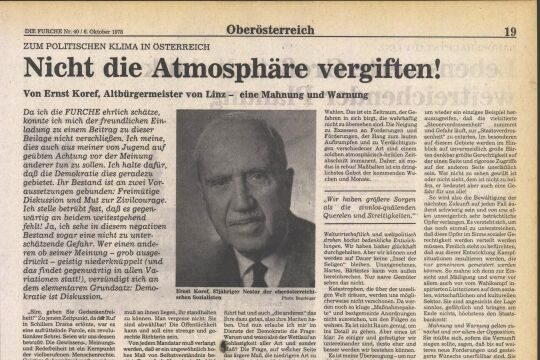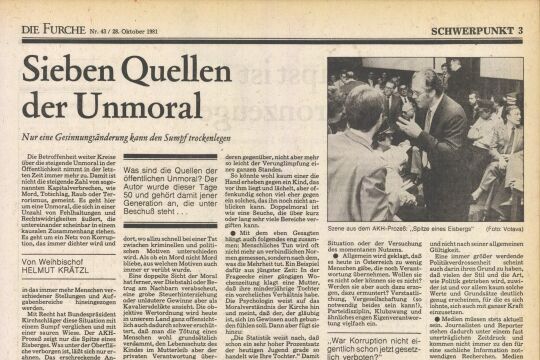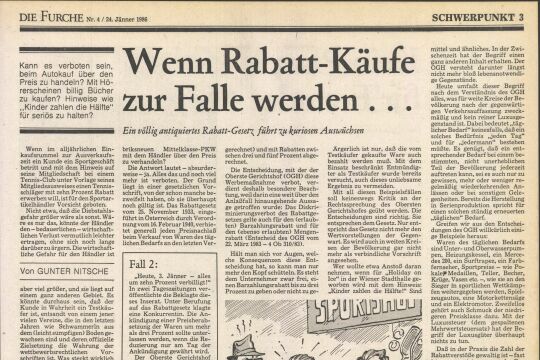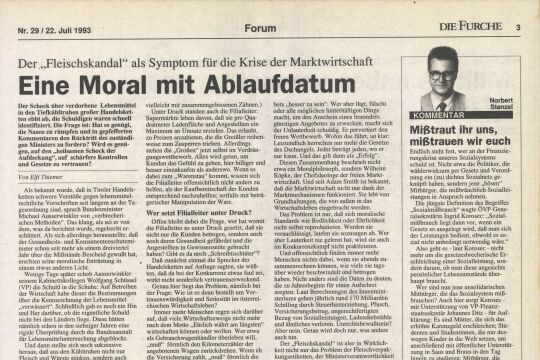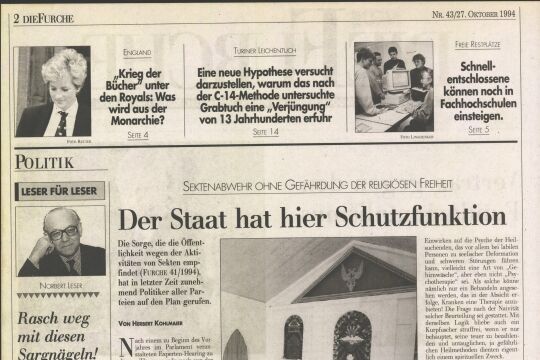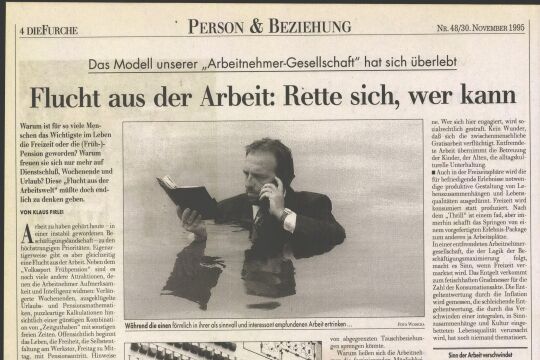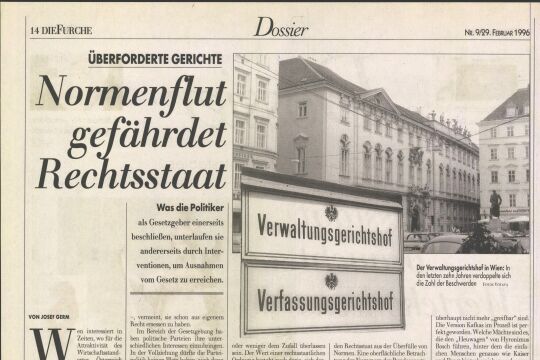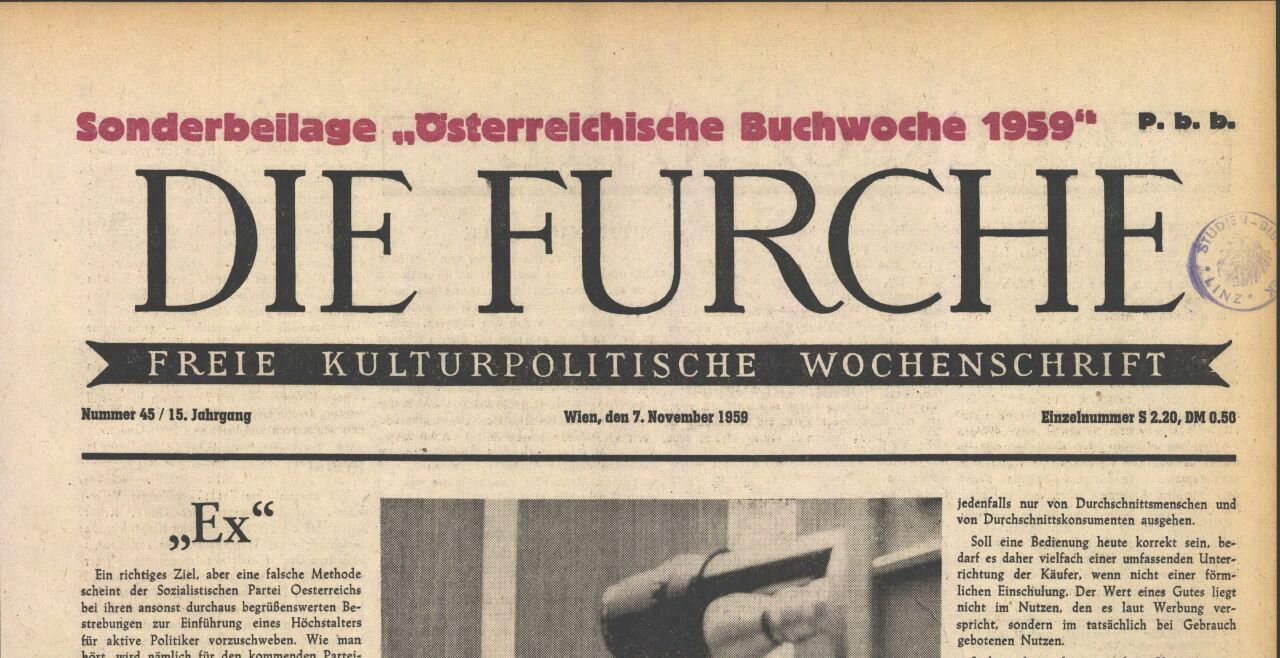
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Ungeschützten
Nach außen hin ist unsere Gesellschaft eine Kooperation von Interessenverbänden. Dienstnehmer wie Dienstgeber sind zu Interessentengruppen zusammengeschlossen und bemüht, einen ihnen angemessen scheinenden Anteil am Sozialprodukt zu erhalten. Nur eine „Gruppe" von Interessenten, der eigentlich alle Staatsbürger angehören, ist gerade wegen der Allgemeinheit ihres Charakters nicht organisierbar: die Konsumenten. Man kann dagegen sagen: Den Konsumenten schützen ohnedies die Gesetzgebung und die zuständigen Behörden. So haben wir u. a. ein Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, es gibt Preisbestimmungen und eine Preisüberwachung. Ebenso kann sich der Konsument bei offensichtlicher Uebervor- teilung gerichtlich schützen.
Nun erweist es sich aber in der Praxis, daß der gesetzliche Schutz unzureichend ist, und dies um so mehr, je größere Teile des Einkom mens infolge seines relativen Ansteigens von der Bindung an die Existenzbedürfnisse frei und daher mit leichterer Hand ausgegeben werden. Im „Informationsdienst“ (September 1959) des Verbandes der österreichischen Konsumentenvereinigungen, einer Organisation, hinter der OeGB und Arbeiterkcmmern stehen, wird nun die Schaffung eines Konsumentenschutzpesetzes vorgeschlagen. Wie steht es damit?
Das für den Gebrauch der auf den Markt gebrachten Güter erforderliche Konsumwissen ist nur in einem unzureichenden Umfang vorhanden. Das gilt übrigens schon für die Spielzeuge, die mehr und mehr solche für Erwachsene werden, während die Kinder jene Gegenstände zum Spielen benützen, die eh und je kindliche Phantasie angeregt haben. Bei Haus haltsgegenständen sind zuweilen Sachkenntnisse notwendig, die der Durchscnnittskonsumem nicht haben kann und muß. Das Gesetz kann jedenfalls nur von Durchschnittsmenschen und von Durchschnittskonsumenten ausgehen.
Soll eine Bedienung heute korrekt sein, bedarf es daher vielfach einer umfassenden Unterrichtung der Käufer, wenn nicht einer förmlichen Einschulung. Der Wert eines Gutes liegt nicht im' Nutzen, den es laut Werbung verspricht, sondern im tatsächlich bei Gebrauch gebotenen Nutzen.
Insbesondere geht es nun beim Konsumentenschutz um den Qualitätsschutz. Das bedeutet beispielsweise, daß der Verkäufer bei manchen Gütern durch längere Zeit als bisher für die Qualität einer Ware garantieren muß. Der Verkäufer haftet nun für die Güte einer Ware. Was ist aber bei vielen neuartigen Waren unter „Güte“ zu verstehen? Vermag die Etikettierung einen ausreichenden Gütehinweis zu geben? Ist die Gütegarantie dem Käufer gegenüber so formuliert, daß er eine eindeutige Qualitätsvor- stellung erhält und dementsprechend auch die Angemessenheit des Preises beurteilen kann? Es sei da an die unterschiedlichen Auffassungen über das, was man als „reine Wolle" deklarieren kann, erinnert! Vielfach messen die Käufer einer Ware Eigenschaften bei, die der bisweilen zurückhaltende und plötzlich schweigsame Verkäufer nicht ausdrücklich zusagt, aber auch nicht abstreitet. Nun kann der Verkäufer nicht gezwungen werden, bei jedem Verkauf Atteste auszustellen, die Beweischarakter haben. Ist ein Mangel „Ungewöhnlich", kann sich der Käufer freilich wehren. Wann aber ist diese „Ungewöhnlichkeit" gegeben (siehe Dr. Kinigadner in „Steuer- und Wirtschaftskartei“ 20 59)?
Ebenso wie die Forderung nach Qualitätsschutz ist das Verlangen, das Vertreterunwesen zu behindern, durchaus gerechtfertigt. Die Art, wie manche Vertreter keineswegs kaufwillige Hausfrauen zu einem Kaufabschluß bringen, ist nicht korrekt. Die Gültigkeit der Unterschrift auf einem Großteil der Kaufverträge, die oft vor der Wohnungstüre abgeschlossen werden, muß bestritten werden. Ein Vertrag gilt als zustande gekommen, wenn eine übereinstimmende Willenserklärung vorliegt. Wie ist aber eine Uebereinstimmung möglich, wenn die „Heimgesuchten" von Vertretern über den tatsächlichen Inhalt des Vertrages getäuscht werden, ganz abgesehen davon, daß vielfach versucht wird, die Betroffenen vom Lesen der Vertragsbedingungen abzuhalten?
Dazu kommt noch, daß gutmütige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bewogen werden, Empfehlungsschreiben für den Verkauf von privat vertriebenen Waren auszustellen, deren Preise in keinem Verhältnis zu ihrem Wert stehen.
Manche Unternehmergruppen sehen nun — und nicht zu Unrecht — im Vorschlag, ein Konsumentenschutzgesetz zu schaffen, so etwas wie eine neue Form des Dirigismus und der Bedrohung ihres Handelns. Nun soll aber nicht allein der Konsument gegen den Verkäufer schlechtweg geschützt werden, sondern auch der faire, Kaufmann gegen eine Konkurrenz, die Lücken des Gesetzes benutzt, nicht allein, um Käufer, sondern auch Mitkonkurrenten zu Übervorteilen. Gerade die Zeitungen der Gewerbetreibenden beklagen mit Recht das Ueberhand- nehmen von Verkaufsmethoden, die man keinesfalls als seriös bezeichnen, aber mit den vorhandenen Gesetzen kaum abstellen kann.
Wir haben keine als solche deklarierte Wuchergesetzgebung. Trotzdem gibt es Wucher. Wäre es nicht angezeigt, sich ernstlich mit der Frage zu befassen, wie den Massen das, was sie an Zuwachs von Nationaleinkommen gewonnen haben, zu erhalten und das Einkommen in seiner Wirkung auch von einer gesetzlichen Qualitätsabsicherung her zu erhöhen wäre?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!