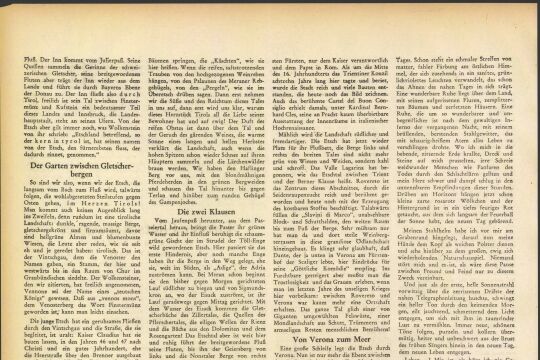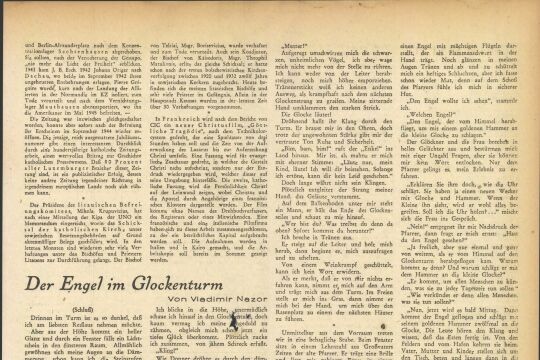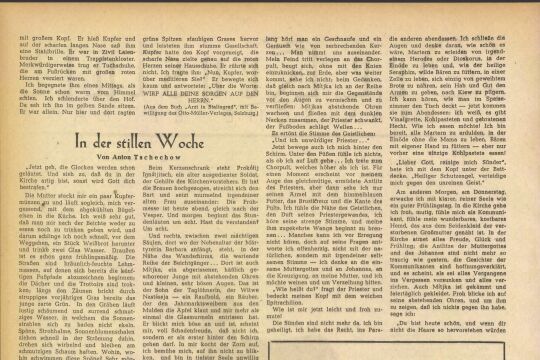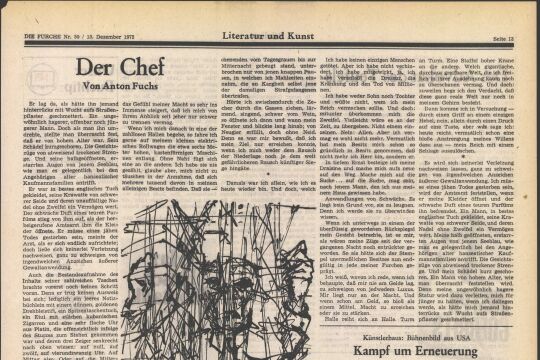Wie herrlich ist es doch, wenn ich mich spät an Sornmerabenden unter der Tornadobrücke zurechtlege.
Meine Arme hinter dem Kopf verschränkt starre ich empor zu den komplizierten Verstrebungen der Bo-genträger und lausche dem Donner der Wagenkolonnen und Straßenbahnzüge hoch über mir und dem Rauschen der Wasser gegen die mächtigen Pfeiler.
Beiderseits der Brücke weithin bestirnter Himmel. Am anderen Ufer die bekannten Konturen der Häuserzeilen mit ihren erleuchteten und blinden Fenstern. Davor dehnen sich die Laternenreihen der Promenade nach beiden Richtungen bis in tiefe Fernen. Hebe ich aber das Haupt, so daß mein bärtiges Kinn den Shawl berührt, so kann ich überdies den Widerschein der Lichter auf den schwarzen, unruhigen Fluten des Stromes eine Weile beobachten, ehe ich mich ermattet zurücksinken lasse.
Wie immer habe ich meinen hageren Leib in mehrere Schichten von Zeitungsblättern angelsächsischen Formats eingewickelt und, nicht zu straff, mit Gummibändern verschnürt. An diese Hülle schließen außen zwei, wenn es kälter wird: drei, in strengen Wintern bis zu sieben Lagen festen Packpapiers, dessen weit überlappende Ränder ich mit Heftklammern und Klebestreifen zusammenfüge. Meine ausgestreckten Beine, gleichfalls in Zei-tungsblä'tter gehüllt, stecken zusätzlich noch in einem an seiner Innenseite sorgfältig ausgebürsteten Zementsack, den ich um die Knöchel sowie dicht uniter den Knien und schließlich um die Mitte meiner Oberschenkel mit Schuhbändern festzubinden pflege.
Habe ich dieses Stadium meiner Verpuppung erreicht, schalte ich gewöhnlich eine Atempause ein, ehe ich meine Ärmelschoner anlege, beide Ohren mit Wachspfropfen schließe und meine Pelzmütze aufsetze. Dann erst wälze ich mich auf die zu meiner Linken ausgebreitete Zeltbahn, um mich, mittels ruckartiger Bewegungen, möglichst eng in sie einzurollen und zuletzt meinen Hinterkopf auf den bereitgelegten Rasenziegel zu betten.
War das wieder ein Tag heute!
Alter Gewohnheit zufolge schlafe ich nie sogleich ein, sondern nütze die letzte Zeitspanne meines Bewußtseins, mir die Ereignisse des eben zurückgelegten Tages zu vergegenwärtigen.
Wie ließ sich der Morgen an? Worüber lehrte ich in meiner vormittäglichen Hauptvorlesung? Habe ich es auch verstanden, meinen Gegenstand fesselnd zu gestalten? Und war ich gerecht, anschließend beim Examen? Durchschaute ich jeweils das wirkliche Wissen? Oder ließ ich mich täuschen: Sei es durch die Redegewandtheit des einen Kandidaten, seTs durch die Geschicklichkeit eines anderen, mich auf ein Gebiet abzudrängen, das er zwar beherrschte, um das ich ihn aber im Grunde gar nicht gefragt hatte?
Wieder kann ich nicht umhin, im Geist meine Prüfungsprotokolle durchzublättern. Welch schwerwiegende Entscheidungen! Aller Erfahrung zum Trotz fühle ich mich ihnen bis heute nicht gewachsen.
Ich dehne mich auf dieser meiner sogenannten Mutter Erde.
Ringsum rauhes, graues Gras. Kräuter, die ihren eigenständigen Duft längst verlören haben. Denn hier gibts nur mehr Geruch nach Staub, Wind, fauligem Wasser und den Exkrementen der Hunde.
Noch sind die Nächte warm. Bald aber kommt der Herbst. Der Mond steht tief. Der Schatten eines Schachtelhalms hat sich auf meine Brust gelegt. Nun sollte bald der Schlaf mich übermannen.
Allein ich finde keine Ruh. Denn der Gedanke an meine Studenten läßt mich nicht los. Wenn ich im steilen Halbrund meines Hörsaals die Bankreihen empor blicke, ist es mir, als hörten sie mir kaum noch zu, als unterhielten sie sich völlig ungeniert, ja als fiele da und dort eine abfällige Bemerkung, worauf jedesmal eine Welle Gelächters aufrauscht. Dann kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß sie gegen mich eine Verschwörung planen, an der selbst die Assistenten in meinem Rücken nicht unbeteiligt sind. Denn einmal, als ich mich jählings umwandte, ertappte ich einen von ihnen, der eben die Hand zum Schlag gegen mich erhoben hatte.
Oder sollte ich mich täuschen?
Noch tiefer freilich ist die Kluft, die mich von manchen meiner Kollegen trennt. Ihr Starrsinn, ihre eitlen, geradezu kindischen Eifersüchteleien verblüffen mich stets aufs Neue. Namentlich einer von ihnen — ein im übrigen angesehener Pathologe — genießt seinen Ruf, bei Prüfungen gänzlich unberechenbar zu sein. Ist es nicht bezeichnend, daß gerade er am Stadtrand eine Hütte aus Ästen und Blattwerk bewohnen soll? Welch bedenkliche Uberschätzung des Komforts! Und welche Enge!
Wie herrlich weit ist doch mein Bett dagegen! Wie frisch mein Morgen, wenn Nebel auf dem Strome treiben und schwer der Tau auf Gräsern liegt. Dann falte ich bebend vor Kälte all meine Hüllen zusammen und verstecke sie immer unter dem gleichen Stein, bevor ich mich auf meinen Weg durch hallend leere Gassen mache.
Dann freue ich mich stets auf meinen Mittag und sehe mich schon rittlings sitzen auf der gewohnten Bank im Park. Vor mir ausgebreitet, was ich in Abfalltonnen und Papierkörben gefunden: Halbe Brotlaibe, Wurstzipfel, Käsestücke, von deren Rändern jeweils nur ein weniges mit dem Messer abzuschaben ist. Kirschkuchen, Gebratenes... Und nach dem Mahle in behaglich tiefen Zügen eine Zigarette, die ich mir aus Zeitungspapier und aufgelesenen Stummeln drehe. Denn wir leben in einer Zeit hohen Wohlstands, an dem selbst ein Mann der Wissenschaften teilhaben darf; wenn auch, wie sich versteht, in Grenzen und ohne festen Wohnsitz, wie es einem Manne meines Standes geziemt.
Gewiß, selbst ich werde zuweilen bestohlen, namentlich von den Begüterten. Jedoch nur, wenn ihnen die Mittel knapp werden. Aber war nicht der Diebstahl seit jeher ihr erstes Vorrecht? Ein zweites, daß ihr Gewissen dabei rein bleibt? Und ihr drittes endlich, daß sie überall und allezeit in höchstem Ansehen stehen?
Wenn ich das Wachs in meinen Ohren lockere, kann ich bei günstigem Wind aus den Bars hinter mir ihre Musik hören; gedämpft, monoton, Stunde um Stunde. Welch kostbare Zeiträume! Ich stelle mir vor, wie sie gedrängt beisammensitzen. Wärme, Lichter, Rauch, das Gewirr ihrer Stimmen. Und ich bin ihnen gut. Denn über alles ziehe ich meine Nächte unter dieser hohen Brücke vor; mit all ihrem herben Wind, der Finsternis, dem Rauschen des Stromes. Ich: allein mitten im Lärm unserer Stadt.
Manchmal erwache ich gegen vier, wenn sie gröhlend zu ihren Wagen ziehen. Dann kommt es wohl vor, daß ich ein Tappen höre. Die Böschung herab. Als hätte sich wer in meine Nähe verirrt. Fin Flüstern, Gekicher. Dazwischen Stille, so daß ich zunächst nicht im Bilde bin. Bis mir eine rhythmische Bewegung, ein Keuchen und Stöhnen die letzten Zweifel nimmt. Erinnerungen tauchen auf: an jene ferne Zeit, als ich noch Kinder zeugte. Erinnerungen, kostbar, doch ohne jeglichen Affekt; verharren eine Weile, klingen wieder ab.
Nein, meine Nächte sind nichts weniger als arm an Abwechslung.
Manchmal erwache ich und höre lang den Regen rauschen.
Ein andermal fällt lautlos Schnee.
Wieder ein anderes Mal gibts Sturm. Dann heult es zwischen den Traversen über mir und peitscht das hohe Gras. Die Sträucher ducken sich verwirrt. Blätter eilen eiligst an mir vorbei. Und einmal hörte ich es geräuschvoll daherstelzen, geradewegs auf mich zu. Es war ein Zeitungsblatt, das sich an meinem Kopf verfing, mich kurz und kräftigst ohrfeigte, ehe es wedterhastete, sich überschlug, die Böschung hinab, um mit einem Satz ins Wasser zu springen, wo es flach sich ausbreitete und im Davontreiben ertrank.
Nichts aber liebe ich mehr als ein Gewitter. Ein kalter Windstoß hat mich aufgeweckt. Geruch nach Staub, nach ersten schweren Tropfen. Blitze erhellen augenblickslang die blinden Häuserzeilen wie Kulissen. Unmittelbar danach, in pechschwarzer Finsternis, ein Knistern und dann das gewaltige Krachen des Donners, dessen Widerhall sich vielfach an der Brücke und den steinernen Fronten bricht. Mit voller Wucht hat ein Platzregen eingesetzt. Ich richte mich in meinen Hüllen auf. Ich atme tief die jäh erfrischte Luft. Und schlägt eben ein neuer Blitz ein, so sehe ich die Oberfläche des Wassers im scharfen Geprassel des Regens vor mir liegen, gleich einer weitgespannten Gänsehaut.
Doch auch die stillen Nächte schätze ich. Vor allem aber meinen Freund, den Mond. Von fernem Horizont steigt er nach und nach empor bis zu einem Rand der Brücke, wo er verschwindet. Nun warte ich, lange, ohne mich zu regen... Bis er am anderen Rand der Brücke wieder auftaucht und nach und nach hinab sinkt bis zum fernen Horizont. Sein Emst, sein bedingungsloser Gehorsam gegen das Gesetz hat etwas faszinierendes und zugleich lächerliches. Warum — so fragte ich ihn einst im Peber 1969, als Eisschollen glitzernd unter mir vorüberzogen — warum weigerst du dich nie, deine Bahn anzutreten? Wie kommt es, daß du niemals stehenbleibst, und wäre es auch nur für einen einzigen Augenblick?
Heute freilich lehne ich es ab, zu fragen, wo es keine Antwort gibt. Den Kopf zur Seite gewandt, starre ich stumm ins hohe, finstere Gras, als blickte ich, in entsprechend vergrößertem Maßstab, in Urwälder ohne Ende. Früher, als ich noch meinen Kerzenstummel besaß, zündete ich ihn gerne im Schutz zweier verrußter Backsteine an. Dann entdeckte ich im flackernden Schein Schneisen, darin Ameisen kamen und gingen. Und einmal starrte mir ein gründlich schillernder Käfer lange gebannt in die Augen, ehe er sich mit schwankendem Hinterteil davonmachte. Ich kann sein Bild nicht mehr verscheuchen, obgleich er sicher lange schon vermodert ist.
In den letzten Jahren hat mein Interesse an der Gegenwart zusehends nachgelassen. Statt dessen verliere ich mich immer häufiger in die Tiefen der Vergangenheit. Dann kann ich nicht umhin, mein Leben zu überschauen: Reich an Tätigkeit, Forschung, Experimenten, wissenschaftlichen Abhandlungen; aber auch an Stunden der Muße und an Reisen in andere Kontinente, durchwegs zu Fuß zurückgelegt.
Du hast erreicht, wovon du als junger Mann geträumt. Es ist nicht nötig, die alten Photographien hervorzukramen: Von meiner Promotion, als Assistent sodann, als ordentlicher Professor, dann als Dekan, als Rektor gar; und dies nicht nur in einer Amtsperiode.
Einst wird auch deine Büste sich zu den anderen in der Aula gesellen — sage ich mir, ohne die Lippen zu bewegen.
Dann lösche ich, indem ich meine Augen schließe, die letzten Lichter. Ein vereinzelter Wagen. Von Weitem höre ich ihn kommen und lausche ihm lange nach; im steinalten Gesicht am Seidenband meinen Zwicker, den ich selbst im Schlaf nicht mehr abnehme.
So liege ich seit Jahrzehnten hier.
Wieviele Nächte schon?
Wieviele Nächte noch?
Ich bin nun neunundneunzdg Jahre, neun Monate, neun Tage alt. Und ich blicke ohne Sorge in die Zukunft. Im Gegensatz zu meinen Kollegen kann ich mich nicht über Schlaflosigkeit beklagen. Jeden Morgen erhebe ich mich ein wenig später und jeden Abend lege ich mich ein wenig früher hin als am Tag zuvor. So nimmt nach und nach die Dauer meines Wachseins ab, im gleichen Maß, als die meines Schlafes wächst. Schon sehe ich jenem Mittag entgegen, an dem ich nur mehr eine halbe, und dem nächsten, an dem ich nur mehr eine viertel Stunde bei Bewußtsein bin. Bis endlich der Tag anbrechen wird, an dem ich aus den Tiefen meines Schlafes nicht mehr aufzutauchen vermag.
Möge es dann nicht an barmherzigen Händen fehlen, die meinen dürren Leib in den Strom kippen, der ihn, ohne Eile, durch zahllose Tage und Nächte hinab treibt zum Schwarzen Meer.