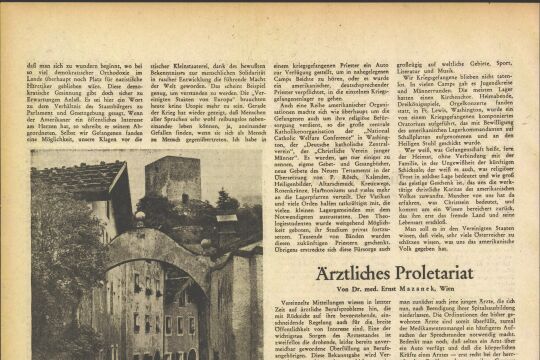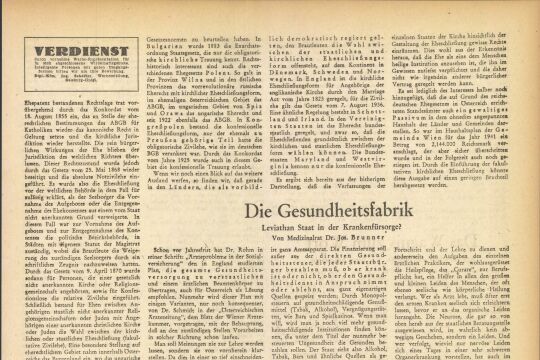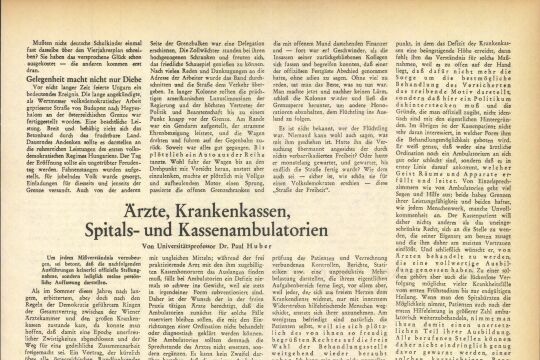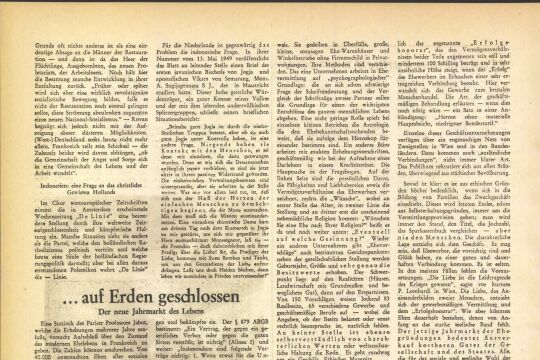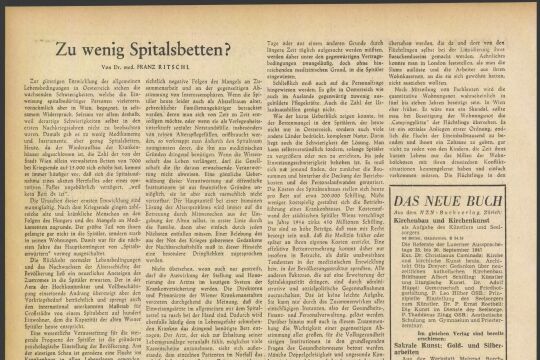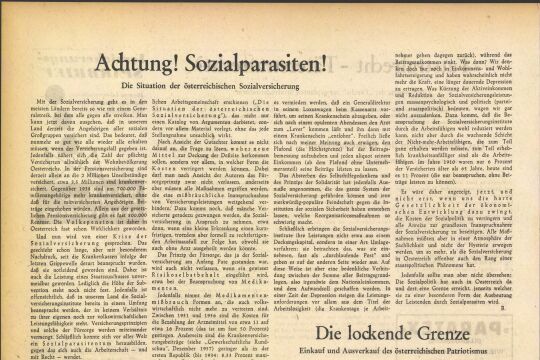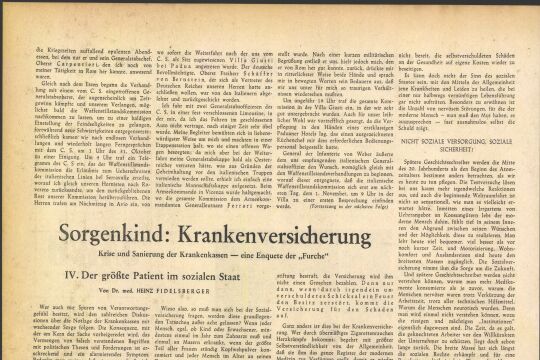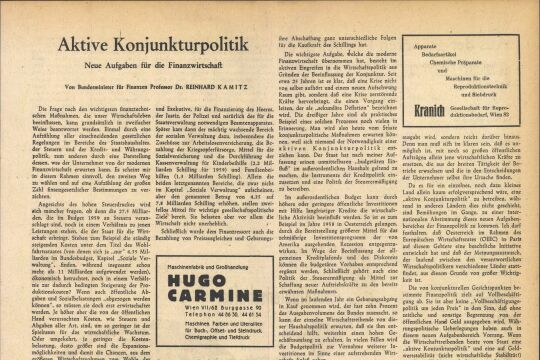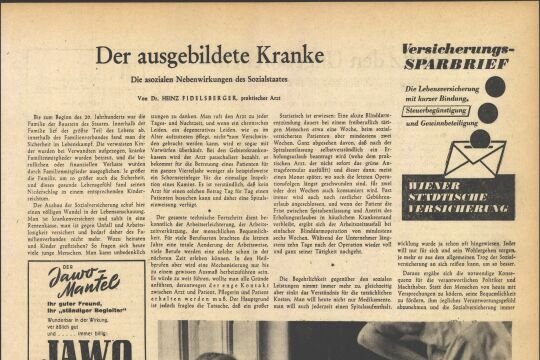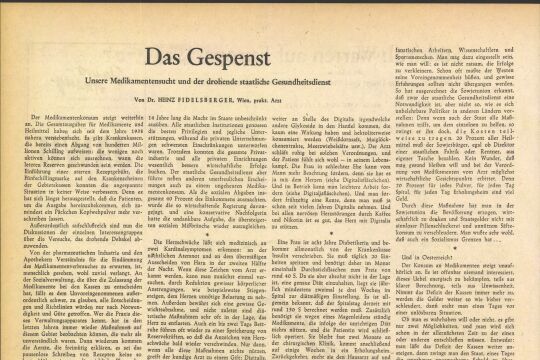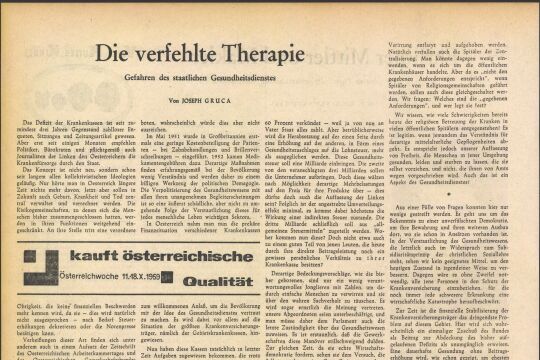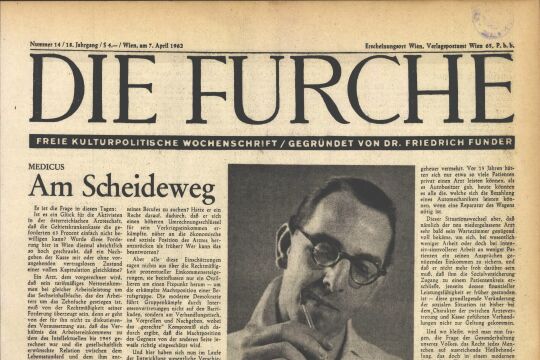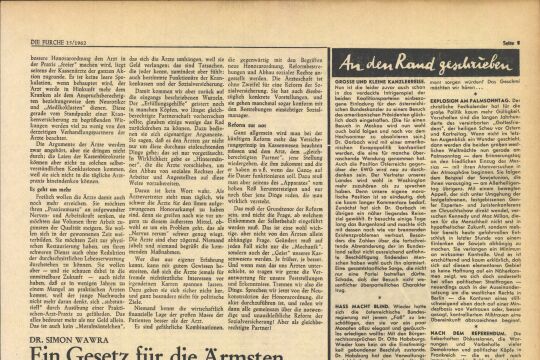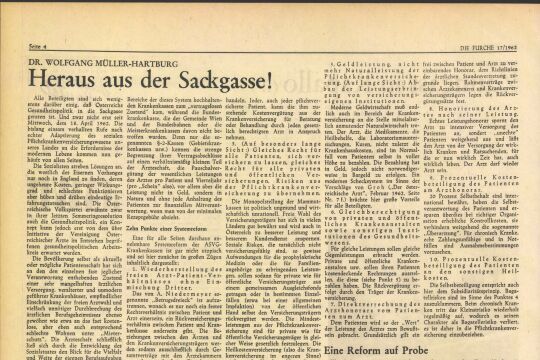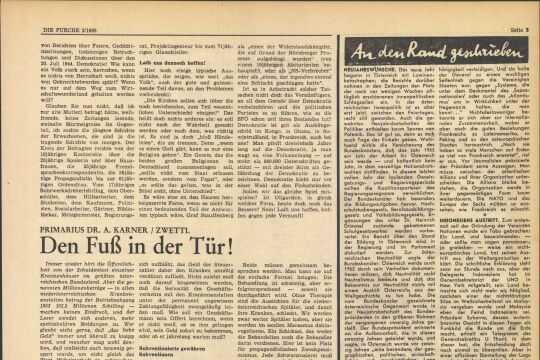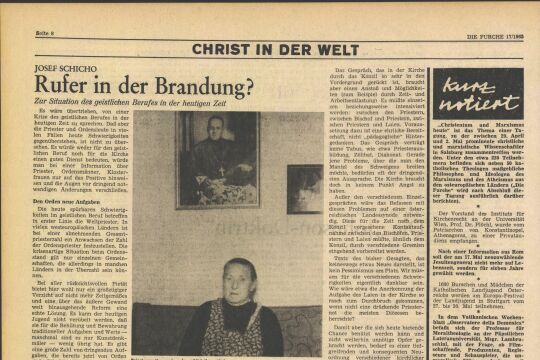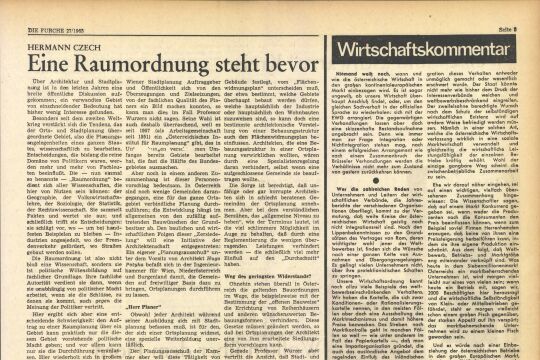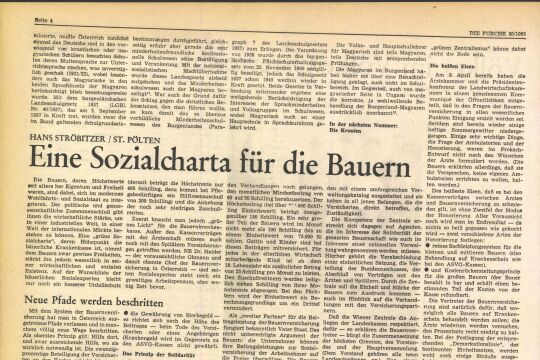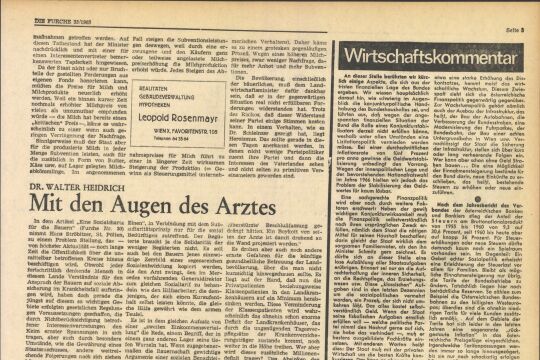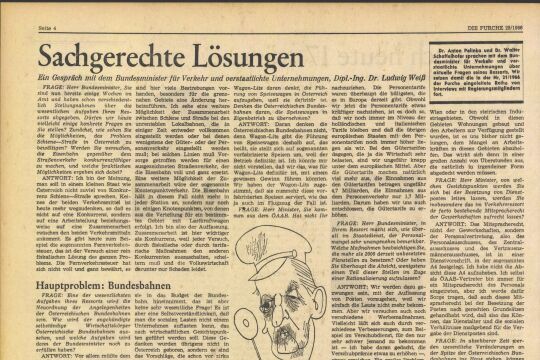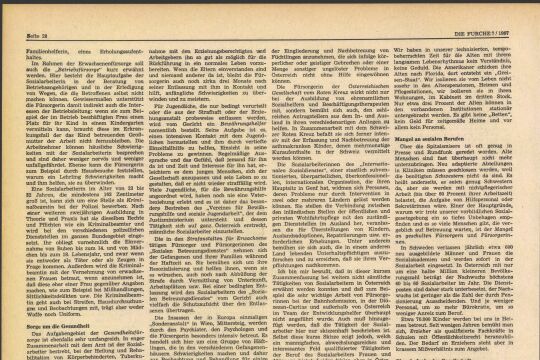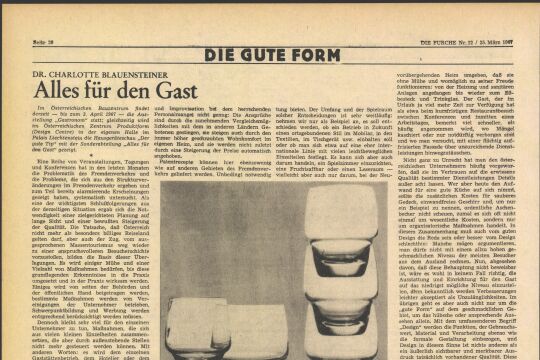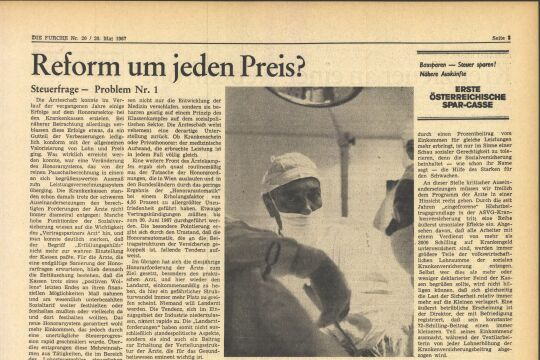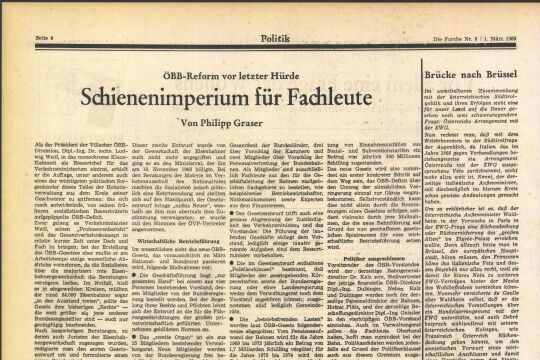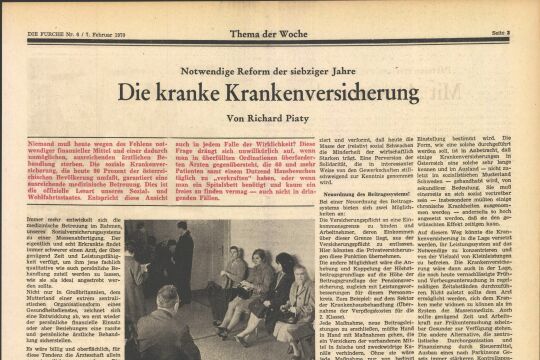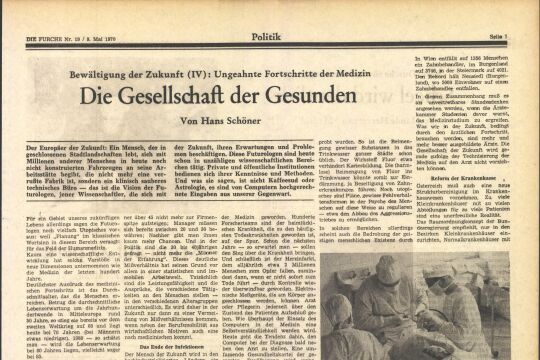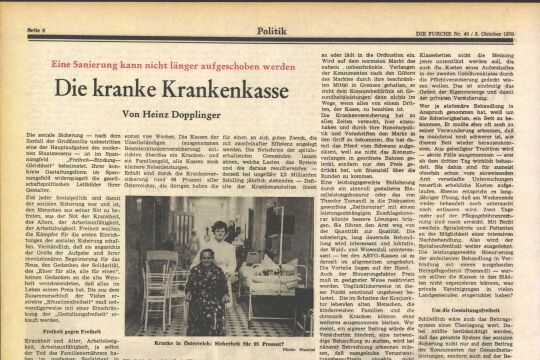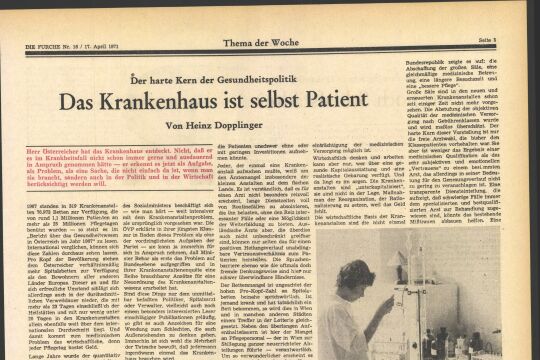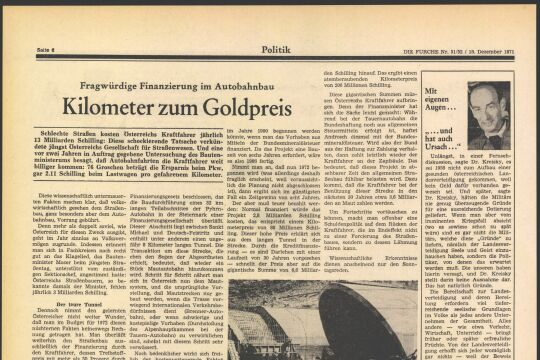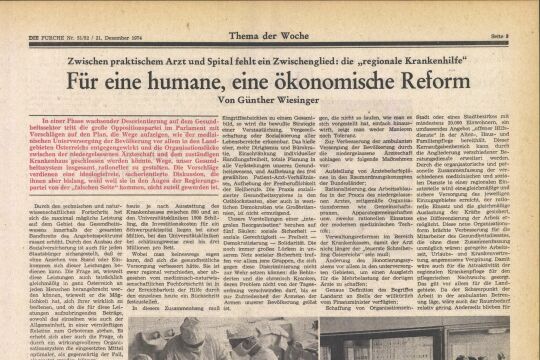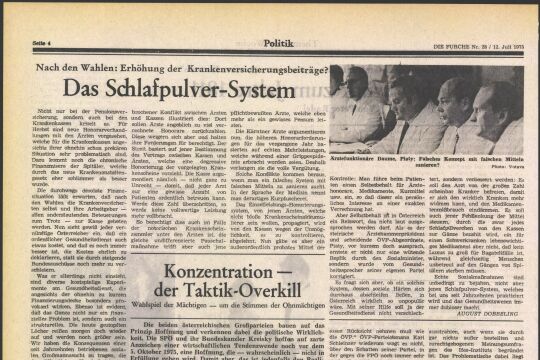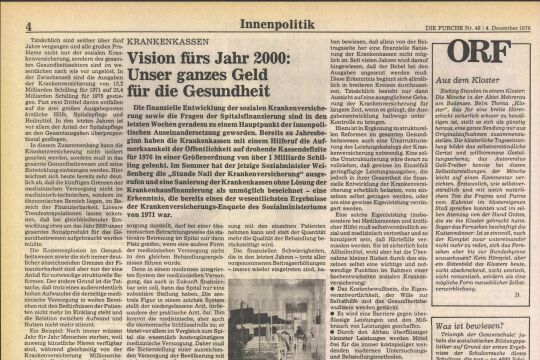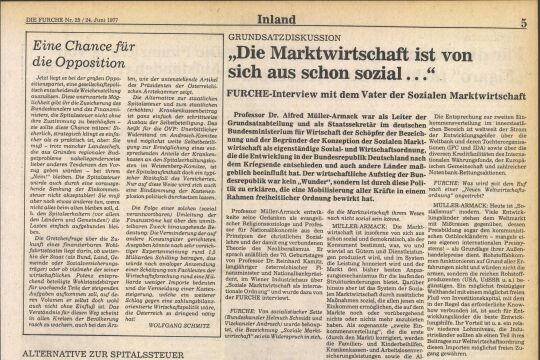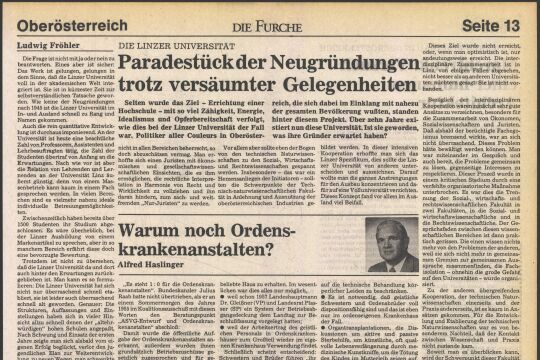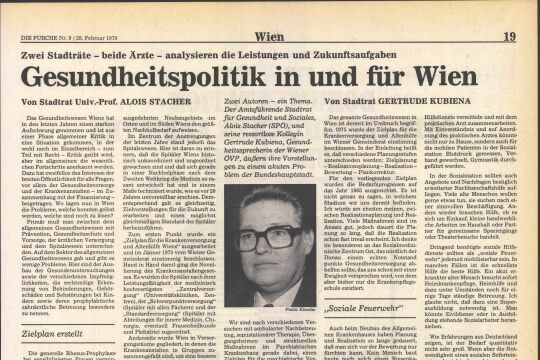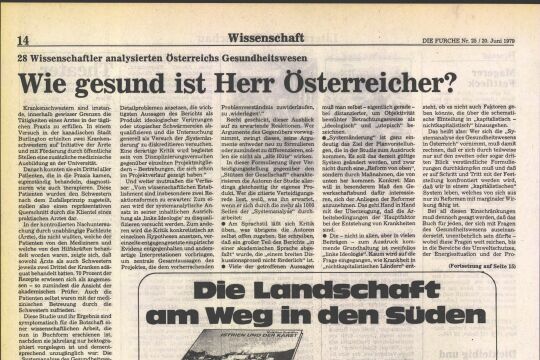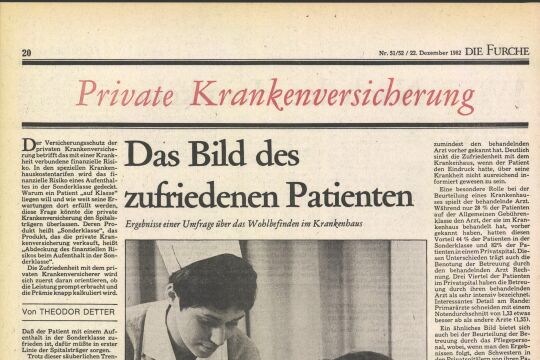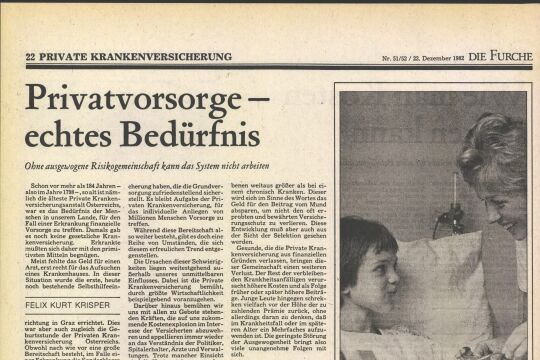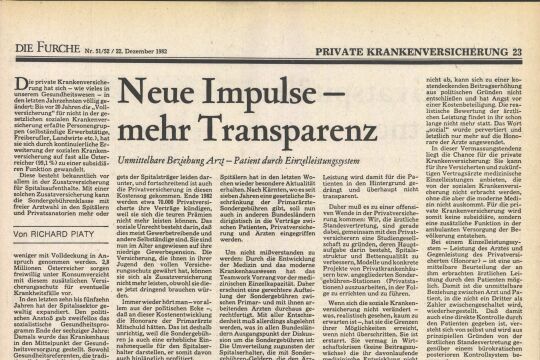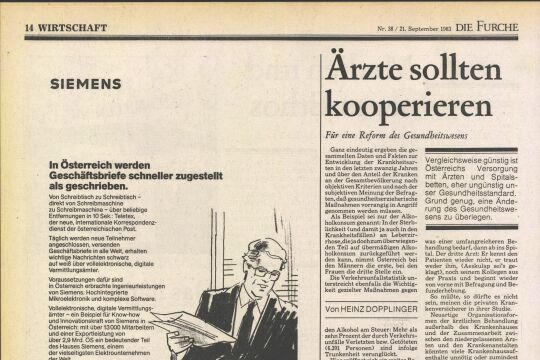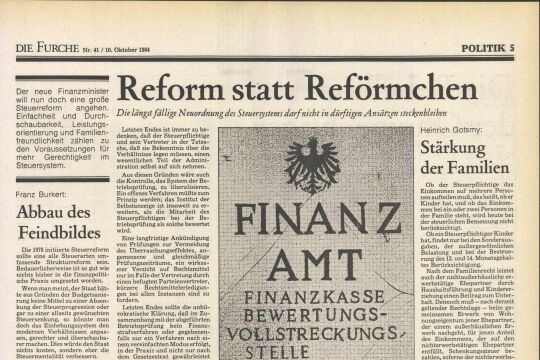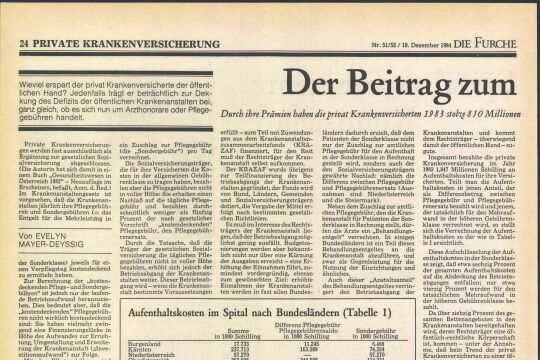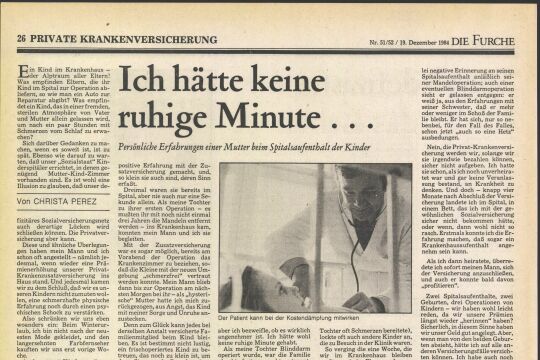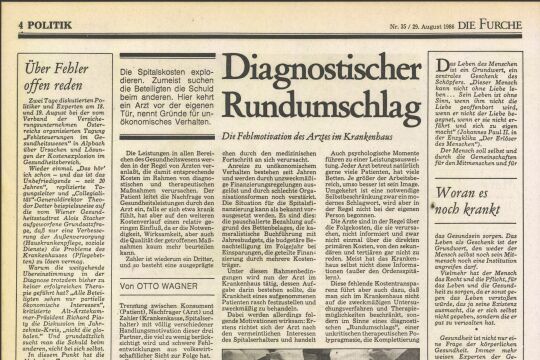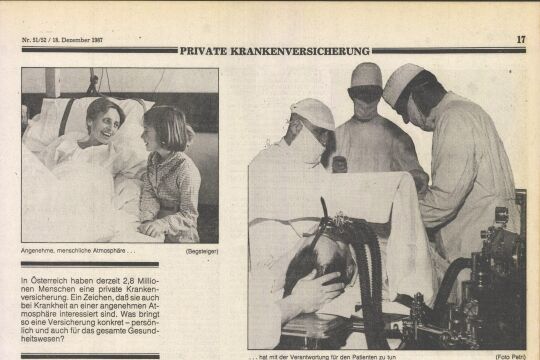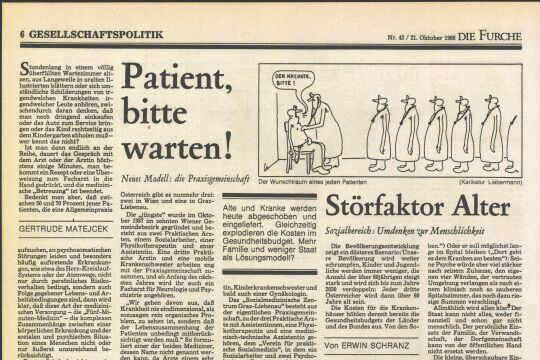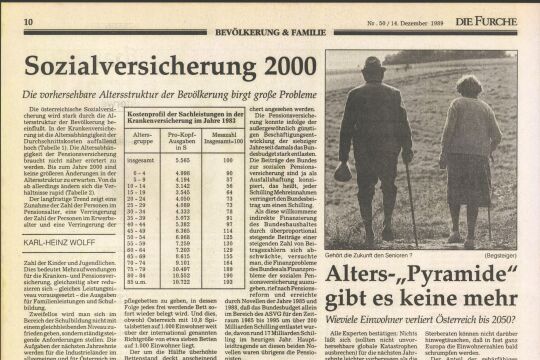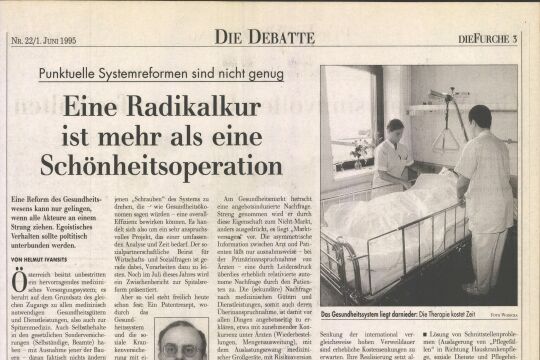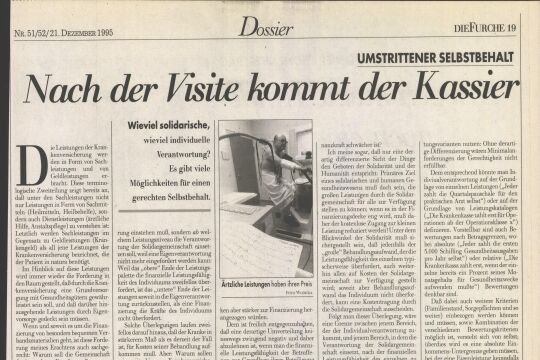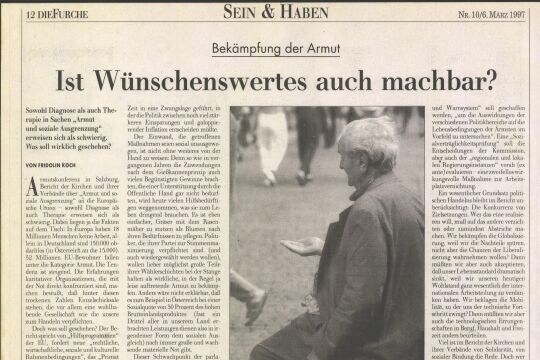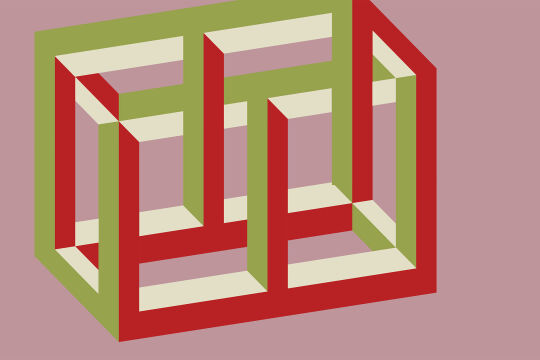Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Rechenstift gegen Chirurgenmesser
„Evolution und die Zukunft der Menschheit” war das Generalthema des diesjährigen Forums Alpbach. Ein Problemkreis beschäftigte sich mit der Frage: Wie soll es mit unserem Gesundheitssystem weitergehen?
„Evolution und die Zukunft der Menschheit” war das Generalthema des diesjährigen Forums Alpbach. Ein Problemkreis beschäftigte sich mit der Frage: Wie soll es mit unserem Gesundheitssystem weitergehen?
Politiker, so sagt man, haben ein gestörtes Verhältnis zu absoluten Zahlen. Sie steigen jährlich, und man findet das nicht weiter bedrohlich, solange alle Zahlen im Gleichschritt steigen.
Hellhörig werden Politiker aber, wenn sich die Gewichte deutlich und langfristig verschieben, wenn also der Anteil der Gesundheitsausgaben an den Landesbudgets kontinuierlich steigt. Die Ursachen sind aber komplex und erfordern komplexe Lösungen, Politiker dagegen lieben einfache Lösungen. Eine solche einfache Lösung ist jetzt in aller Munde: „Budgeting” —die Bereitstellung von geringeren Finanzmitteln bzw. ein vorgegebenes geringes jährliches Wachstum dieser Mittel. Vereinfacht gesagt, die „Deckel-drauf ”-Methode.
Die — zugegeben mühsamere — Alternative zu dieser Methode ist die Analyse der bestehenden Anreize im Gesundheitswesen und ihre zielgerichtete Veränderung. Ziel der Anreize ist die wirtschaftliche Inanspruchnahme der Leistungen im Gesundheitswesen. Wirtschaftlich heißt die Vermeidung nicht notwendiger Inanspruchnahmen und die Wahl.der kostengünstigeren Methode bei gleicher Wirksamkeit. Zwei Ansatzpunkte gibt es grundsätzlich für die Steuerung der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen:
# Die direkte Steuerung über die Brieftasche des Nachfragenden fund
# die Steuerung der Inanspruchnahme über ein differenziertes Angebot.
Wenn man davon ausgeht, daß es in keinem Fall zu Verminderung von Heilungschancen kommen darf, ist nur der Bereich der objektiv nicht nötigen Inanspruchnahme von Ressourcen Ziel einer solchen Nachfragesteuerung über das Geld. Man ist geneigt, diesen Spielraum als gering anzusehen. Wer geht schon zum Arzt, wenn er sich nicht krank fühlt, wer legt sich schon gerne ins Spital, wird hier häufig eingewendet. Der nachfragesteuernde Effekt von Kostenbeteiligungsund Selbstbehaltsmodellen darf in der Tat nicht überschätzt werden. Ein Bereich sind beispielsweise die Medikamente. Eine Studie des Europäischen Dachverbandes der Privaten Krankenversicherer, die heuer fertiggestellt wurde, zeigt, daß sich nach einer kurzen Schockzeit die Nachfrage wieder eingependelt hat. Es erscheint sinnvoll, über solche Modelle hinauszugehen und zwei weitere Möglichkeiten miteinzu-beziehen:
# die selektiven Leistungsausschlüsse und
# das Bonus-Malus-System. Das Bonus-Malus-System ist weitgehend bekannt und hat sich in anderen Versicherungssparten mehr oder weniger bewährt. Es handelt sich um Beitragszuschläge oder -abschlage nach dem Umfang des Leistungsanspruches des Vorjahres. Ob es auf das Gesundheitswesen übertragbar ist, wäre zu untersuchen.
Der Bereich der selektiven Leistungsausschlüsse dagegen ist heiß umstritten. Die gängigsten Ausschlußkategorien sind:
# Gesundheitsschäden, die durch ungesunde Lebensweise herbeigeführt werden (Alkohol, Nikotin, gefährlicher Sport),
# Leistungen, deren therapeutischer Wert umstritten ist (z. B. naturheilkundliche Behandlung),
# Leistungen, die über eine festzulegende Grundversorgung hinausgehen (Zahnersatz, Kuren) und
# sogenannte Bagatelleistungen, deren Selbsttragung finanziell zumutbar ist. Natürlich gibt es hier Abgrenzungsprobleme. Welche Sportarten weisen ein erhöhtes Risiko auf? Wie steht es mit der Ubergewichtigkeit oder mit der Sonnenbräune als Ursache von Hautkrebs? Was soll zur Beurteilung des therapeutischen Wertes herangezogen werden? Was sind Bagatelleistungen usw.?
Der zweite Ansatzpunkt zur Steuerung der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen nach der Brieftasche des Patienten ist das differenzierte Angebot.
Unmittelbare Adressaten solcher Anreize sind die Erbringer oder Vermittler des Angebots, also die Ärzte, die Spitalsträger und die privaten und öffentlichen Krankenversicherer. Bleiben wir beim Arzt. Welche Anreize wären denkbar, um das wirtschaftlich vernünftige Ziel zu erreichen, so viel ambulant wie möglich, so wenig stationär wie unbedingt notwendig?
Man könnte hier bei der Ausbildung beginnen. Wenn die praktische Ausbildung ausschließlich im Spital stattfindet, dann sollte es reicht wundern, daß niedergelassene Ärzte der stationären Heilbehandlung soviel Vertrauen entgegenbringen.
Auch der materielle Anreiz soll nicht übersehen werden. Bei einem Pauschalhonorar pro Fall und Quartal setzt der Arzt seine wichtigsten Leistungsfaktoren, Zeit und Know-how, dann am wirtschaftlichsten ein, wenn er möglichst viele Fälle, möglichst kurz und nur einmal pro Quartal bei sich durchschleust.
Hier muß man ansetzen. Sei es durch eine Beteiligung an Einsparungserfolgen im stationären Bereich, sei es durch Änderungen im Honorarsystem. Sei es aber auch durch organisatorische, fiskalische oder gesetzliche Maßnahmen, die darauf abzielen, derzeitige Vortlile eines stationären Aufenthaltes künftig auch mit ambulanter Behandlung zu verbinden: Dazu gehören Kooperationsformen niedergelassener Ärzte von der Gemeinschaftspraxis bis zum Ärztehaus mit angeschlossener Bettenstation für die Nachbehandlung.
Gewinnbeteiligung
Bleiben wir gleich im Spital und untersuchen die Anreize, die im bestehenden System auf den Spitalsverwalter wirken. Er verhält sich betriebswirtschaftlich ganz vernünftig: Gewinne darf er keine machen, er kann auch keine machen, da er von der Sozialversicherung im groben Schnitt nur die Hällfte des kostendeckenden Preises erhält. Die hohen Fixkosten bewirken, daß die Pflegegebührenersätze (Vgl. FURCHE Nr. 34) der Sozialversicherung immer noch einen positiven Deckungsbeitrag bringen und damit einen Anreiz zur Auslastung der bestehenden Kapazität bilden.
Das letztlich betroffene Budget ist das des Steuerzahlers. Er hätte Anreiz genug, eine Änderung zu wünschen. In groben Zügen sei eine solche skizziert:
• Festlegung leistungsabhängiger Normentgelte für verschiedene Diagnosegruppen.
• Diese Normentgelte sind so bemessen, daß damit bei wirtschaftlicher Führung das Auslangen gefunden wird, und zwar unter Einbeziehung aller betriebswirtschaftlichen Kosten.
• Dennoch entstehende Abgänge sind vom Träger zu finanzieren, Gewinne verbleiben dem Träger.
Der Autor ist Mitglied des Vorstandes der Wiener Holding Gesellschaft mbH. Der Beitrag zitiert auszugsweise einen Vortrag vor dem Europäischen Forum Alpbach 1985.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!