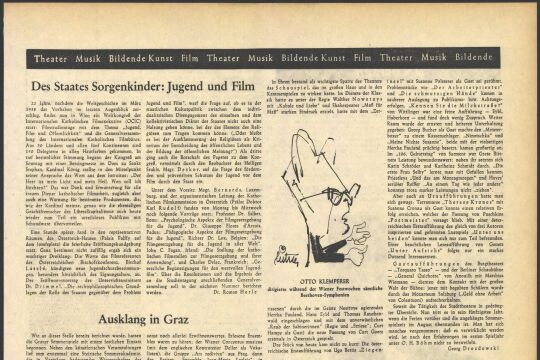Zu ihrem Sechziger setzte die Berlinale, das größte Filmfestival im deutschen Sprachraum, auf kleine Dramen anstatt auf großen Pomp.
Das Bienennest als karge und gefährliche Lebensgrundlage. Ein Konflikt in arktischer Einsamkeit. Ein Wiedersehen unter der Smog-Glocke Shanghais. Die Suche nach dem eigenen Glück, nach der Festigkeit der Familie, nach dem kleinen, persönlichen Lebensfrieden, all das verhandelten viele Filme dieser 60. Berlinale, ohne dabei zu vergessen, die großen politischen oder gesellschaftlichen Themen zu streifen. Zu streifen wohlgemerkt, denn die Zeit der Filme, die explizite politische Anliegen verfolgen, scheint erst mal vorbei zu sein. Selbst Michael Winterbottom („In This World“) erzählte diesmal mit „The Killer Inside Me“ lieber einen unnötig brutalen und uninspirierten Thriller, anstatt politisch zu werden.
Der Siegerfilm „Bal“ („Honig“) des türkischen Regisseurs Semih KaplanoØglu passte in diesen unaufgeregten, Star-armen Wettbewerb, weil er in seinen betörend schönen Naturbildern und seinem stoischen Fortgang das Leben auf nur wenige Konstanten herunterbricht: Der siebenjährige Yusuf, der in einer entlegenen Bergregion an der Schwarzmeerküste zur Schule geht, tut sich schwer im Unterricht.
„Bal“ – ein passender Siegerfilm
Lieber würde er mit seinem Vater durch die Wälder streifen und mit ihm gemeinsam den schwarzen Honig ernten, den der Imker dort zu gewinnen versucht. Dazu muss er in die höchsten Bäume steigen, um Bienenstöcke anzubringen – eine gefährliche Arbeit, die der Lebenserhaltung dient, mit einer tragischen Wendung, die das ganze kleine Lebensglück in Gefahr bringt. „Bal“ ist der letzte Teil von KaplanoØglus Trilogie, die Yusuf in verschiedenen Lebensaltern zeigt. Der Film wird nie zu direkt, lässt viel Raum für Ungesagtes. Ein passender Preisträger, den die Jury unter Werner Herzog einstimmig wählte.
Daneben ein ebenso imposant gefilmtes Kammerspiel aus Russland: „How I Ended This Summer“ von Alexej Popogrebskis (Darstellerpreis, Preis für künstlerische Einzelleistung an den Kameramann), der in einer meteorologischen Beobachtungsstation in karger arktischer Landschaft spielt. Zwei Männer fechten hier einen Kampf miteinander aus, weil der eine dem anderen den Funkspruch vom Tod seiner Familie nicht weitergibt. Auch hier berichten fantastische Bilder und eine reduzierte Erzählweise über die ganz privaten Dinge des Lebens.
Russland, China, Iran, Bosnien
Die kleine, eigene Welt ist auch Thema von „Tuan Yuan“ des Chinesen Wang Quan’an („Tuyas Hochzeit, Goldener Bär 2007). Diesmal erhielt seine Geschichte über ein jahrzehntelang getrenntes Liebespaar, das sich im Alter vor der Kulisse des modernen Shanghai wieder trifft, den Drehbuchpreis.
Viele Filme wählten islamische Gesellschaften als Hintergrund für ihre sehr persönlichen Geschichten. Der Iraner Rafi Pitts etwa, der sich in „The Hunter“ mit dem Leben im Iran unter Ahmadinedschad auseinandersetzt. Hier dienen die systemkritischen Anmerkungen nur als Kulisse für den ganz persönlichen Rachefeldzug eines Nachtwächters, der den Tod seiner Frau rächen will, die in einer Straßendemo umkam.
Die Bosnierin Jasmila ÇZbani´c (Goldener Bär 2006 für „Grbavica“) zeigt in „On the Path“, wie sich Menschen verändern, wenn Religion die Oberhand in ihrem Alltag erlangt. Erneut sehr privat, sehr intim – und doch stellvertretend für ein ganzes Land.
Nur der Regiepreis für Roman Polanski passt nicht so ganz in diesen sensibel austarierten Wettbewerb: Sein Thriller „The Ghostwriter“ glänzt durch Hochspannung – hat aber außer einem lauen politischen Hintergrund kein besonderes Anliegen. Polanski konnte sich den Preis wegen seines Hausarrests in der Schweiz bekanntlich nicht persönlich abholen.
Die österreichischen Koproduktionen im Wettbewerb, „Der Räuber“ (siehe Kritik links unten) und „Jud Süß – Film ohne Gewissen“ von Oskar Roehler, blieben ohne Preis. Letzterer verursachte ob seines zu lässigen Umgangs mit den historischen Fakten ein regelrechtes Pfeifkonzert im deutschen Feuilleton. Zu Unrecht allerdings: Denn die Entstehungsgeschichte des antisemitischen NS-Hetzfilms „Jud Süß“ (1940) von Veit Harlan, in der Tobias Moretti den Schauspieler Ferdinand Marian und seine Verantwortung als Mitwirkender an diesem Machwerk darstellt, hat auch mit dem zentralen Thema dieses Festivals zu tun: Er wählt nur andere, effektvollere stilistische Mittel, um zu illustrieren, wie sehr das persönliche Glück vom gesellschaftlichen und politischen Umfeld bestimmt werden kann.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!