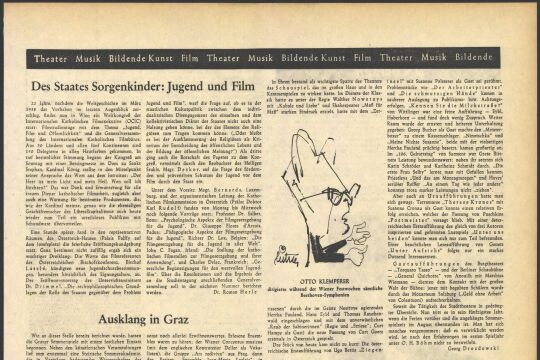Nischenkrisen
Überraschungssieger "Synonymes" bei der Berlinale 2019: In Dieter Kosslicks letztem Jahr dominiert erneut Nischenkino -was aber auch die Krise desselben manifest werden ließ.
Überraschungssieger "Synonymes" bei der Berlinale 2019: In Dieter Kosslicks letztem Jahr dominiert erneut Nischenkino -was aber auch die Krise desselben manifest werden ließ.
Die Berlinale hat sich zur Werkschau für Nischenkino entwickelt, das geht nun schon seit einigen Jahren so. Der Vorjahresgewinner "Touch Me Not" aus Rumänien war so experimentell, dass ihn in Deutschland nicht einmal 5000 Kinobesucher sehen wollten. Ein Tiefpunkt, was die Publikumsgunst anbelangt.
Auch heuer wird die Lage nicht viel anders sein, denn der völlig überraschend mit dem Goldenen Bären prämierte Film "Synonymes" des israelischen Regisseurs Nadav Lapid ist zwar nicht experimentell, dafür hat er -wie viele andere Filme dieser 69. Berlinale -ein sperriges politisches Grundthema: Es ist zum Teil die autobiografische Geschichte des Regisseurs, der nach seiner Zeit bei der israelischen Armee sein Land fluchtartig verlassen hat und nach Paris ging; voller Hass auf die eigene Nation versucht er, bewaffnet mit einem Synonymwörterbuch, Franzose zu werden und nicht mehr Hebräisch zu sprechen. Er kam ohne Papiere hierher, hatte keine Ahnung, was ihn erwartet und sein einziger Plan war, die eigene Heimat so schnell wie möglich hinter sich zu lassen. Die Gründe erfährt man nie; es hat aber wohl mit Ereignissen in der Armee zu tun.
"Synonymes" ist ein Film, der davon erzählt, wie schwer man seine eigene Her-
kunft verleugnen kann und wie herausfordernd es ist, in der Fremde heimisch zu werden; zugleich ist der Film auch ein Spiegelbild der israelischen Gesellschaft und ihrer Widersprüche. Lapids Held ist ein Verlorener, und manches an den Szenerien hat auch (unfreiwillig) Komisches; etwa bei der Einbürgerung die Marseillaise singen zu müssen, ist ein französisches Unikum. Die Berlinale hat unter Jurypräsidentin Juliette Binoche also wieder Nischenkino ausgezeichnet, dabei hatten sich auch andere Filme im Rennen um den Goldenen Bären in Stellung gebracht (und sind dabei um Nichts weniger in einer Nische daheim): Der chinesische Beitrag "So long, my son" von Wang Xiaoshuai galt bis zuletzt als Top-Favorit, wurde am Ende immerhin mit den beiden Schauspielerpreisen für Wang Jingchun und Yong Mei belohnt, die darin ein Ehepaar spielen, das durch vier Jahrzehnte hindurch begleitet wird. Der Film rechnet mit den gesellschaftlich oft fatalen Folgen von Chinas einstiger Ein-Kind-Politik ab und schildert, welche Pein der Verlust des einzigen Kindes sein kann. Wang Xiaoshuai entfacht im Laufe des dreistündigen Epos eine große erzählerische Kraft, die auch den Bären verdient gehabt hätte.
Verweigerte "Bären"
Auch Fatih Akin hätte einen Bären verdient, obwohl seine Adaption des Romans von Heinz Strunk, "Der goldene Handschuh", vielen hier sauer aufstieß. Dabei ist die Geschichte um den Frauenmörder Fritz Honka (abstoßend interpretiert von Jonas Dassler), der in den 70er-Jahren in der Frühbar "Der goldene Handschuh" auf der Reeperbahn seine alkoholisierten Opfer aufgabelte und bei sich daheim zerstückelte, wie eine schablonenhafte, holzschnittartige Skizze einer verfallenden Gesellschaft. Was die meisten deutschen Kritiker nun als Akins schlechtesten Film bezeichnen, ist in Wahrheit sein bislang bester und auch authentischster. Akin selbst ist im Kiez der Reeperbahn groß geworden, er schildert in Form, Farbe und Dekor die vielleicht akkurateste Miniatur eines Nachkriegsdeutschland in Schieflage. Leider blieb er ohne Preis. Auch Österreichs Beitrag "Der Boden unter den Füßen" von Marie Kreutzer blieb am Ende unbeachtet.
François Ozon wurde für "Grâce à dieu" ("Gelobt sei Gott") mit dem Preis der Jury ausgezeichnet; er seziert darin jahrelang gut vertuschten Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche Frankreichs, ein realer Fall, der die Öffentlichkeit empört und trotz Verjährung derzeit die Gerichte befasst. Ein verdienter Preis, denn Ozon schlüsselt die Vertuschungsmechanismen innerhalb der Kirche penibel auf.
Innovationspreis für Ex-Praktikantin
Beste Regisseurin wurde die Deutsche Angela Schanelec für die rätselhafte Film-Avantgarde "Ich war zuhause, aber", die besser ins "Forum" gepasst hätte, wo all ihre bisherigen Filme gezeigt wurden. Das beste Drehbuch schrieben Claudio Giovannesi und Marizio Braucci gemeinsam mit dem unter Polizeischutz lebenden Autor und Mafia-Ankläger Roberto Saviano für das Camorra-Drama "La paranza dei bambini".
Den Alfred-Bauer-Preis für innovatives Kino bekam die deutsche Erstlingsregisseurin Nora Fingscheidt, ehemals Berlinale-Praktikantin, für "Systemsprenger", einen unter die Haut gehenden Film über eine erziehungsproblematische Neunjährige, der durch seine Intensität und das Spiel der jungen Helena Zengel auch den Goldenen Bären gewinnen hätte können. Schade, dass die Preisauswahl ein bisschen durcheinander geraten scheint in Dieter Kosslicks letztem Jahr als Berlinale-Chef. Das mindert die Krise in der Kino-Nische leider kaum.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!