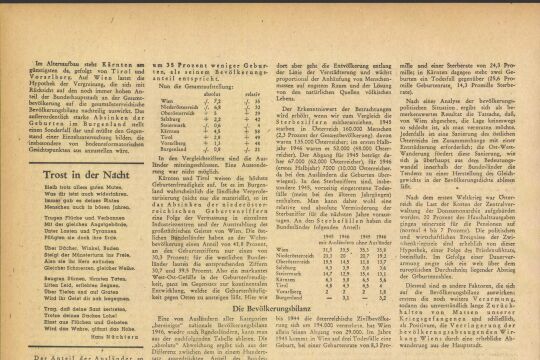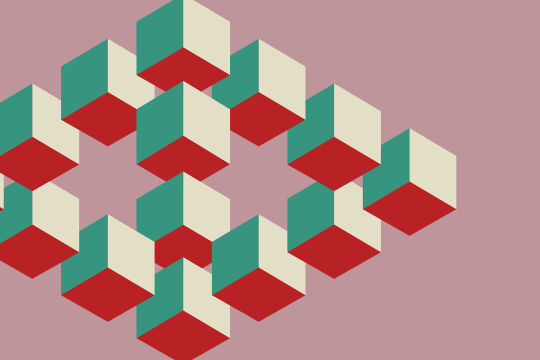Pränatalmediziner versorgen Eltern mit allen erforderlichen Informationen. Welche Konsequenzen zu ziehen sind, liegt einzig an den Eltern.
Die pränatale Diagnostik als Teilbereich der Pränatalmedizin ist ein hochspezialisiertes Fachgebiet; für die Spezialisten dieses Faches ist jahrelange Erfahrung obligat. Die pränatale Diagnostik bedient sich in erster Linie nichtinvasiver Methoden (Ultraschalldiagnostik, Bestimmung von Hormonmarkern) und sieht ihre wichtigste Aufgabe darin, den Eltern gute Nachrichten über den Gesundheitszustand ihres ungeborenen Kindes zu übermitteln. Finden sich Auffälligkeiten, so steht es den Eltern frei, sich für eine weiterführende pränatale Diagnostik (Fruchtwasserpunktion, Chorionbiopsie) zu entscheiden.
Mit Hilfe der Ultraschalluntersuchung im ersten Schwangerschaftsdrittel kann in vielen Fällen bereits ein Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für eine organische oder chromosomale Fehlbildung gefunden werden. Die Frühdiagnostik hat auch Nachteile: Heute bleibt oft der Frau kaum noch Zeit, sich über den Eintritt einer Schwangerschaft zu freuen. Kaum ist der Schwangerschaftstest positiv, muss heutzutage schon über pränatale Diagnostik gesprochen, muss den Eltern entsprechende Information angeboten werden (es mehren sich vor allem im Ausland Verurteilungen von Geburtshelfern, die eine derartige Information nicht ausreichend detailliert den Eltern haben zukommen lassen).
Der überwiegende Anteil der Frauen nimmt von dem Angebot Gebrauch, eine "Gesundenuntersuchung" ihres ungeborenen Kindes vornehmen zu lassen. Ist die Phase der Pränataldiagnostik (etwa nach Vorliegen eines negativen Ergebnisses einer Fruchtwasserpunktion) um die 18. Schwangerschaftswoche abgeschlossen, haben viele dieses Thema für sich (und für immer) abgehakt. Deklariert man sich als werdende Mutter als Befürworterin der Pränatalmedizin, so impliziert das indirekt, dass man eventuell auch bereit gewesen wäre, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Daran will man aber später nicht mehr erinnert werden. Deswegen ist eine breite öffentliche Unterstützung der Pränatalmedizin nicht zu erwarten.
Einige Vorurteile, mit denen Pränatalmediziner immer zu kämpfen haben:
Erstens: Pränatalmediziner betreiben Rasterfahndung, um unwertes Leben auszuscheiden. Stimmt nicht. Pränatalmediziner wollen in erster Linie die unauffällige Entwicklung des Fötus bestätigen. Bei eventuellen Auffälligkeiten kann eine optimale Betreuung des Kindes während der Schwangerschaft und nach der Geburt (durch Planung von Operationen bei Herzfehlern, Bauchwanddefekten, Wirbelsäulendefekten usw.) ermöglicht werden. Finden sich andere Auffälligkeiten wie etwa eine chromosomale Anomalie, so liegt es einzig und allein an den Eltern, welche Konsequenz aus dieser Information gezogen wird. Laut Gesetz steht es den Eltern frei, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Mit der leichtfertigen Verwendung des Wortes "Rasterfahndung" ist eine inhaltliche Diskussion unmöglich.
Zweite häufig verbreitete Falschmeldung: Pränatalmediziner würden Eltern zu Schwangerschaftsabbrüchen überreden. Pränatalmediziner informieren die Eltern über den Befund und bemühen sich, die Eltern mit allen erforderlichen Informationen zu versorgen.
Eines steht fest: Pränatalmediziner und Geburtshelfer sind für zwei Lebewesen verantwortlich: für Mutter und Kind. Alle, auch die zum Teil fast militant auftretenden Gruppen, die die Eltern überreden wollen, das Kind auszutragen, vergessen häufig eines: wenn das Kind zur Welt gekommen ist und viel zeitliche und finanzielle Förderung und Zuwendung braucht, die die Eltern nicht bieten können, dann hört man von diesen Gruppen sehr wenig und die Eltern stehen häufig alleine da. Wo bleibt dann die materielle Hilfe? Wer ermöglicht den Eltern, trotzdem ein Leben zu leben, in dem sie auch für sich selber Zeit haben? Wie viele Partnerschaften gehen an derartiger und manchmal übermenschlicher Belastung zu Grunde? Als Kinder finden diese bedauernswerten Menschen gelegentlich noch Unterstützung (integrierter Kindergarten, integrierte Volksschule usw.). Später jedoch im Berufsleben? Oder wenn diese Menschen das ihnen zustehende Recht auf Sexualität ausleben wollen? Wenn ihre Eltern nicht mehr in der Lage sind, sie zu betreuen?
All jenen, die das Wort "Rasterfahndung" so leichtfertig verwenden, muss die Frage gestellt werden: Was hätten Sie in dieser Situation gemacht? Es muss den Eltern freigestellt sein, auch zu sagen: Diese riesengroße Belastung können wir nicht tragen.
Zur Problematik des Spätabbruch: In ganz seltenen Fällen kann die Diagnose einer schwersten Erkrankung des ungeborenen Kindes schwierig sein und sich über mehrere Wochen hinziehen. Laut Gesetz gibt es in Österreich keine Grenze einer Schwangerschaftswoche, ab der bei entsprechender Indikation eine Schwangerschaftsbeendigung nicht mehr möglich wäre. Manchmal spielt der Zeitfaktor eine große Rolle. Im Falle einer späten Diagnose einer ungünstigen Prognose haben Eltern oft wenig Zeit, zu überlegen, was sie mit der Information anfangen sollen. Das ist eine schreckliche Situation sowohl für die betroffenen Eltern, als auch für das betreuende medizinische Team.
Österreichs Pränatalmediziner haben sich darauf verständigt, dass nach Beginn der Lebensfähigkeit in der 24. Schwangerschaftswoche bei einer lebensfähigen Fehlbildung kein Schwangerschaftsabbruch mehr durchgeführt wird. Ein derartiger Spätabbruch bei Kindern mit äußerst ungünstiger Prognose wird nur dann vorgenommen, wenn Eltern dies wünschen, die Kinderärzte einverstanden sind und zusätzlich die entsprechenden Fachdisziplinen wie Neurologie, Kinderchirurgie, Kinderneurochirurgie oder Kinderherzchirurgie ihr Einverständnis geben. Die Einführung einer festdeterminierten Grenze, etwa die 22. Woche (wie dies eine Arbeitsgruppe des Gesundheitsministeriums vorgeschlagen hat; Anm. d. Red.) wäre eine Einschränkung, bei der die ärmsten der Armen kriminalisiert würden - jene, die aus verschiedensten Gründen erst sehr spät Zugang zur Pränataldiagnostik haben, oder wenn erst sehr spät eine entsprechende Diagnose möglich ist.
In letzter Zeit ist in Österreich auch das Thema Fetozid kontrovers diskutiert worden. Der Fetozid stellt eine Methode dar, bei der mittels Herzstich eine Tötung des ungeborenen Kindes im Mutterleib vorgenommen wird und erst danach eine Schwangerschaftsbeendigung bzw. Einleitung erfolgt. Manche behaupten, dies sei humaner als eine Schwangerschaftsbeendigung (und Tötung) mittels Wehenmittel. Die Gefahr, die versierte Pränatalmediziner sehen, liegt darin, dass mit dieser Methode unzureichende Pränataldiagnostik kaschiert werden könnte. Das zweite, was den Pränatalmedizinern Sorge macht, ist: Wo ist die Grenze? Sind Kinder mit kürzeren Armen oder Beinen, mit Down Syndrom, mit offener Wirbelsäule nach Erreichen der Lebensfähigkeit mittels Fetozid abzutöten? Eines steht fest: Wenn ein derartiger Eingriff ins Auge gefasst wird, so sollte dies nur auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern, in einem entsprechenden Zentrum und von einem versierten Pränatalmediziner nach Einholung der Meinung sämtlicher Experten vorgenommen werden.
Die Pränatalmedizin ist nur ein Angebot, von dem man Gebrauch machen kann oder auch nicht. Selbstverständlich wird und darf niemand gezwungen werden, an sich eine derartige Untersuchung vornehmen zu lassen. Diese muss aber jedem in hochqualitativer Form zur Verfügung stehen, der sie will, und darf nicht nur bestimmten Bevölkerungsgruppen vorbehalten bleiben. Fest steht: die Pränatalmedizin bewegt sich in einem Grenzbereich, und allen Beteiligten wird höchstes ethisches Verantwortungsgefühl abverlangt.
Der Autor ist Pränatalmediziner an der Abteilung für Pränatale Diagnostik und Therapie der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am Wiener AKH und Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (ÖGUM).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!