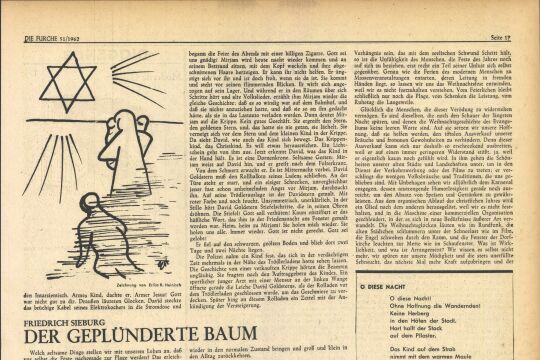Alle Jahre wieder erleben wir einen organisierten Konsumrausch zur individuellen Erfüllung eines zwanghaften Geltungsbedürfnisses. Die Wirkung gleicht einem Danaergeschenk. Ein Essay.
Wirtschaftshistoriker, Brauchtumsspezialisten und profunde Kenner des Konsumverhaltens stehen im Dezember regelmäßig vor unlösbaren Rätseln: Wenn auf öffentlichen Plätzen Nadelbäume aufgestellt werden, in Geschäften Kerzen brennen und in Auslagen goldene Kugeln und Engel zu sehen sind, befällt weite Kreise der Bevölkerung eine erstaunliche Kaufwut.
Das Phänomen ist nicht neu, seit Jahren bekannt und der Trubel erreicht im zweiten Drittel des Wintermonats den Höhepunkt. Die Leser der Zeitungen sind verwirrt, denn im Feuilleton-Teil wird von der stillsten Zeit im Jahr geschrieben, die aber tatsächlich die lauteste ist, und von familiären Idyllen, obwohl Konflikte und Tätlichkeiten zunehmen. Nach eingehenden Forschungen hatten die zitierten Wissenschafter herausgefunden, dass vermutlich vor geraumer Zeit eine Vorgängerin unserer Handelskammern eine Werbe-Idee erfolgreich umsetzen konnte: Über Jahrhunderte hatten die Konsum- und Kaufgewohnheiten in diesem kalten Monat stagniert, weshalb man wahrscheinlich propagiert hatte, die potenziellen Käufer sollten doch einander mit Geschenken erfreuen.
Nun ist grundsätzlich zwischen dem Zeitpunkt zu unterscheiden, warum im Dezember das allgemeine Schenken und Beschenken stattfinden soll, und dem Schenken an und für sich. Während ein tieferer Grund für die Konzentration von Kaufverhalten im Dezember weiterhin unklar bleibt, so besitzt der Akt des Schenkens eine umfassendere soziale Dimension. In erster Linie soll ein Geschenk der sichtbare Ausdruck für die Qualität zwischenmenschlicher Beziehung sein. Mit dem Kauf des Geschenks wird auch der Stellenwert der Beziehung messbar – von der kleinen Aufmerksamkeit bis zum Brillantring.
Die soziale Funktion des Schenkens
Ein Wandel trat ein, da seit Jahrzehnten der Wohlstand der Gesellschaft in Europa ständig stieg, weshalb sich auch das Kaufverhalten deutlich verbesserte. Dieser Anstieg des Anspruchsniveaus an Konsumgüter färbte auch auf die bis dahin bescheiden gebliebene Gewohnheit des Schenkens ab. Da genügten nicht mehr die Geschenkkörbe mit Wein, Wurst und Lebkuchen, die vor Weihnachten zu den Füßen des Verkehrspolizisten auf der Wiener Opernkreuzung in den 50er Jahren abgestellt wurden. Offiziell war zwar diese Geschenkannahme verboten worden, denn man erinnerte sich zur großen Überraschung an die Finanzverordnung für Wien von 1836, doch man darf annehmen, dass andere Wege zur Erfüllung dieses Zweckes gefunden wurden. Eigentlich waren es ja „Kleinigkeiten“, die auf die Gabentische unter dem Tannenbaum gelegt wurden: warme Kleidung, Taschenbücher und erste elektrische Haushaltsgeräte. Damals waren Geschenke vorwiegend nach Brauchbarkeit und Bedarf ausgewählt worden.
Das Ende der „Kleinigkeiten“
Diesem Brauch des Schenkens widerfuhr im Laufe der Jahre eine stets wachsende Bedeutung, so dass schon vor 20 Jahren Geschenke ähnlich zahlreich verteilt wurden wie vom Weihnachtsmann im Zeichentrickfilm. Hatten etwa die patrizischen Familien im antiken Rom einander nur den Zweig eines Baumes zum Jahreswechsel geschenkt, vielleicht noch eine Tonfigur oder Früchte, so waren die Mitglieder der Wohlstandsgesellschaft um 1970 bei Weitem großzügiger. Dieser Austausch der Geschenke wandelte sich zur imaginären Pflichterfüllung für soziale Reziprozität bei gleichzeitiger Beachtung von materieller Ebenbürtigkeit. Also waren Geschenke von nun an im Dezember keine private Angelegenheit mehr, sondern es musste auch die soziale Umwelt berücksichtigt und beeindruckt werden. Der Goldschmuck war nicht nur aus Dankbarkeit an die Ehefrau geschenkt worden, sondern auch mit dem Hintergedanken, demnächst in der Öffentlichkeit zu glänzen.
Schritt für Schritt war der Dezember die Zeit hektischen Einkaufs geworden – ein organisierter Konsumrausch zur individuellen Erfüllung eines zwanghaften Geltungsbedürfnisses. Man könnte es in der Wirkung mit dem zweifelhaften Geschenk der Danaer an Troja vergleichen, allerdings mit dem Unterschied, dass es heute auch den Schenkenden zu vernichten droht. Die übertriebene Neigung zur Repräsentation, die die materiellen Möglichkeiten übersteigt, kann eine existenzielle Bedrohung sein. Diese Beobachtung hatte schon Ruth Benedict in der Darstellung der „Urformen der Kultur“ gemacht, wenn etwa nordamerikanische Indianer im „Potlatch“ ihre Gäste beeindrucken wollten und ihre Existenzgrundlagen mutwillig und prahlerisch zerstörten. Es war daher eine sehr weise Maßnahme, dass man in Europa um 1200 den materiellen Aufwand für Geschenke strikt zu regeln versuchte. Allerdings – wer würde sich heute gern an mittelalterlichen Regeln orientieren?
Ohne solche Regeln ist der Dezember ein Monat größter Prüfung geworden. Da ist ja nicht allein nach Geschenken zu suchen und zu schenken, sondern gleichzeitig finden auch die zahllosen Feiern im Zeitraum von 14 Tagen statt. Diese ermüdende Abfolge von Festen und Feiern hatte die kalendarische Trennung des Jahreswechsels vom Weihnachtstag ab 1692 bewirkt. Erstmals war der Gegensatz von profaner und sakraler „Welt“ klar geworden.
Es war angesichts dieser Mehrfach-Belastungen eine hervorragende Idee des Handels, Erleichterungen anzubieten: Geschenk-Gutscheine. Wenn schon ein Geschenk erwartet wird, obwohl alle schon alles haben, so denkt der gequälte Käufer, soll der oder die Beschenkte sich gefälligst selbst darum kümmern. Jeder weiß doch selbst am besten, welcher Wunsch noch offen ist. Obendrein ist der anschließende Umtausch der Geschenke vermieden. Es ist eine nahezu philosophische Erkenntnis über die Bedürfnisse der lieben Nächsten.
Flucht vor dem Geschenke-Trubel
So ist es nicht verwunderlich, dass schon seit Jahren eine Alternative immer attraktiver wurde, nämlich im Dezember Fernreisen anzutreten oder im vorverlegten Ruhestand die „kalte Jahreszeit“ im Fernen Osten zu verbringen. Immer häufiger war zu hören, dass man diesem Festkreis im Dezember entfliehen will, ja es war das Tagesgespräch gewesen, wie der Trubel vermieden werden kann. Sehr viele erkannten selbstkritisch, dem Kaufrausch so wenig entgehen zu können wie einem Punschstand zu widerstehen, der aus Wohltätigkeit zum „Gesellschaftstrinken“ verpflichtet. Diese Tendenz von Kritik und Selbstkritik entwickelte sich ab 1980 sogar zum Trend. Bis zum Tsunami im Dezember 2004 waren das die Neunmalklugen und Konsumverweigerer, die im Bikini über den Einkaufsrummel der Daheimgebliebenen bei Eisregen lachten.
Und im Dezember ist auch die Zeit, von der man behauptet, sogar für gute Zwecke sitzt das Geld locker in der Tasche. Man kann mit mehr Verständnis für die Nöte der Nachbarn und mit hochherzigen Spenden rechnen. Das deutlich stärkere Wohlstandsgefälle könnte für kurze Zeit gemildert werden. Die beeindruckenden Hilfs- und Sammelaktionen würden den Geldspenden einen höheren Sinn verleihen, so wird gesagt, und im Unterschied zu den Konsumgütern eine dauerhaftere Wirkung erzielen. Da können sogar scharfsinnige Analytiker nicht widersprechen, die behaupten, die Spendenfreude erfolgt aus schlechtem Gewissen und verfolgt den Zweck, sich die Einsicht in Leid und Not weit vom Leib zu halten.
Unbewusst und unerwartet kommt inmitten der Organisation des Spendenwesens eine dunkle Erinnerung an die Ankündigung eines historischen Ereignisses zum Vorschein, das nur mit Hilfe einer TV-Show samt Glanz und Glamour mit Mühe wieder ins Dunkel gerückt wird: In jenen Tagen erging von Kaiser Augustus der Befehl …
* Der Autor ist Professor für Kultursoziologie an der Universität Wien
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!