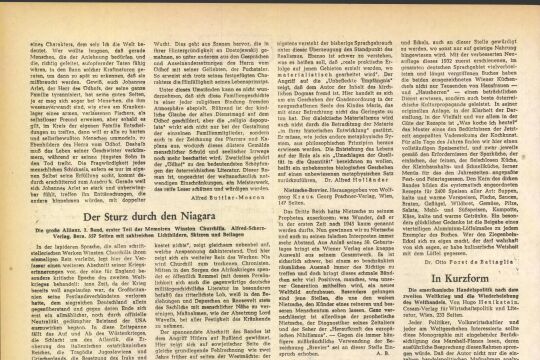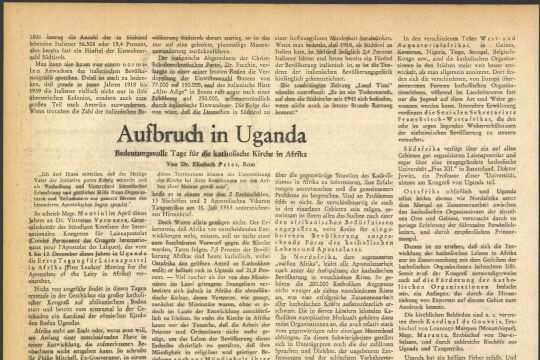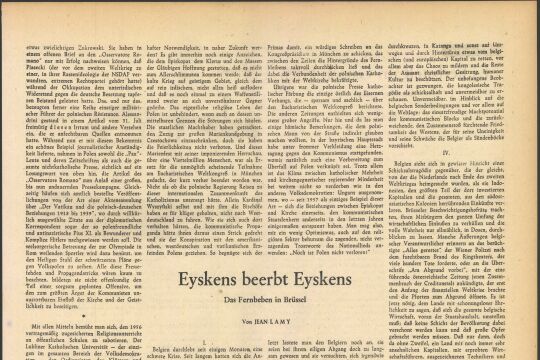Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Auch Emerita, die Taxifahrerin, ist tot
Bücher über Afrika, die den Kontinent in seiner Gesamtheit aus politischer Sicht betrachten, leiden bisweilen unter einer für den Nichtfachmann schwer zu verdauenden Last an Informationen über die so unterschiedlichen 53 Staaten des Kontinents. 43 davon hat Georg Brunold, Afrikakorrespondent der renommierten NZZ (Neue Zürcher Zeitung), in den letzten drei Jahren besucht und seine Korrespondenz in Buchform gebracht. Die NZZ kann sich den Luxus leisten, ihre Korrespondenten auch in jene Länder zu schicken, die besagter Nichtfachmann erst auf der Landkarte suchen muß. Daß er dies auch tut, und bei den Namen Malawi, Guinea-Bissau und Sao Tome nicht das Buch aus der Hand legt, ist das Verdienst der Schreibweise Brun-olds.
Trotz der fast provokanten Nüchternheit im NZZ-Stil faszinieren die gut hundert Berichte aus den gut drei Dutzend schwarzafrikanischen Ländern. Das Gros der Medienberichte über Kriege und sonstige Katastrophen in Afrika werden nach jener unglücklichen Bezeptur präsentiert, die krokodilstränenhafte Betroffenheit dort vorgaukelt, wo Sensationsgeilheit - die der Medienmacher und die der Medienkonsumenten - alleine Regie führt. Brunold schafft auch angesichts der „Apokalypse” (Kapitel X) von-Rwanda den Spagat von politischem Journalismus zur persönlichen Anteilnahme, ohne peinlich zu wirken.
Das Schicksal seiner Informantin Emerita, der wohl einzigen Taxifahrerin im ganzen Land, die ihm bei seinen früheren Aufenthalten stets als Informantin und Kontaktperson geholfen hat, widmet er die letzte Episode. „Emerita habe eine Dusche genommen, als durch das Badezimmerfenster eine Handgranate geworfen wurde”, mußte Brunold im Juni 1994, am Höhepunkt des rwandi-schen Bürgerkriegs, in der Hauptstadt Kigali erfahren. Am Beispiel der Geschichte von Emerita, der Tochter eines Hutu-Vaters und einer Tutsi-Mutter, erklärt er mehr über das Land und die Hintergründe eines atavistisch anmutenden Völkermordes, als es die sattsam bekannten, blutunterlaufenen Bildberichte vom angeblichen Stammeskrieg vermochten. Derlei vielstrapazierte Vokabeln aus aus dem Fundus der alten und auch der gegenwärtigen Chronisten Afrikas werden in den Abhandlungen Brunolds vielfach ad absurdum geführt. Anstelle reiner Opferberichterstattung aus dem Elena der Flüchtlingslager macht sich Brunold auch auf die Spuren der Täter. Als einziger Journalist begibt er sich noch im Juni 1994 in das Hauptquartier der für den Völkermord verantwortlichen und in das Hotel Me-ridien von Gisenyi geflüchteten ExRegierung Rwandas. Er beschreibt auch sein eigenes Unbehagen angesichts der Unverfrorenheit derjenigen, die für tausendfaches Morden verantwortlich sind: „Es handelt sich um ein Exerzitium der beklemmendsten Art, und die Aufmerksamkeit, die in dem Saal der einzige Vertreter der ausländischen Medien auf sich zieht, läßt das Ambiente nicht erträglicher werden”.
Brunold nennt auch die Namen der Täter, nicht nur die fremdartigen der „Interahamwe”-Milizen („Die, die am gleichen Strang ziehen”) und des offen zu den Massakern aufrufenden Senders „Radio Mille Colli-nes”, der „Tausend Hügel”. Die Suche nach den, wenn schon nicht Hintermännern, so doch Mitwissern eines angekündigten Massenmordens führt bis Paris. Rwanda ist mehr als ein schwarzer Fleck in der ohnehin nicht mit Ruhm bedeckten Afrikapolitik Frankreichs, „wo sich in alter Tradition das Elysee die Angelegenheiten südlich der Sahara als präsidiale Spezialdomäne vorbehält”. Der Exkurs zu jener „Grande Nation”, die den Verlust ihres kolonialen Machtstatus mit unheiligen Allianzen zu den übelsten afrikanischen Regimen geradezu unverschämt auszugleichen versucht, verdeutlicht einmal mehr wie verwoben die Strukturen auch der entlegensten Winkel Afrikas mit Europa sind. Brunold weckt das Gewissen Europas für Afrika, ohne mit dem in Dritte-WeJt-Büchern grassierenden „Tiers mondisme”, wie Hans Magnus Enzensberger die eigentümliche Bomantisierung der Entwicklungsländer und larmoyante Verklärung ihrer Probleme nannte, um Verständnis für den Schwarzen Kontinent buhlen zu müssen. „Afrikaner sind keine Buddhisten'1, schreibt Brunold bereits in der Einleitung jenen ins Stammbuch, die dem Kontinent und seinen Bewohnern nur die Rolle eines lammfrommen Opfers zugestehen wollen. Latenten Rassismen gegenüber den „Wilden” Afrikas begegnet er nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit der süffisanten Feststellung, einer der markantesten Unterschiede zwischen Europa und Afrika bestehe darin, daß in Afrika „die Kirchen besser besucht sind als in Deutschland'1 oder anderen kleinen Nadelstichen: „Gewiß, die Post in Afrika ist imstande, die italienische zu unterbieten, aber normalerweise nur in Zaire”.
Die Ideologie des Buches, abgesehen von derartigen Seitenhieben, ist die korrekte, hintergründige Information über einen weithin unbekannten Kontinent. Die Gefahr, den Leser mit zu vielen, schwer einordenbaren, harten Fakten zu verdrießen, umgeht Brunold durch die Stringenz seiner Darstellung. Da wird sogar ein Kapitel über die heillos zerfranste und mit ihren Clans verwobene Parteienlandschaft Somalias zur spannenden Lektüre, ein Bericht über Sierra Leones 26-jährigen Diktator Melvin Strasser und die „boys” seiner noch jüngeren Regierungssol-tadeska, zum Objekt der literarischen politischen Reportage.
Die Art und Weise, wie Brunold den Leser in die Abgründe korrupter Großstadtdschungel wie in Lagos oder Kinshasa blicken läßt, in die unbekannte Welt der südsudanesischen Rebellen führt und die - gelinde gesprochen - skurrile Welt der deutschstämmigen Farmer in „Südwest” porträtiert, hebt sich wohltuend von den Szenarien der „Roving correspondents”, der rasenden Kriegsberichterstatter ab, die in Europa noch immer das Bild vieler Menschen von Afrika prägen. Von einem Afrika, das es so vereinfacht -und darauf weist der Titel des Buches hin - als monochromes Dürre-und Bürgerkriegschaos nicht gibt.
Wo Brunold wie in Somalia und Rwanda aufgrund aktueller Ereignisse doch auf die jedweden humanen Katastrophen hinterher jagende Medienkarawane trifft, wird man ein Gefühl nicht los: Der Autor war früher dort, hat die besseren Informationen als seine Berufskollegen und ist auch ein wenig länger geblieben. Und das ist es, was das Buch für einen nicht nur an Afrika, sondern auch an anspruchsvollem Journalismus Interessierten zur Pflichtlektüre macht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!