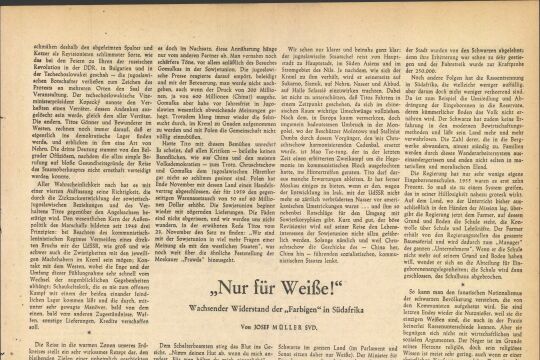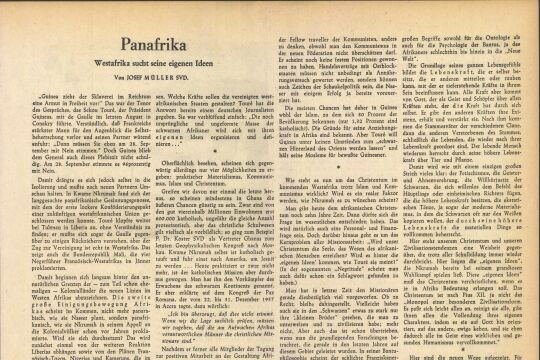„Vietnam“ im Süden Afrikas?
In Mocambique sollen Kugeln das Argument von weißen Soldaten gegen die schwarze Befreiungsbewegung gewesen sein. Missionare berichten über Massaker an Frauen und Kindern, ohne freilich, begreiflicherweise, juristisch exakte Beweise liefern zu können. Aber sie haben das Interesse der Welt auf den Süden Afrikas gelenkt — auf einen Weltteil, der ein neues „Vietnam“ abgeben könnte. Südafrika steht hier für den gesamten von Weißen beherrschten Südteil des Kontinents, also für Südafrika, Rhodesien, Südwestafrika, Malawi, Mocambique, Angola und selbstverständlich auch für das schwarz „regierte“, aber völlig von Südafrika abhängige Botswana. Zwar wird die Vietnamisierung dieses Subkontinents erst jetzt, nachdem Vietnam nicht mehr die Aufnahmefähigkeit der Weltöffentlichkeit für derartige Themen okkupiert, zur Kenntnis genommen, tatsächlich ist sie aber längst eine Realität.
In Mocambique sollen Kugeln das Argument von weißen Soldaten gegen die schwarze Befreiungsbewegung gewesen sein. Missionare berichten über Massaker an Frauen und Kindern, ohne freilich, begreiflicherweise, juristisch exakte Beweise liefern zu können. Aber sie haben das Interesse der Welt auf den Süden Afrikas gelenkt — auf einen Weltteil, der ein neues „Vietnam“ abgeben könnte. Südafrika steht hier für den gesamten von Weißen beherrschten Südteil des Kontinents, also für Südafrika, Rhodesien, Südwestafrika, Malawi, Mocambique, Angola und selbstverständlich auch für das schwarz „regierte“, aber völlig von Südafrika abhängige Botswana. Zwar wird die Vietnamisierung dieses Subkontinents erst jetzt, nachdem Vietnam nicht mehr die Aufnahmefähigkeit der Weltöffentlichkeit für derartige Themen okkupiert, zur Kenntnis genommen, tatsächlich ist sie aber längst eine Realität.
Freilich hatte der Süden Afrikas bisher seine kleinen, voneinander relativ Isolierten Vietnams, die sich jetzt zusehends zu einem einzigen riesigen Krisenherd vereinigen. Dabei ist es keineswegs so, daß die eine, nämlich die schwarzafrikanische Seite in einen blinden Kriegsund, Siegestaumel verfällt und nur die andere, nämlich die weiße Seite die tragischen Konsequenzen der kommenden Ereignisse erkennt. Zahlreiche schwarze Politiker Afrikas sind sich völlig dessen bewußt, was bevorsteht — sie wissen, daß die „Befreiung“ von 37 Millionen südafrikanischer Schwarzer von fünf Millionen sie beherrschenden Weißen, gleichgültig, ob sie gelingt oder nicht, einen schrecklichen Blutzoll fordern wird. Doch zumindest im Augenblick gibt es für keine Seite ein Zurück.
Schwarzafrika steht zwar verbal geschlossen gegen die „Kolonialisten“, tatsächlich aber reicht das Spektrum von militantem Schwarz-afrikanismus bis zur Kompromißbereitschaft gegenüber den .südafrikanischen 'weißen fasf ürH4e(a%n0Preis. Dabei wäre es ein arges Mißverständnis, einen schwarzen Staatspräsidenten, der die Befreiung der unterdrückten schwarzen Brüder in den weißen Staaten des Südens und/ oder in den portugiesischen Kolonien fordert und in der Praxis eher dagegen obstruiert, für einen Heuchler zu halten. Er ist nicht mehr und nicht weniger ein Heuchler als ein beliebiger Exponent Europas, der auf der einen Seite die Verwurzelung alles dessen, was er tut, im Christentum betont und auf der anderen Seite der politischen „Realität“ opportunistischen Tribut in unbegrenzter Höhe zollt. Für den Schwarzafrikaner ist die Befreiung der unterdrückten Brüder oft mehr eine Art von reigiö-sem Überbekenntnis, die Beziehung zu den Unterdrückern der unterdrückten Brüder aber die große Frage des Jetzt und Hier.
Natürlich ist richtig, was immer behauptet wird: daß nämlich ein starker politischer und psychologischer Druck von außen viele schwarzafrikanische Politiker bei der antikolonialistischen Stange hält (und ebenso richtig, daß wirtschaftlicher Druck ihre realistische und oft opportunistische Haltung dm Jetzt und Hier erzwingt, und oft mit noch viel größerer Macht).
Auf der anderen Seite aber verkennt man in Europa sehr oft die Rolle, welche die Emanzipation des schwarzen Afrikaners im schwarzafrikanischen Bewußtsein und Selbstverständnis spielt — sie wird vom meist sehr geringen Grad von Emanzipation des einzelnen schwarzen Afrikaners verdunkelt. Es ist für die weißen Kolonialisten, die echten wie die sogenannten, in Schwarzafrika viel leichter zu agieren als etwa in Asien — ein Grund dafür ist die außerordentlich ambivalente Rolle, welche der weiße Mann im Bewußtsein des schwarzen Afrikaners spielt. Das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß ist in Afrika (sehr im Gegensatz zu Asien) von starken Elementen einer Vater-Sohn-Beziehung geprägt, der Wunsch, sich vom Weißen zu emanzipieren, steht in enger Beziehung zu dem Wunsch, so zu sein wie der Weiße. Emanzipatori-scher Optimismus und tiefster Pessimismus in der Bewertung der eigenen Emanzipationschancen wechseln im afrikanischen Bewußtsein manchmal mit drastischer Plötzlichkeit ab, dieser Wechsel manifestiert sich nicht nur im unvermittelten Stimmungswandel einzelner, sondern in manchen Ländern auch in innenpolitischen Richtungskämpfen und Richtungswechseln.
Ein psychologisches Handikap der schwarzafrikanischen Emanzipation ist die schlechte Behandlung, die der große, mächtige, väterliche Weiße dem unmündigen, ohnmächtigen schwarzen Sohn angedeihen ließ — wo Weiße in Afrika gehaßt werden, werden sie nicht als das Fremde gehaßt, sondern viel häufiger als der böse, verstoßende Vater. Dieser Konflikt wurzelt tief im Unbewußten Schwarzafrikas, und hemmt immer wieder den emanzipatorischen Schwung und Optimismus.
Anderseits aber wird die schwarzafrikanische Emanzipation dadurch psychologisch gefördert, daß sie nicht ein Anliegen des alten, traditionellen Afrika gegenüber den weißen Kolonialmächten ist, sondern Teil dessen, was man als das neue Überich des schwarzen Afrikaners bezeichnen könnte, Teil des weißen Vaterbildes, sie repräsentiert, wie man auch sagen könnte, im Bewußtsein des schwarzen Afrikaners das gute weiße Prinzip gegenüber dem bösen, das positive Vater-Image gegenüber dem negativen.
Diese Konstellation mit ihren bewußten und verdrängten Komponenten, mit ihren einander oft paralysierenden Antrieben und Blok-kierungen, scheint mehr und mehr einem Point of no return entgegenzustreben, einem Punkt, an dem sich entscheiden muß, ob Afrika die Emanzipation gelingt oder nicht — wobei die politische und psychologische Emanzipation der bereits „befreiten“, einander mehr oder weniger selbst regierenden schwarzafrikanischen Staaten (denn überall in
Afrika klafft der Gegensatz zwischen politischer Selbständigkeit und wirtschaftlicher Ohnmacht angesichts erdrückender weißer wirtschaftlicher Ubermacht) in eine immer engere Verbindung mit der politischen Befreiung der schwarzen Mehrheiten in den südafrikanischen Staaten gerät. Und alle weißen Beteuerungen, unr ter weißen Regierungen würde es den Schwarzen in jenen Staaten wirtschaftlich wesentlich besser gehen als dort, wo Schwarze unter schwarzen Regierungen leben, prallen, völlig unabhängig von ihrem etwaigen Wahrheitsgehalt, an der Tatsache ab, daß in der Rangordnung der weißen Werte, genauer hier jener Werte, die der schwarze Mann verwirklichen muß, um so zu werden wie der weiße Mann, die Selbstbestimmung weit vor dem Wohlstand rangiert. Und gerade weil auch der Schwarze den Wohlstand längst als Potenzsymbol entdeckt hat und Aneignung weißer Kräfte sein tiefstes Anliegen ist, empfindet er jeden unter einer weißen Herrschaft errungenen Wohlstand als Beweis weißer Potenz und eigener schwarzer Ohnmacht. Selbstbestimmung ist daher heute in Afrika in den Rang eines religiösen Glaubensinhalts gelangt. Je mehr Wohlstand der Weiße dem Schwarzen, der sich der weißen Herrschaft beugt, anbieten leann, desto erdrückender empfindet der Schwarze seine eigene Ohnmacht und seine eigene emanzipato-rische Sehnsucht — es ist eben keineswegs nur oder auch nur hauptsächlich der Neid dafür verantwortlich zu machen, wenn man heute ahne Risiko voraussagen kann, daß ;in allenfalls etwas angehobener Lebensstandard der schwarzen Mehr-leit in den selbständigen südafrikanischen weißen Staaten (oder gar in den portugiesischen Kolonien) nichts zur Befriedung der afrikanischen Szene beitragen, sondern die Aggressivität des nach Befreiung der Unterdrückten rufenden Schwarzafrika nur eher noch steigern könnte.
Was die Situation so aussichtslos erscheinen läßt, ist die Tatsache, daß auch schon jener Punkt überschritten sein könnte, vor dem eine gewisse Lockerung der Zügel die Befreiungstendenzen innerhalb der schwarzen Mehrheiten in Südafrika und Rhodesien so leicht hätte unterlaufen können. Die weißen Regimes im Süden des Kontinents waren nicht bereit, aus irgendwelchen Erfahrungen vor Vietnam zu schöpfen, und traben den Druck stets nur verschärft. Selbst wenn sie, was ohnehin nicht zutrifft, bereit wären, Lehren aus Vietnam zu ziehen, wäre es möglicherweise zu spät. Der Konflikt mag schneller oder langsamer eskalieren, mag vorübergehend in Ruheperioden eintreten oder nicht — leider ist kaum noch ein Zweifel daran möglich, daß er sich auf lange Sicht i.ur immer weiter verschärfen kann, and die herrschende Minderheit ist gegenüber der schwarzen Mehrheit zu klein, um irgendwelche Zweifel über das Endergebnis der Auseinandersetzung hegen zu können.
Im Augenblick ist die Situation vor allem dadurch gekennzeichnet, daß sich auf der einen Seite die Befreiungsbewegungen mehr und mehr internationalisieren und solidarisieren und auf der anderen Seite auch die bedrängten weißen Regimes enger zusammenrücken. Es besteht nicht nur eine Schicksalsgemeinschaft zwischen Südafrika, Rhodesien und deren Satelliten, sondern auch eine viel morbidere Schicksalsgemeinschaft dieser Staaten mit den portugiesischen Kolonien. Man kann daran zweifeln, daß es, auf lange Sicht, klug von Südafrika und Rhodesien war, diese Schicksalsgemeinschaft, der man sich freilich kaum entziehen kann, in Richtung einer Aktionsgemeinschaft zu entwickeln, wofür verschiedene Anzeichen sprechen.
Denn es kann, ob man dies in Lissabon nun wahrhaben will oder nicht, nun einmal kein Zweifel daran bestehen, daß der Kolonialismus passe ist und daß die Tage der allerletzten klassischen Kolonien gezählt sind — Hongkong dürfte ausgezeichnete Chancen haben, die portugiesischen Besitzungen in Afrika zu überleben. Es fragt sich, ob man in Kapstadt und Salisbury die Gefahr, in den Strudel des Unterganges von Angola und Mocambique gezogen zu werden, in ihrer ganzen Schwere erkannt hat. Für die letzten weißen Staaten Südafrikas könnte eine Mentalität schicksalhaft werden, die 1969 Südafrikas weißer Minister Coetzee in die Worte „Wenn es sein muß, essen wir sie alle zum Frühstück“ gekleidet hat. Heute gibt man sich gedämpfter, aber die Gesinnung hat sich nicht geändert. Man sollte erkennen, daß man „sie“ auch am Abend eines schrecklichen Tages nicht verspeist haben wird, das Gegenteil wäre immerhin leichter möglich.
Optimistisch betrachtet, scheint die Vietnamisierung des eigentlichen Südafrika noch immer abwendbar — wenn es Südafrika gelingt, über seinen Schatten zu springen, und dieser Schatten ist schwarz. So gering die Aussichten auf einen Sieg der Vernunft auch sein mögen — Angola und Mocambique und im Hintergrund Portugal sind keine Partner für Rettungsversuche.
Die Tage dieser beiden Kolonien scheinen gezählt. Ihre Vietnamisierung ist seit Jahren im Gange. Daß in Mocambique Dörfer mit Napalm bombardiert wurden, erfuhr die Welt schon in einer Zeit, in der Vietnam alle Aufmerksamkeit okkupierte und ein paar hundert Tote in einem anderen Winkel der Erde kaum Eindruck machten. Auch das Aufsehen, das Wiriyamu, dieses „My Lai“ in Mocambique, erregte, ist nicht zuletzt aus einer Übersensibilisierung der Welt gegen derartige Vorgänge im Gefolge des Vietnamkrieges zu erklären, denn soviel auch dafür spricht, daß sich dieser von Portugal heftig abgestrittene Massenmord ereignet hat — sollte es ein Wiriyamu tatsächlich nicht gegeben haben, so gab es doch wohl so manches andere Dorf, das ein ähnliches Schicksal erlitt.
Nicht einen Tag noch, sondern einen Tag vor der Veröffentlichung der „Times“-Anklagen über das Massaker von Wiriyamu sagte ein portugiesischer Offizier zu einem Korrespondenten der immerhin ebenso seriösen „Neuen Zürcher Zeitung“: „Wenn unsere Truppen eine Strafexpedition gegen ein Dorf in Afrika unternehmen, von dem gesagt wird, es habe Beziehungen zu den Rebellen unterhalten, dann ist dort nachher nicht einmal mehr ein Huhn am Leben.“
Der Offizier, so schrieb die „NNZ“, bililgte diese Methoden nicht — hielt sie aber doch für ein wirksames Mittel, die Herrschaft der Portugiesen zu sichern, und er dürfte damit recht haben. Denn eine andere Chance als Gewalt gegen Gewalt ist für die Kolonialmacht Portugal nicht zu erkennen. Jene südafrikanischen Länder aber, die nicht Kolonien sind, sondern von Weißen regierte Staaten mit schwarzer Mehrheit, sollten sich, solange sie noch schwimmen können, nicht an einen Ertrinkenden klammern.