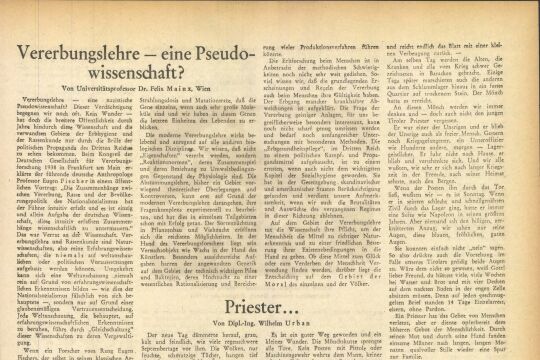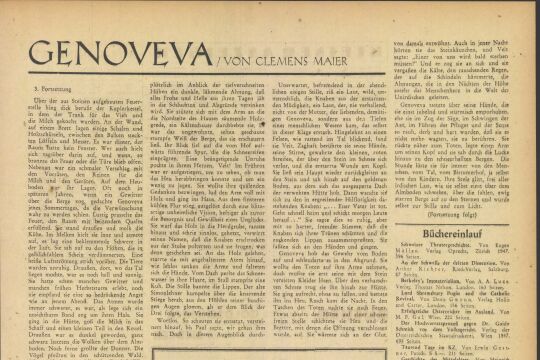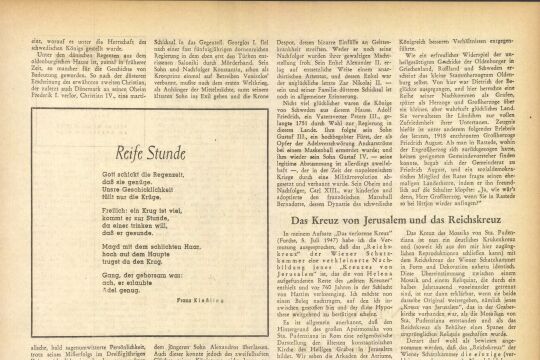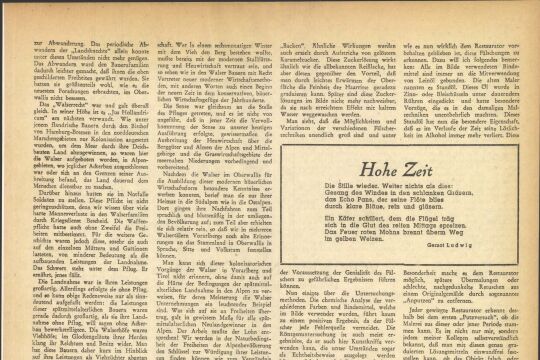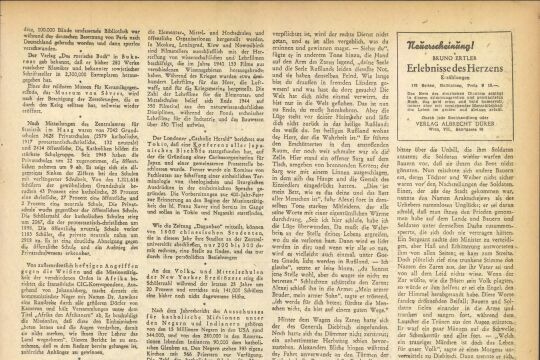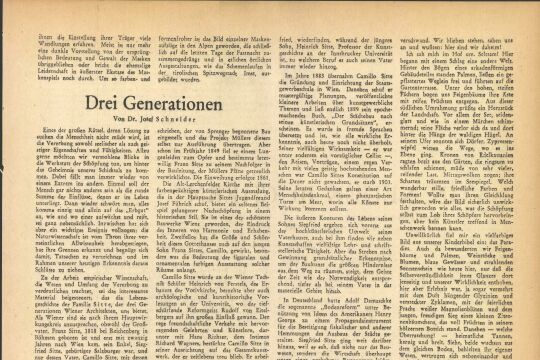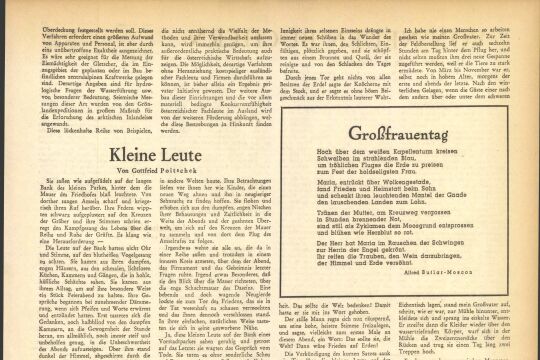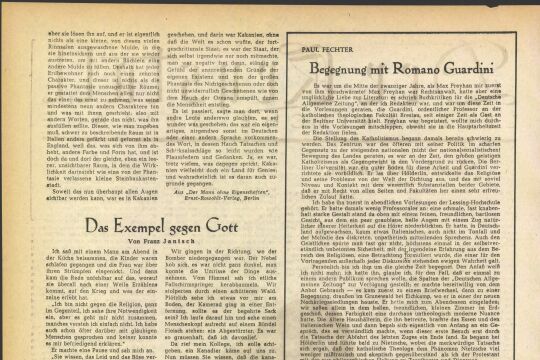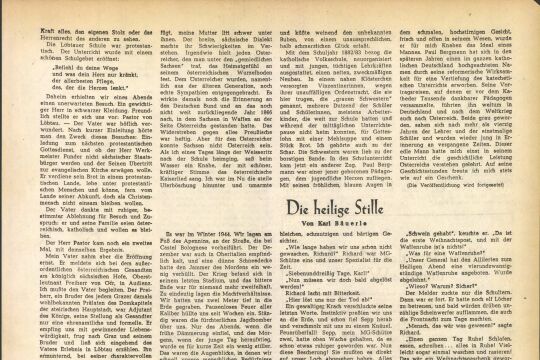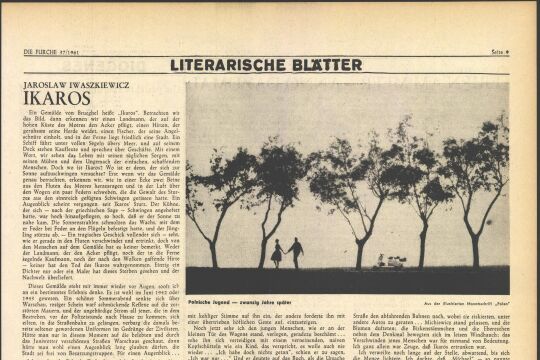Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Trappist in Stalingrad
Es war Gründonnerstag 1943. Der Steppenwinter war gebrochen. Die Sonne hatte den Schnee aufgesogen. Blau glänzte der Himmel. Frische Luft drang in unsere Lungen, wie ein kühler Trunk klaren Quellwassers in die dürstende Kehle.
Wir hatten Befehl bekommen, unser altes Lazarett zu verlassen und ein neues zu beziehen.
Ein kleines Häufchen kranker Männer, die alles verloren hatten, waren wir unterwegs in der Ruinenstadt. Gebeugt, nicht fähig, die uns anvertrauten Leben zu retten, legten wir unbeholfen die zitternden Hände an die Karren.
Dreißig Kilometer dehnten sich die Ruinenfelder am rechten Wolgaufer: Trümmer von Hütten und Hochhäusern, zerstörte Fabriken, die ungeheuren Hallen der Traktorenwerke, der himmelanragende Bau des Silos, die großen Häuser rings um den Platz, deren verwüstete Fronten uns angähnten wie Rachen riesiger Raubtiere. Einsam und winzig, niedergeschlagen und krank, von Glück und Heimat verlassen, besiegt bis in die letzte Faser des Leibes, von Siechtum und Tod gezeichnet, wanderten wir, einem fremden Willen unterworfen, durch die Straßen der Schicksalsstadt.
Aber mir war, als schwebte ich der Zeit einige Tage voraus. Wir kamen aus Grabesjracht; was gab es für uns noch anderes als Auferstehung?
Auf dem Weg nach Westen kamen wir wieder am GPU-Gebäude vorbei. Hier hatte sich etwas geändert: die Tore waren verschlossen, der Zaun erneuert. Vor dem Eingang warteten Frauen, um ihren gefangenen Männern Essen zu bringen.
Wir erreichten die Steinstraße, auf der wir am 23. Jänner, zur Nachtzeit, in Stalingrad eingezogen waren. Damals hatten uns die Posten in Nebel und Dunkelheit den Weg gewiesen:
Ihr werdet auf die Steinstraße kommen und dort einige zerschossene Straßenbahnwagen finden. Dann geht nach links.
Als wir nun zu Ostern in umgekehrter Richtung vorüberzogen, standen noch immer die zerschossenen Straßenbahnwagen da. Ich sah sie und das Bild jener Winternacht stieg wieder in mir auf:
23. Jänner: Von allen Seiten waren Kampfgruppen, zusammengeschmolzene Einheiten, Trosse, rückwärtige Dienste, Versprengte und Verwundete, humpelnde Soldaten mit erfrorenen, in Lumpen gehüllten Füßen und Kranke zusammengeströmt. Nicht mehr alle hatten, wie wir selbst noch, Befehl, einen bestimmten Punkt aufzusuchen. Unser letzter Befehl hatte gelautet: Die Gruppe ist ins GPU-Gebäude zu führen. —
Durch die zerschossene Kuppel des GPU-Gebäudes blickte blau der Winterhimmel, unter dessen Blendung wir so oft über den goldenen Schnee der Steppe geschritten waren, über Schatten, die wie Stahl glänzen, durch windstille Schluchten und vorbei an schmutzig-schwarzen Einschlägen; — leicht und-frei, ohne die Last eines Lebens, mit dem wir abgeschlossen hatten. Erst in den Tagen zuletzt hatten wir gefühlt, wie etwas anderes auf uns zukam. Wir waren aus der freien Ebene in die Ruinen von Stalingrad gezogen. Um uns war es eng geworden.
Den Steinboden des Raumes unter der Kuppel deckten Schutt und Ausrüstungsgegenstände. Die eisernen Stiegen und Geländer längs der Gefängniszellen starrten abenteuerlich verbogen und in den Gängen lastete Totenstille.
Zum Keller unterhalb des Kuppelraums führte am Rande eines Schutthaufens vorbei ein schmaler Eiagang. Dort stand Dr. Markstein aus Danzig mit dem Dolmetscher Haszy. Ich trat zu ihnen. Wir warteten aut die Russen.
Die letzten noch halbwegs gesunden deutschen Soldaten hatten das Gebäude verlassen. Es war nicht kapituliert worden. Man solle nicht mehr zurückschießen —, dies nur hatte man durchgegeben. Unser, der Ärzte Platz war bei den Kranken und Verwundeten. Am
Kellereingang hing die kleine Rot-Kreuz-Flagge. Wir hatten sie dort angebracht: allen konnte sie zeigen, welche Art von Leben wir von nun an allein zu wahren hatten.
Was bevorstand, wußten wir nicht. War es nur den Sinnen still geworden, oder rückte das Gefühl, an einer großen Schicksalswende zu stehen, alle äußeren Eindrücke fort, ließ sie verstummen und erstarren?
Plötzlich tauchte vor uns ein junger deutscher Offizier auf, lang, hager. Aus dem schmalen grüngelben Gesicht starrten harte dunkle Augen. Sie blickten feindselig und wie in eine Ferne —, Augen eines Mannes, dessen Welt nicht mehr da ist. Der Offizier stand in der Tarnjacke vor uns, er trug die runde Mütze, die „Feldmütze alter Art“, am langemachten Riemen hing ihm eine Maschinenpistole. Sein Blick traf un# Waffenlose. Bösartig klang die Frage:
„Was ist da los? Ubergabe gibt es nichtl Der Krieg geht weiter!“
Dr. Markstein zuckte die Achsel und sagte: „Hier ist ein Verbandplatz!“
Der Krieger, Bote einer Welt, zu der unsere Stille nicht mehr gehörte, verschwand hinter dem Schutthaufen.
Wir warteten, die steinerne Wendeltreppe im Rücken. Sie führte in den Keller, in dem wir unseren Verbandplatz errichtet hatten. Zwei Räume lagen dort, waren durch einen Seitengang verbunden. Im ersten Raum stand rechts ein kleiner Tisch, ihn bedeckte unser letztes, einstmals weißes Tuch. Darüber brannte die Gaslampe des Feldlazaretts. Längs der Wand reihten sich in Kisten Verbandmittel und Medikamente, wie wir sie an den Vortagen aus Kraftfahrzeugen zusammengetragen hatten. Am anderen
Ende des kleinen Gelasses lagen auf einem Gestell Übermäntel, Brotbeutel, Tornister und Säckchen. Dieser Raum mußte uns genügen, daß wir notdürftig Verwundungen und Erfrierungen versorgten.
Nebenan in dem zweiten Raum lagen die Soldaten auf dem Fußboden; lagen auf, unter und zwischen Bettgestellen Hnd Pritschen. Kerzenstummel gaben trübes Licht. Zuvor waren auch Gesunde hier gewesen. Ihr Auszug hatte Durcheinander hinterlassen. Den Kranken fehlte der Wille, mehr zu tun, als das augenblickliche Bedürfnis forderte. Kreuz und quer waren sie liegengeblieben, hatten zwischen Betten und auf dem Boden den Weg versperrt. Mit Mühe hatten wir einen Pfad durch den Keller gangbar gemacht: „Sonst werden es eben die Russen tun!“
Mit dem Wort hatten wir die Leute kaum aufgerüttelt. Dann waren wir aus dem Keller emporgestiegen.
Nun warteten wir. Während des Wartens war Zeit, nachzudenken, wenn auch der Spannung wegen ein Gefühl sich fast nicht regte.
Was wird aus der Heimat? Den Abend, zuvor hatte uns der General Freiheit des Entschlusses gegeben: Durchschlagen oder Gtfangenschaft. Sich umzubringen sei nicht recht; es müßten Männer heimkommen, die mithülfen, Deutschland aus dem Schutt zu heben! Die Heimat — ein Schutthaufen wie Stalingrad?
Was wird aus den Verwundeten? Wir selbst hatten erfahren, daß die Rote Armee in bestimmten Fällen das Rote Kreuz achtete. Aber es bestanden keine bindenden Abmachungen. Im Kessel war es die Absicht des Armeearztes gewesen, von gefangenen russischen Ärzten zu erkunden, wie die Rote Armee verwundete Kriegsgefangene und feindliche Sanitätsdienste zu behandeln gedenke. Aber wir hatten im Kessel niemals einen kriegsgefangenen sowjetischen Arzt zu Gesicht bekommen.
Wir warteten. Manchmal tauchten Gestalten auf und stocherten im Schutt. Sie suchten Eßbares. Dann hieß es, eine sowjetische Kommission werde kommen.
Was wird aus uns? Der Soldat, der kämpft, weiß nicht, was ihm der morgige Tag bringt. In der Gefangenschaft ist alles doppelt ungewiß. Und in der Spanne zwischen Krieg und Gefangenschaft? Standen wir zwischen Tod und Leben oder zwischen Leben und Tod?
Dr. Markstein meinte, alle Gefangenen verlören ihre Namen, bekämen eine Nummer und müßten ununterbrochen arbeiten. Haszy sagte: „Ich arbeite gern, gleichgültig was!“
In diesem Augenblick tröstete ihn der Gedanke an Arbeit.
Ab und zu schlug eine Granate ins Gemäuer, und polternd fielen die Ziegelsteine aufs Gewölbe. Dann traten wir ein wenig zurück. Es wurde ruhig — wir machten wieder einige Schritte vor und sahen hinüber gegen das dunkle Tor am Ausgang zu den äußeren Höfen. Von dorther mußten sie kommen.
Es kam keine Kommission, es kam ein Rotarmist ohne Rangabzeichen, sauber in Wintermantel, Filzstiefel und Pelzmütze gekleidet, mit gesundem, rundem, gutrasiertem und rotglänzendem Gesicht und hellen Augen. Auch er hatte eine deutsche Maschinenpistole umgehängt. Er stieg über die Trümmer und kam wie von ungefähr auf uns zu, drückte uns die Hand, fragte, ob dies ein Lazarett sei und bat Doktor Markstein, ihm zum Andenken an diesen Tag seine Armbanduhr zu schenken. Dr, Markstein nestelte bereitwillig die Uhr ab. Der Rotarmist ließ sich in den Keller führen, sah sich um, erklärte, mit Hitler sei es aus und auch der Krieg werde nicht mehr lange dauern. Dann ging er wieder. Kaum war er fort, kam ein zweiter, älterer Russe und sagte: „Es ist gut, daß das Blutvergießen endlich aufhört!“
Wir wandten uns wieder unseren Leuten zu. Die Russen waren für uns Besucher geworden, der Keller — Gefängnis.
Wie weit lag dies hinter uns! Als ein gespenstischer Schatten huschte es durch die Erinnerung.
Wir kamen an den Rand der Stadt. Nördlich der Steinstraße standen einige Hütten, im Süden dehnte sich freies Gelände. Fünfhundert Meter entfernt erhob sich eine von Bäumen umgebene Häusergruppe. Die Wachmannschaft schwenkte auf sie zu: wir waren in unseren neuen Quartieren.
Langsam richteten wir uns ein. Wochen vergingen, das Frühjahr kam. Neue Kranke wurden eingeliefert, mancher konnte entlassen werden. Auch neues Personal bekamen wir einmal, Kriegsgefangene natürlich wie wir. Darunter war auch ein kleiner schmächtiger Mann mit großem Kopf. Er hieß Kupfer und auf der scharfen langen Nase saß ihm eine Stahlbrille. Er war in Zivil Laienbruder in einem Trappistenkloster. Merkwürdigerweise trug er Tuchschuhe, die am Fußrücken mit großen roten Herzen verziert waren.
Ich begegnete ihm eines Mittags, als die Sonne schon warm vom Himmel schien. Ich schlenderte über den Hof. Da sah ich ihn im gelben Sande sitzen. Er war allein. Nur hier und dort ragten grüne Spitzen staubigen Grases hervor und leisteten ihm stumme Gesellschaft. Kupfer hatte den Kopf vorgeneigt, die scharfe Nase zielte genau auf die roten Herzen seiner Hausschuhe. Er rührte sich nicht. Ich fragte ihn: Nun, Kupfer, worüber meditieren Sie?“ Er bewegte sich kaum und antwortete: „Uber die Worte: WIRF ALLE DEINE SORGEN AUF DEN HERRN.“
(Aus dem Buch „Arzt in Stalingrad“, mit Bewilligung des Otto-Müller-Verlages, Salzburg.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!