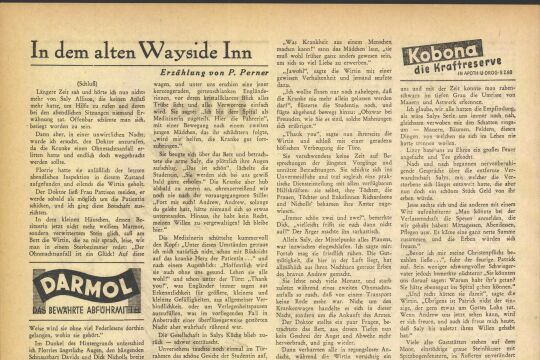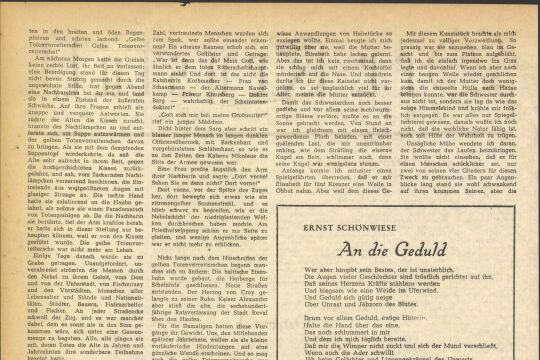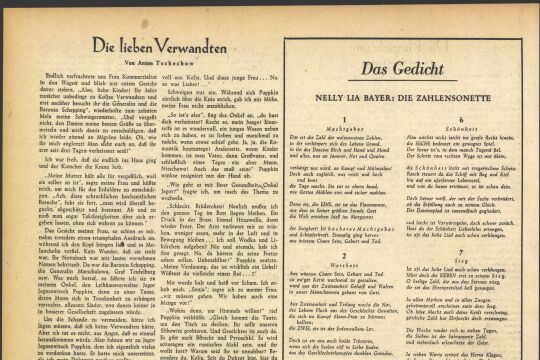Die Pferdetante war für uns eine mythische Gestalt, der Vorzeit angehörig. Mein Vater hat sie in seiner frühen Kindheit noch gesehen und ihr, der damals schon Neunzigjährigen, vielleicht ein wenig befremdet, die Hand geküßt. Eigentlich war sie nicht seine Tante, sondern die seiner Mutter, und auch nur eine angeheiratete, denn ihr zweiter Mann war ein Onkel meiner Großmutter gewesen. Auch diesen begrub sie und lebte nun als zweifache Witwe kinderlos auf ihrem kleinrussischen Gut, eine Figur aus der Welt Gogols. Als junges Mädchen ist meine Großmutter oft bei ihr gewesen. Ihren Namen verdankte sie nicht nur ihrer Pferdepassion und ihrem Pferdeverstand, sondern vor allem ihrer Kopfform und den Zügen ihres langen Gesichts; doch kann ich nicht angeben, ob sie zum hecht- oder zum ramms-köpfigen Pferdegeschlecht gezählt hat.
Sie war eine starke Raucherin und bediente sich paritätisch der zahlreichen, von ihren beiden Ehegatten hinterlassenen langen Pfeifen mit den geschnitzten Bernsteinmundstücken. Sie legte Wert auf die Reinlichkeit des Hauses und besonders auf das Scheuern der Fußböden. Da kauerte sie dann, die Pfeife im Munde, mit hochgezogenen Füßen auf einem Sofa und sah zu, wie die Mägde mit Besen und Aufwischlumpen, mit Bürsten und grüner Seife und Strömen von Wasser auf dem Fußboden herumwirtschafteten. Wollte die Pferdetante sich trockenen Fußes in einen anderen Raum begeben oder eine bestimmte Stelle auf ihre Wohl-gescheuertheit kontrollieren, so riaf sie eine der Mägde heran, irgend so eine Praskowja oder Stepanida, glitt vom Sofa auf deren Rücken und ließ, das Pfeifenrohr wie einen Reitstock handhabend, die Erkorene als ein Reittier auf allen vieren durch die Pfützen traben.
Wenn die Pferdetante im Herbst mit ihrem ganzen Hofstaat, eine lange Wagenreihe hinter sich, nach Njeshin oder Poltawa in ihr Stadthaus hinübersiedelte, dann brachte sie für die Wintermonate den Selbstgebrannten Schnaps für sich, ihre Gäste und Dienstboten mit, und das war jedesmal eine aufregende Unternehmung. Damals hatte der Fiskus das Branntweinmonopol verpachtet. Die Gutsbesitzer hatten alles, was ihre Brennereien erzeugten, den Branntweih-pächtern abzuliefern, und nur diese waren zum Weiterverkauf berechtigt. Die Branntweinpächter waren unbeliebt und verachtet. Sie erzielten ungeheure Gewinne, und es war ihr Ehrgeiz, ihre Söhne und Töchter in die Gesellschaft aufsteigen zu lassen; alle Witze, die man je und je von den nouveaux riches erzählt, sind auch von ihnen erzählt worden. Konnte man ihnen einen Streich spielen, so ließ man die Gelegenheit nicht aus. Immerhin befanden sie sich unter dem Schutz des Staates und hatten in ihren Angelegenheiten die Polizei auf ihrer Seite.
Den Gutsbesitzern stand natürlich an dem von ihnen gebrannten Schnaps das Recht des Eigenverbrauches frei, indessen nur innerhalb der Gutsgrenzen. Zog also die Pferdetante zum Winter in die Stadt, so mutete man ihr zu, ihren Bedarf in den städtischen Verkaufsstellen des Branntweinpächters zu decken oder, wie sie betonte, ihren eigenen Schnaps zum Detailpreis von Halunken zurückzukaufen.
Zu einem solchen Respekt vor den Gesetzen versahen sich die Behörden seitens der Gutsbesitzerschaft einer geringen Bereitwilligkeit, und so standen an den Zufahrtsstraßen der Städte Polizeibeamte, um die Branntweineinfuhr zu verhindern oder doch zugunsten der Pächter die Einfuhrgebühr zu erheben, die unterlassene Deklarierung aber mit hohen Strafzahlungen und Konfiskation der verheimlichten Flüssigkeiten zu ahnden. Man weiß heute nicht mehr, wie die anderen Gutsbesitzer sich geholfen und wie weit sie Glück gehabt haben. Von der Pferdetante aber steht es fest, daß sie nie auch nur ein kupfernes Kopekenstück als Abgabe entrichtet, nie auch nur ein Viertelchen in der Stadt gekauft hat und daß ihr nie auch nur ein Tröpfchen beschlagnahmt worden ist.
Die polizeilichen Zöllner an den Stadteingängen waren mit langen Piken ausgerüstet, nicht so sehr, um damit ohne Not Menschen zu verletzen, als um stochernd sich vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein weißen und doch schwarzen Branntweins zu überzeugen. Sie stießen hinein in die dunklen Tiefen der riesigen, stubengroßen Wagen, der kleinen, einspännigen Bauernfahrzeuge, ob im Heu oder Stroh ein Klirren die Anwesenheit von Flaschen verriete. Nichts klirrte und nichts verriet. Denn zwar mühsam nach Luft schnappend, aber mäuschenstill lagen gekrümmt, mit ihren fülligen Leibern einen Wall um die Flaschenkörbe bildend, zwei, drei oder vier Mägde, irgendwelche Praskowjas oder Stepanidas, in ihrer Finsternis und Enge und nahmen geduldig alle Pikenstöße entgegen. Sie durften nicht schreien, wenn sie gestochen, ja, nicht einmal quieken,, wenn sie gekitzelt wurden. Das gehörte zu ihren Pflichten,, wie der Trab durch die Fußbodn-pfützen, und die Pferdetante war eine gutmütige, freigebige, christliche . Herrin; wer ihr treu zu Willen stand, für den war gesorgt.
Einmal erwies es sich, daß man den Wintervorrat an Schnaps zu knapp bemessen hatte. Ein alter Diener wurde also, von Stepanida und Praskowja begleitet, auf das Gut geschickt, um Ergänzungen heranzuschaffen. Alles ging ohne Verdruß ab. Das , wiederholte sich in den folgenden Wintern, und bald hatte die Pferdetante verstanden, daß sich ja auf die erprobte Weise auch weit über.den Hausbedarf Schnaps in die
Stadt bringen ließ. Kurz, sie schloß vertraulich Uebereinkünfte mit den Inhabern zweier Branntweinverkaufsstellen. Der Zwischengewinn des Pächters wurde gespart und zwischen der Pferdetante und ihren beiden Geschäftsfreunden geteilt. Mit der Zeit freilich kam in der Stadt einiges Gemunkel auf, aber es hatte keine Folgen, denn die Pferdetante stand nun einmal in hohem Ansehen — ihr Vater war einer der Generäle um Suworow und Kutusow gewesen, dazu war sie doch eine Dame und eine Witwe überdies, und es gab niemanden, der den Branntweinpächtern nicht eine Einbuße gegönnt hätte.
Unter den Gutsnachbarn der Pferdetante war einer, den sie nicht liebte, ein kränklicher und übellauniger Junggeselle von schon höheren Jahren. Dieser hatte einen ausgezeichneten Kutscher, aber plötzlich faßte er einen Zorn gegen ihn und beschloß, ihn zu den Soldaten zu geben; die Dienstzeit betrug damals fünfundzwanzig Jahre. Der Kutscher erfuhr von der Absicht seines Herrn, ehe noch die ersten Schritte zu ihrer Ausführung getan waren. Er entfloh, erschien bei der Pferdetante und warf sich ihr zu Füßen.
„Mütterchen“, sagte er, ,,du kennst mich nicht. Ich aber habe mein Vertrauen auf dich gesetzt, und so wirst du mir helfen.“
Die Pferdetante sah sich eine Weile sein Gesicht an. Dann befahl sie ihm aufzustehen und sagte: „Wenn du wirklich dein Vertrauen auf mich gesetzt hast, dann hilft mir alles Widerstreben nicht, und ich kann dich nicht abweisen.“
„Gott wird es dir lohnen, Mütterchen, und von jetzt an werde ich dir gehören und nicht mehr meinem Herrn, der mich unter die Soldaten stecken will“, sagte der Kutscher, als habe an seines Herrn Stelle er selbst über sich zu verfügen.
Weiter sagte die Pferdetante: „Nach deinem bisherigen Namen frage ich dich nicht. Ich mag ihn nicht wissen. Ich werde dir einen neuen Namen geben, dann bist du nicht mehr der Mann von früher.“
Ihr Schreiber sagte zu ihr: „Um Gottes willen, was gedenken Sie zu tun, Tatjana Jlinischna? Sie werden die ärgsten Scherereien mit Ihrem Nachbarn bekommen, und nun gar erst mit den Behörden. Strafbar machen Sie sich.“
„Kränke mich nicht mit deinen Reden“, erwiderte sie. „Weißt du nicht, daß man Barmherzigkeit haben muß? Und wie darf man sich einen Mann entgehen lassen, der im ganzen Kreise als der beste Kutscher und der beste Pferdepfleger gerühmt wird? Und was sollen denn das für Scherereien sein? Wenn junge Burschen ins Priesterseminar aufgenommen werden und sie sind keine Popensöhne, dann bekommen sie dort neue Familiennamen, weißt du das nicht? Und glaubst du, ich habe weniger Macht als die im Priesterseminar?“
Kurz, sie befahl dem Schreiber, den Kutscher unter dem neuen Namen als ihren Leibeigenen in die Register einzutragen. Die Scherereien blieben nicht aus. Der Junggeselle erhob ein gewaltiges Geschrei. Schließlich reichte er eine Klage ein. Die Pferdetante erhielt ein Schreiben von der Gerichtsbehörde, ob es zuträfe, daß sie einem entlaufenen Leibeigenen des und des Namens Unterschlupf gewährt habe. Lange Zeit antwortete sie nicht, dann leugnete sie es ab. Später, als alles schon beigelegt war, sagte sie zur Erklärung: „Damals hieß er doch gar nicht mehr so. Wie die Menschen auf meinem Grund und Boden heißen, das bestimme ich und niemand sonst.“
Die Pferdetante brach mit ihrer Gewohnheit, den Winter in der Stadt zu verbringen. Dort schienen ihr die Behörden zu nahe. Schriftstücke hätten einen bequemen Weg zu ihr gehabt, und wie leicht konnte jemand vom Gericht in ihr Haus dringen und Unannehmlichkeiten erregen! Vor solchen Schrecknissen blieb sie jetzt bewahrt, dafür aber riß die Verbindung mit ihren beiden Branntweinverkaufsstellen ab, und so war manche Einbuße in Kauf zu nehmen. Die Pferdetante hatte das Gefühl, Opfer zu bringen, die ihre Sache zu einer gottgefälligen machen mußten.
In der Tat schien Gott solcher Meinung zu sein, denn ohne viel List, nur mit ihrer eigensinnigen Entschlossenheit wußte die Pferdetante die Sache hinauszuzögern und hatte bloß ein paar Male zwei Rubel achtzig Kopeken oder vier Rubel sechzig wegen Nichtbeantwortung oder doch nicht rechtzeitiger Beantwortung amtlicher Anfragen zu bezahlen, und auch dies rechnete sie unter die gottgefälligen Opfer. Alles erhielt sich längere Zeit in der Schwebe, und darüber starb der Junggeselle. Aber die Geschichte hatte nun doch einen solchen Lärm hervorgerufen, daß sie nicht mehr sehr lange in ihrer Schwebe bleiben konnte, vielmehr nach aller menschlichen Voraussicht ein schlimmes Ende nehmen mußte. Mit des Verstorbenen ehemaligem Kutscher, dem sie längst ihre Livree angezogen hatte, fuhr die Pferdetante zur Beerdigung und nahm andächtig teil. Alle Leute betrachteten ihn mit Neugier. Er war ein stattlicher Mann mit einem schönen Bart und ungezwungenen Bewegungen. Sicher hätte er einen Kürassier oder Ulanen abgegeben wie aus einem patriotischen Bilderbuch; aber die patriotischen Bilderbücher berichten ja nur wenig davon, wie es in den Herzen der Menschen aussieht.
In ihrem Tagebuch — vor langer, langer Zeit habe ich einmal in ihm blättern dürfen; es war in abscheulichem Französisch geführt, aber ich wollte wohl, ich besäße es und besäße es noch heute! —, in ihrem Tagebuch also erzählte die Pferdetante, daß sie auf der Rückfahrt den Schlitten halten ließ und dem Kutscher befahl, auszusteigen und zu ihr an den Schlag zu treten.
„Du weißt selbst, daß du kein schlechter Kutscher bist. Ich bin mit dir zufrieden, und der Verstorbene wird es auch gewesen sein. Jetzt sage mir, warum er damals den Zorn auf dich gerufen hatte.“
Hiernach hatte die Pferdetante ihn bisher noch nie gefragt. Sie hatte sich daran genügen lassen, daß ihr Nachbar den besten Kutscher des Kreises zum Militär hatte abschieben •wollen. Es war nicht ihre Gewohnheit, über' flüssige Redereien mit dem Gesinde zu führen; vielleicht war sie auch der Meinung gewesen, daß man ja stets um so frischer und entschlossener handelt, je weniger man weiß, und daß man Gefahr läuft, sich selber zu lähmen, wenn man eine Sache nicht nur mit den eigenen Augen betrachtet, sondern auch mit denen des Gegners. Stellte sie jetzt die Frage, so geschah das, weil mit dem Tode des Nachbarn die Ereignisse bis zu einem bestimmten Abschnitt gelangt waren.
Der Kutscher berichtete freimütig, sein ehemaliger Herr habe ihn mit einem Mädchen verheiraten wollen, an dem er keine Freude gehabt hätte, mit einer häßlichen und zänkischen alten Viehmagd.
„Warum?“
„Das waren so seine Gedanken, daß er immer befehlen mußte, zu heiraten. Und er selber hat doch unverehelicht zu sterben beliebt. Nein, ich weiß den Grund nicht. Doch, ja, einmal hat er zu sagen beliebt, ich würde dann ruhiger werden. Und weil er merkte, daß ich widerstrebte, statt ihm zu danken, darum hat er mir zu zürnen beliebt.“
„Du hast also lieber in Sünde leben wollen?“
Der Kutscher senkte den Kopf und hob ihn dann wieder.
„Mütterchen, wir sind ja so schwach. Und es heißt doch auch, die Sünden des Fleisches würden leichter vergeben, leichter als die, die aus dem Kopf oder aus der Seele kommen.“
„Es ist gut. Fahren wir weiter.“
Die Pferdetante hat dann in ihr Tagebuch geschrieben: „Dem Begrabenen das Himmelreich I Die Sünden des Fleisches hat er, wie man hört, gemieden. Aber die ärgeren Sünden des Hochmuts, des Zornes, des Unglaubens und der Gedankenfinsternis hat er auf sich geladen, und von denen hat mein Kutscher sich ferngehalten. Gott verzeihe dem Toten, wir sind alle schwach.“
Das Gut des Junggesellen fiel an eine seiner Verwandten, eine junge Witwe. Als die Pferdetante hörte, daß sie angekommen war, um ihren neuen Besitz zu übernehmen, da fuhr sie hin, warf sich der Erbin zu Füßen und sagte:
„Eine alte Frau demütigt sich vor Ihnen. Sie kennen mich nicht, ich aber habe mein Vertrauen auf Sie gesetzt, und so werden Sie mir vergeben und mir helfen, daß die Geschichte in Ordnung kommt.“
Die Erbin hob die Pferdetante auf, küßte ihr die Hände und ehrte sie. Sie einigten sich, daß die junge Frau die ererbte Klage zurückziehen und der Kutscher bei der Pferdetante verbleiben, die Erbin aber mit vier Gäulen aus der Zucht der Pferdetante entschädigt werden sollte.
Als alles abgesprochen war, sagte die Erbin: „Jetzt, bitte, erklären Sie mir eins, Tatjana Jlinischna. Wie hätten Sie sich aus der Affäre geholfen, wenn mein Onkel am Leben geblieben wäre?“
Die Pferdetante sah die junge Frau verwundert an und entgegnete:
„Aber was denn? Liebes Kind, alle Menschen sterben doch zur rechten Zeit.“
Der Kutscher ritt selbst mit den Pferden auf das Nachbargut. Felle und Hufe blitzten, und allen vieren hatte er bunte Bänder in die Mähnen geflochten und die Halfter mit den ersten grünen Birkenzweigen geschmückt. Ehe er die Tiere ablieferte, bekreuzte er ein jedes und sagte dabei: „Ihr geht an meiner Statt. Gott gebe euch gute Tage. Und vefgeßt meine Lehre nicht: Für jedes Haferkorn einen Galoppsprung.“
Als die Leibeigenschaft aufgehoben wurde, war das Haar der Pferdetante schneeweiß und das des Kutschers fing an, zu ergrauen. Er kam zur Pferdetante, warf sich auf die Knie und küßte ihr den Rocksaum.
„Mütterchen“, sagte er, „du hast mir den Namen gegeben, ich bin wie dein leibliches Kind. Schon einmal hast du mich vor dem Unglück bewahrt. Habe auch jetzt Barmherzigkeit. Verstoße mich nicht!“
Die Pferdetante klopfte ihm auf die Schulter. Dann sagte sie: „Mache dir keine betrübten Gedanken. Du sollst mich zu Grabe fahren und kein anderer, und nachher wird für dich gesorgt sein. Ich befehle dir nun, dein Leben lang auf meine Gesundheit zu trinken und für meine Seele zu beten. Denn das sind die beiden Dinge, die ein Mensch vom anderen nötig hat.“
Soviel von der Pferdetante.