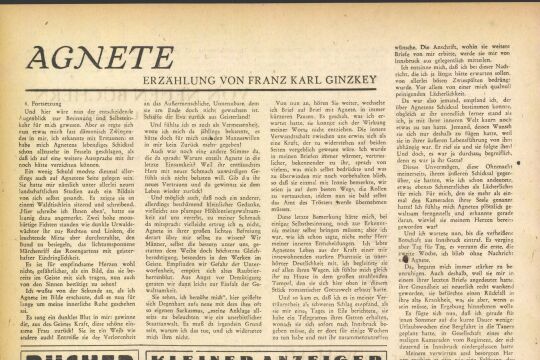Ich hatte das Ungliick, sehr friih Beachtung zu finden. Meine mit vierundzwanzig und fiinfundzwanzig Jahren ge- schriebenen Bucher wurden, was Kritik und Absatz angeht, groBe Erfolge. Als ich 1927 bis 1928 schwer lungenkrank in einem Sanatorium bei Lugano lag, begegnete ich dort einem jungen bayrischen Theologen, Siegfried Huber, der seitdem mein Freund geblieben ist. Er hat mich — durchaus kor- rekt — als einen rein literarisch und intellektuell inter- essierten jungen Mann geschildert, der mit unverhohlenem Staunen einem glaubigen Katholiken gegeniiberstand. Ich habe mit ihm viele Diskussionen uber derlei Fragen gefuhrt und erreichte schlieBlich sogar, daB wir das Zimmer teilten. Mein Interesse war indes in erster Linie rein intellektuell — ich war ganz einfach neugierig. Denn bis dahin hatte ich in keiner Form den geringsten Kontakt mit einer religibsen Welt gehabt. Ich ahnte nicht, was eigentlich eine religiose Erfahrung war.
Das Sanatorium verlieB ich zu friih und war 1931 wieder sehr nahe dem Tode; diesmal waren beide Lungen ange- griffen. Eine vollstandige Rippenoperation auf einer Seite war nbtig, so daB ich seitdem nur zwei Drittel einer Lunge zum Atmen habe.
Keine dieser Priifungen eriebte ich als Katastrophe. Ich war voller Lebensmut und ging, kaum aus der Betaubung erwacht, an meine literarische und journalistische Arbeit. Siebzehn Tage nach dem schweren Eingriff konnte ich am Steuer meines Wagens das Krankenhaus verlassen, wo mir der Chirurg mindestens ein halbes Jahr zugedacht hatte.
Vielleicht trugen mich mein Lebenshunger und meine Sehnsucht, mein Leben als schwedischer Schriftsteller und Journalist fortsetzen zu kbnnen.
Da trat die entscheidende Wende in meinem Leben ein.
Die meisten Menschen kbnnen wohl ein bestimmtes Er- eignis als die Katastrophe ihres Lebens bezeichnen: ein persbnliches oder wirtschaftliches MiBgeschick, enttauschte Liebe, schwere Krankheit oder auch hoffnungslose Ent- tauschung fiber alle in die Kinder gesetzten Erwartungen. Was mir geschah, war etwas vbllig anderes. Die Katastrophe war fiir jeden anderen als fiir mich selbst schlechthin un- merkbar, ja unbegreiflich. Sie vollzog sich in einem Bereich, in dem eigentlich niemand entscheidende Katastrophen zu erleben pflegt — hochstens gelinde Beunruhigung. Mich aber schlug sie „knockout“.
Die folgenden Jahre sahen mich in innerer Wirmis. Ich verlieB Stockholm, um ganz isoliert auf dem Lande zu leben und zu schreiben, unter anderem auch Essays iiber die katholische Renaissance in der franzosischen Literatur — Berna- nos, Bloy, Claudel, Mauriac, Maritain, die heilige Therese vom Kinde Jesu und viele andere. Menschen schrieben mir und dankten mir dafiir, daB ich sie durch meine Essays zum katholischen Glauben gefuhrt hatte — ich, der ich selbst diesen Glauben nicht besaB! Als Di ch ter lieB ich nach. Das Leben hatte gleichsam seinen Dutt, seine'-Faszinatibh- mich verloren. Man hat darauf aufmerksam gemacht, daB sich in meinen Biichern keine Naturschilderungen finden. Dafiir gibt es eine Erklarung — ich eriebte das Dasein als ein Gefangnis. Da interessierte es mich nur recht wenig, welch schone Blumen der Gefangniswarter in mein kleines Zellenfenster gestellt hatte.
Man kann es vielleicht eine geistige Lahmung nennen. In einem gewissen Grade war sie vorhanden. Noch immer bedarf es groBter Anstrengung, mich zu erinnem, wie das Leben sich mir darstellen konnte — bliihend, voll Duft und Lockung —, bevor mich dieser Schlag zu Boden warf. Seitdem waren mir viele andere Erfolge beschieden, wie mir iiberhaupt viel zuviel Anerkennung im Leben zuteil geworden ist; doch nie hat es mir das damals Verlorene ersetzen kbnnen. Am ein- fachsten la (it es sich vielleicht so ausdriicken: Jede Spur von Geborgenheit war aus meinem Leben gewichen. Andere Menschen besitzen meist irgendwelche verlaBliche Sicherheiten, auf die sie sich zuletzt immer zuriickziehen kbnnen. Ich hatte nichts dergleichen. Gerade die Stellungen im Leben, wo es Sicherheit und Geborgenheit geben sollte, waren fiir mich klaffende Wunden. Und diese Wunden haben sich nie schlieBen wollen.
Das Erlebnis, das ich auch heute noch nur mit zitternder Hand zu beschreiben vermag, brachte mich in seelische Not. Nicht, daB es meine Arbeitskraft beeintrachtigt hatte. Aber ich blieb gleichsam vergiftet. In meinem UnterbewuBtsein herrschte sozusagen ein Gestank, den auszuliiften mir nie richtig gelingen wollte. Natiirlich verlor ich meinen Schlaf. Jahrzehnte hindurch weckten mich Nacht fiir Nacht die glei- chen Angsttraume, eigentlich nur idiotische Photographien einer Wirklichkeit, der ich einmal begegnet war So trium- phierend, so brutal, so sinnverwirrend hatte die Raubtier- fratze des Lebens mich angegrinst, daB ich seitdem nie etwas anderes vor mir sehen konnte.
Nur eine einzige wertvolle Waffe hatte ich in meinem Leben einzusetzen: meine Hartnackigkeit. Ich versteifte mich also auf leidenschaftlichste Gegenwehr und erprobte alle Mittel. Je scharfer ich also meinen Feind fixierte, desto intensiver wurde mir seine Existenz bewuBt, und desto groBere Macht gewann er uber mein UnterbewuBtsein. Stapel von Biichern, Notizblbcken, Bleistiften lagen mir neben meinem Bett zur Hand. Sobaid der Alp mich weckte, machte ich Licht und zwang mich zur Lektiire eines schwierigen Textes, meist Zeile fur Zeile unterstreichend, damit dem Damon nicht die geringste Chance bleibe, sich stbrend dazwischen- zuschieben. Nach einer Weile schlief ich dann vor Erschop- fung ein, aber nur, um bald wieder aus einem ahnlichen Fol- tertraum aufzuschrecken. Heute noch spielen sich meine Nachte ungefahr ahnlich ab. Lese ich in der Presse, ich sei ein gelehrter und belesener Mann, so muB ich insgeheim lachen: Ach, wenn ihr wiiBtet, wann ich lese und weshalb! Ich bin ja fbrmlich in die Gelehrsamkeit von meinen Damo- nen hineingejagt worden
Meine Umgebung durfte von diesen Vorgangen nicht viel gemerkt haben. Wundere ich mich doch selbst, daB ich weiterhin produktiv bleiben und gar nicht so selten guter Dinge sein konnte. Immer noch hatte das Leben ja viel Lockendes; meist waren das die seelischen Durchbriiche, die inneren Prozesse, die eine Lbsung meines eigenen Problems zu bedeuten schienen. Ich kam jedoch nie in ihre unmittelbare Nahe. Aus einer gliihenden, ja oft mit Neid vermischten Sehnsucht schrieb ich meine franzosischen Essays uber die Bekehrung Psicharis, die Seelenkampfe Jacques Rivieres, das heroische Ringen des Frontfliegers Jaques d’Arnoux mit sei- nem eigenen Schicksal und mit seinem verstiimmelten Kor- per. Ich liebte sie, diese katholische Phalanx in Frankreich, die mehr fur mich bedeuten sollte als irgendwelche Freunde meines Kreises. Natiirlich waren alle diese geistig-seelischen Erfahrungen in der protestantischen oder entchristlichten Atmosphare Schwedens Terra incognita.
Zu meinem Problem gehbrte auch die Versuchung, dem HaB Raum zu geben. Immerhin hatte ich von Anfang an so viel Besinnung, daB ich mir sagte: Hier darfst du ganz einfach nicht versagen! Das Problem des „Widersachers“ wurde mir zum Zentralproblem. Wie bekampft man seinen eigenen HaB gegen einen schonungslos grausamen Gegner? Keine Mbglichkeit, ihn zu vergessen — unausgesetzt verfolgt er mich, erinnert mich standig an seine Existenz. DaB ich ihm nie das geringste Ubel angetan, spielt keine Rolle. Sehr bald merkte ich, daB mir hier eine peinliche Niederlage drohte — namlich von Selbstmitleid angesteckt zu werden. Ich habe den Eindruck, 30 Jahre lang 99 Prozent meiner geistigen Reserven ausschlieBlich auf das Niederzwingen dieser bbsen Versuchung verwendet zu haben. DaB ich als Schriftsteller hinter meinen eigenen Anspriichen zuriickblieb, riihrt natiirlich von dieser Niederlage her — nie konnte ich mich freimachen. Wohin ich mich wandte, hatte ich das Untier auf den Fersen und fiihlte es hechelnd nach mir schnappen. Nach auBenhin konnte ich mich froh und heiter geben, ich hatte einen Kreis von Freunden und insofern von Natur aus eine gesunde Anlage, als ich miihelos zuhbren, mich von sachlichen Zusammenhangen faszinieren lassen, mich selbst vergessen konnte. Auch flel mir die Einsicht nicht schwer, daB mein eigenes Problem — das ich nie anderen gegeniiber beriihrte und das wohl auch meinen Freunden unbekannt ist —, „reell“ betrachtet, recht belanglos war. Die meisten Menschen hatten weitaus mehr gelitten und auBer- dem nie jenen Ausgleich durch Freuden besessen, an denen mein Leben reich war: Familie, heranwachsende Kinder, interessante Arbeitsaufgaben, ein starkes Echo im Lande auf das, was ich ausgesagt haben wollte — und viel anderes.
Nichts half. Ich begann gleichsam zu vergletschem. DaB ich Naturschbnheit in keinem Augenblick als Trost Oder Zuflucht empfinden konnte, erwahnte ich schon. Aber auch sonst bot sich mir kein Ort und Hort der Sicherheit. Ich fiihlte mich wie ein einsamer Festungskommandant, der allnachtlich ruhelos die Walle abschreitet, um die Wachen zu inspizieren. Jeden Augenblick konnte ein neuer Sturmangriff kommen; noch einmal durfte ich mich nicht so schandlich iiberrumpeln lassen.
Uber diese Erfahrungen — meine innersten und eigent- lichen — habe ich nie geschrieben. Ich schrieb iiber andere Dinge: iiber Menschen, denen es gelungen war, derartige Lahmungszustande abzuschutteln, iiber erstorbenes Gefiihls- leben, das plbtzlich wieder aufbliihte, iiber heldisches Tun fifrf ru»d .geistiges Ringen, audh iiber drastische und komische Motive im Webteppich des Lebens. Die wache Kritik spiirte jedoch bald, daB der Ton nicht ganz edit war. Das Wesent- liche verbarg ich. Ich sang Loblieder auf die Freiheit und war selbst — unfrei.
Ich entsinne mich, wie erstaunt ich in diesen mein Herz vereisenden Jahren war, in der Literatur oder im Leben Ausdriicken der Dankbarkeit — und zwar sichtlich aufrich- tigen und authentischen — fiir das Leben selbst zu begegnen. Wie konnte man dem Leben dankbar sein? Wie konnte man sich freuen, ohne eigenes Verschulden in einen so absurden, so entwiirdigenden Zusammenhang gestellt zu sein?
Paris war mir von jeher vertraut. 1946 bis 1947 und zeit- weilig 1948 war ich dort ansassig — ich hatte eine eigene Wohnung und eine franzbsische Hausgehilfin und isolierte mich bewuBt von Schweden.
Ich suchte unmittelbaren Kontakt mit franzosischen Prie- stem, leider ohne Erfolg. Entweder nahm man mich nicht ernst — unvergeBlich Francois Mauriacs Staunen, daB iiberhaupt jemand erwagen konnte, in Paris zu konventieren! —, oder ich geriet an halb pathologische Priester. SchlieBlich aber kam ich an die richtige Stelle, in das Benediktinerkloster Abbaye de Saint Marie an der Rue de la Source. Dort schloB ich mich mit der Zeit besonders an Dom Charles Massabki an, der, spater als hervorragender theologischer Schriftsteller bekannt, eigentlich vom Libanon stammte.
Das Intellektuelle und das Kirchliche nahm mir nicht viel Zeit; in diesen Fragen war ich seit langem Spezialist. Auch war mir klar, warum ich unmoglich Protestant sein konnte. Die Oxfordgruppe hatte mich von allem, was auf eine sub- jektivistische und puritanisch-moralistische Deutung des Christentums hinauslief, abgeschreckt. Der Kontakt, den ich erstrebte, war Christi eigene Kirche — der feste Grund. Ich spiirte keinerlei Unruhe und Zweifel, nun ebensowenig wie in friiheren Phasen meiner geistigen Entwicklung. Ich war langsam vorgegangen, hatte mich gut vorbereitet, beizeiten alle denkbaren Einwande mobilisiert — ich wuBte, was ich tat. Dies war meine Heimat, soweit ich mir iiberhaupt ein Heim auf Erden vorstellen konnte.
1947 wurde ich in die Kirche aufgenommen.
Endlich war ich daheim. Statt all dem groBsprecherischen Getue, all der psychologischen Taktlosigkeit, all der naiven amerikanischen AnmaBung in Caux — Schweigen, stilles Wirken, uralte Weisheit, unermeBliche Erfahrung mit irrenden Menschenherzen. MRA (Moral Rearmement) rneinte, man konne durch flottes .dealing" (Mitteilen) vor einem Team oder einem Kameraden bedriickende Probleme restlos wegraumen.
Als ich im Laufe der Zeit das Zentralproblem meines Lebens mit meinem neuen Beichtvater und Freund anschnitt, traf mich ein verwunderter Blick: Dealing und reden und ausbreiten? Wozu? Der einzige, vor dem sich auszusprechen man AnlaB habe, sei Gott. Und danach sei die einzig richtige Haltung — Schweigen und Warten. Sehr bald entdeckte ich, daB er mein Problem mit ganz anderen Augen ansah. Es war durchaus nicht so sicher, daB ich „kuriert“ wurde. Weshalb kam ich uberhaupt mit Anspriichen auf „Gesund-Werden“? Hier ging es nicht darum, daB mein Weg leichter werde, sondern daB er zu einem richtigen Ziel fuhre. Ob ich dort dann seelisch befreit und heiter oder