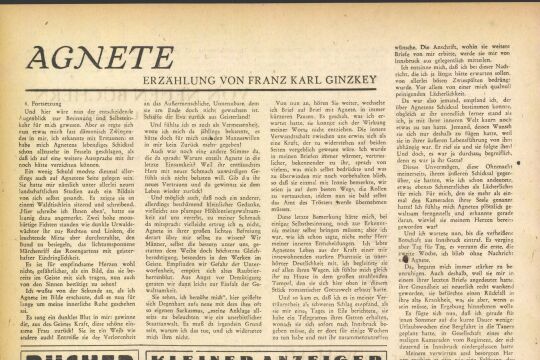Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
NICHT NUR SOLDAT UND P. O. W. ,
Einer von den vielen tausenden österreichischen Kriegsgefangenen des .zweiten Weltkriegs nimmt hier das Wort, um der besonderen seelischen Situation, in der sich diese Österreicher als Angehörige eines vergewaltigten Volkes befanden, Ausdruck zu geben — nicht in nachträglichen Reflek- tionen, sondern in echten Tagebuchaufzeichnungen. Der Autor hat stellvertretend für alle österreichischen Kriegsgefangenen, aber auch für ihre Angehörigen in der Heimat, seine Stimme erhoben, um eine zutiefst menschliche Tragödie dem Vergessen zu entreißen. In diesem Buch wird jedoch keine Anklage erhoben; es ist vielmehr ein menschliches Dokument, das durch die Gesinnung überzeugt, in der dieses Kriegsgefangenenschicksal erlitten wurde. (Thomas Rosner, „P. O. W. 332.624“. Tagebuch eines Kriegsgefangenen. Soeben erschienen im Verlag Herold, Wien-München.)
Kap Spata, 18. Mai 1945
Da wir uns nun, wie ich hoffe, bald Wiedersehen werden, ist es auch Zeit, Rückschau zu halten auf die vergangenen Jahre, auf meine Soldatenjahre und auf die Jahre deiner Einsamkeit. Dabei wird mir bewußt, daß wir eine Ehe, die vor sechs Jahren geschlossen wurde, jetzt erst zu leben beginnen werden.
Ich erinnere mich, da ich darangehe, die Bilanz der letzten Jahre zu ziehen, des 18. November 1940, unseres ersten Hochzeitstages. Es ist so überaus symbolisch gewesen, daß mich während unseres kargen Festmahls die Nachricht über meine Versetzung zum „Feldheer“ erreichte. Diese Nachricht trug eine besondere Bitterkeit in sich, weil wir stündlich die Geburt unseres ersten Kindes erwarteten. In der hilflosesten und glückhaftesten Stunde zugleich, die es für eine Frau geben kann, mußte ich dich allein lassen. Ich will gar nicht mehr an die Wehmut eines Abschieds denken, der jahrealte Hoffnungen zerstörte. An einem Vormittag war es, daß ich dich im dunklen Flur unserer Wohnung verließ. Ich wollte nicht, daß du mich zum Bahnhof begleitest, weil ein Abschied vor dem ausfahrenden Zug noch viel niederdrückender ist. Nachdem das Aufschlagen meiner Stiefel im Stiegenhaus verhallt war, dem du noch nachhorchen mochtest, warst du allein. Du wußtest dir in dieser Stunde keinen patriotischen Trost, der Nimbus des Heroismus lag dir fern, und du sahst keine Aufgabe und keinen Sinn für mich, wie ich dahin ging, sondern fühltest nur den Schmerz der Trennung. Du fühltest als Mensch, als Frau und als Mutter. Es war eine trostlose Stunde, ganz einfach eine trostlose Stunde.
Seit ihr und heute sind beinahe sechs Jahre vergangen. Unsere Briefe und ein paar Urlaube waren die einzigen freundlichen Sterne, die uns in dieser dunklen Zeit leuchteten. Ich darf nicht sagen, übermäßig Hartes erlitten zu haben. Krakau, Presov, Saloniki, Athen und Kreta waren mir als Stationen meiner fünf Soldatenjahre nicht eben übel gesinnt. Was mit dem Begriff des Soldaten im Krieg verbunden ist, Töten und Verwunden, Gefahr und Mühsal, Kampf und Not, blieb mir weitgehend erspart. Das Schicksal erließ es mir, in diesem unseligen Krieg einen einzigen Menschen zu töten. Ich hatte kein Verhältnis zum „Feind“, sondern bewegte mich im fremden Land mehr als Zivilist denn als Soldat.
Wenn ich heute an diese Jahre zurückdenke, dann finde ich, daß mein ganzes Soldatensein Ohne jeden Eindruck auf mich geblieben ist, wenn mir auch nicht jedes unangenehme Erlebnis erspart blieb. Aber in Wahrheit konnte mich doch kein einziger Vorgesetzter in meiner zivilen Existenz erschüttern und einen Menschen aus mir machen, der sich irgendwie als Soldat fühlte. Mir ist dieser ganze hohle Zauber zwar manchmal auf die Nerven gefallen, aber es fehlte mir jede innere Beziehung zum Militärischen: Ich nahm es in letzter Bedeutung niemals ernst.
Auch der Krieg selbst hat mir eigentlich nicht zu schaffen gemacht. Sein Opfer werden zu können kam mir nicht in den Sinn. Ich rechnete gar nicht damit, vielmehr glaubte ich von Anfang an, daß wir uns Wiedersehen werden. Ich hatte ein offenes Auge für alle schönen Dinge, die mir am Wege lagen. In Krakau konnte ich mich stundenlang ergehen. Die alte Universität, das Königsschloß, die Marienkirche und die vielen anderen Schönheiten suchte ich quasi als Reisender mir anzueignen. In Presov streifte ich die umliegenden Wälder und Ruinen ab. Die Fahrt zwischen Preßburg und Presov entlang der Waag und der Tatra war mir stets ein beglückendes Erlebnis. Der Hafen von Saloniki und der erhabene Anblick des am Rande der Ägäis liegenden Olymp haben mich tief beeindruckt, auch wenn mir dieser Anblick von einem Soldatenheim aus zuteil wurde. Belgrad war als Stadt des Südostens interessant. Die Bahnstrecke zwischen Athen und Saloniki ist voller Kostbarkeiten an landschaftlicher Schönheit. Athen hat mich in seinem südlichen Zauber gefangengenommen. Die Akropolis war ehrfurchtgebietender geschichtlicher Boden. Die Schiffsreise über die Ägäis, vorbei an den griechischen Inseln, beeindruckte mich tief. Ein Sonnenuntergang auf dem Meere ist auch auf einem Truppentransporter bezaubernd. Die Jahre auf Kreta waren durch die Schönheit eines herrlichen Landes und die Gastfreundschaft einer liebenswerten Bevölkerung gesegnet. Ich habe all dies in mich aufzunehmen getrachtet, ohne mich allzuviel von der soldatischen Art der Gelegenheit stören zu lassen, in deren Verknüpfung ich solcher Erlebnisse teilhaftig wurde. Überhaupt suchte ich immer, zu sehen, was zu sehen war.
Eines scheint mir als wesentlich dazuzukommen: Ich versuchte immer, mir einen Rest Selbstbestimmung zu bewahren. Wenn ich daher morgen vor der Schwelle unseres Heimes stehen werde — und dies, glaube ich, mag auch dir viel bedeuten —, dann darf ich dies bis zu einem gewissen Grad mir selbst zugute halten. Gewiß ist das Los eines Soldaten weitgehend dem „Schicksal“ ausgeliefert, aber es ist doch ein Unterschied, ob man sich diesem Schicksal willenlos hingibt oder Ob man einen rationalen Einfluß auf seine soldatische Existenz zu gewinnen sucht. Die Idee des Krieges schließt an sich einen solchen Einfluß aus: Soldat sein bedeutet in diesem Sinne Selbstentäußerung bis zur Aufgabe seines Lebens. Es ist „unsoldatisch“, sich in einem Kreig nach Sicherungen umzusehen, das heißt, sich nicht „einsetzen“ zu lassen, wie der Tag und der Wille des Vorgesetzten es verlangen. Als Soldat hat man sein Leben grundsätzlich verpfändet. Wenn diese uralten Gesetze im Falle des letzten Krieges weitgehend aufgehoben waren, dann einfach deswegen, weil er auf deutscher Seite ein Parteikrieg war, dem sich große Teile des Heeres innerlich nicht verpflichtet fühlten. Das galt prinzipiell für jeden Österreicher, der sein Land von derselben Gewalt überwältigt sah, der er nunmehr als Soldat dienen sollte. Und selbst der Deutsche empfand in diesem Krieg vielfach picht als Deutscher, sondern als Katholik, Sozialist oder Kommunist’, er machte einen politischen Vor- behalt,- sofern er-Sich eben nicht als Nationalsozialist mit dem „Führer“ identifizierte. Da mich verschiedene Gründe abgehalten hatten, nach 1938 ins Ausland zu gehen, weshalb ich damit rechnen mußte, eines Tages zur Wehrmacht eingezogen zu werden, war es, einmal zum Soldaten gemacht, mein andauerndes Bestreben, mich von dieser erbarmungslosen Maschine nicht einfach gebrauchen zu lassen. Viele haben trotz aller politischen Vorbehalte jedoch eine gewisse Scheu, für sich selbst Schicksal zu spielen. Sie wollen keine Verantwortung für die Folgen eigener Entscheidungen auf sich nehmen, sondern lassen es bewußt Sache des Schicksals sein, über sie zu bestimmen. Sie liefern sich seinem Spruch aus, um, was immer dabei herauskommen mag, sich vor sich selbst rechtfertigen zu können: So stand es mir in den Sternen geschrieben. Das ist am Ende nichts anderes als die instinktive Reaktion der Masse auf einen Zustand, der den Selbstbestimmungswert des Menschen auf den Nullpunkt herabmindert, eben auf den Zustand des Krieges, demgegenüber der Mensch nur Mittel in höchster Potenz ist.
Solchen Fatalismus habe ich mir niemals zu eigen gemacht. Ich konnte mich einfach mit dem Gedanken nicht abfinden, eine Null geworden zu sein. Schon die erste Einberufung, die ich — ausgerechnet! — zur Infanterie erhielt, war für mich daher keineswegs tabu, ich suchte sie vielmehr rückgängig zu machen und, da dies nicht gelang, als „Soldat“ noch einmal auszubrechen. Aber ich werde, da ich von Strebersdorf tatsächlich wieder heimkehrte, deshalb doch niemals vergessen, daß einem auch das Schicksal in die Hand spielen muß, wenn der eigene Wille Erfolg haben soll. Nur soweit ich meinen Willen zur Geltung oder nicht zur Geltung bringe, geht von mir selbst ein Einfluß aus. Alles andere hängt von den jeweiligen Umständen ab, ob man „Glück" hat oder nicht — in jeder Lebensrechnung ist dieses „Glück“ die große Unbekannte.
Mein Ziel war von Anfang an, mir immer einen Raum zu sichern, in dem meine persönlichen Interessen geschont waren. Als ich schließlich im Juni zur Nachrichtentruppe eingezogen wurde, war die entscheidende Grundlage für meine geistige Existenz gegeben, für ihre Fortdauer auch während des Krieges. Auf ihr baute sich mein ganzes ferneres Soldatenglück auf, nicht ohne daß ich imitier wieder darauf bedacht gewesen wäre, mein Schicksal selbst zu verantworten. Noch im Sommer 1944, nach meiner Rückkehr vom letzten Urlaub, hat mich ein ausdrücklich bekundeter Wunsch davor bewahrt, die Rückzugsbewegung der deutschen Truppen auf dem Balkan nutzumachen, bei der gerade viele Angehörige meiner Kompanie ums Leben kamen. Ich wäre damals bereit gewesen, jeden anderen für mich aufs Festland fliegen zu lassen und freiwillig auf Kreta zu bleiben. Gewiß: Millionen kehren aus diesem Krieg heim, ohne daß sie die geringste Anstrengung im obigen Sinne machten. Sie ließen das Schicksal mit sich spielen und hatten Glück dabei.
Vielleicht wäre ich auch so wie die vielen anderen wieder nach Hause gekommen. Vielleicht. So aber weiß ich, daß ich und warum ich nach Hause kommen werde.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!