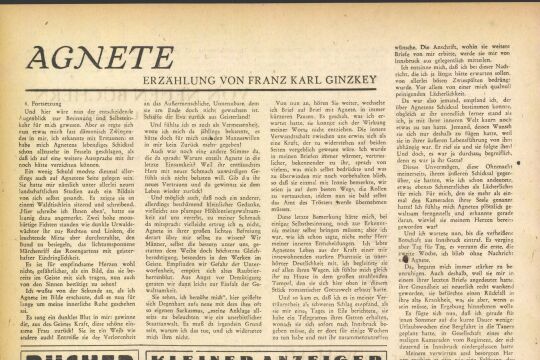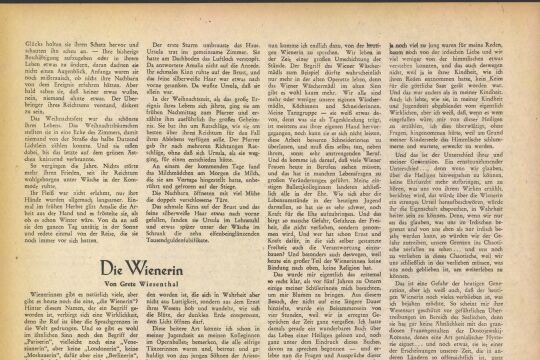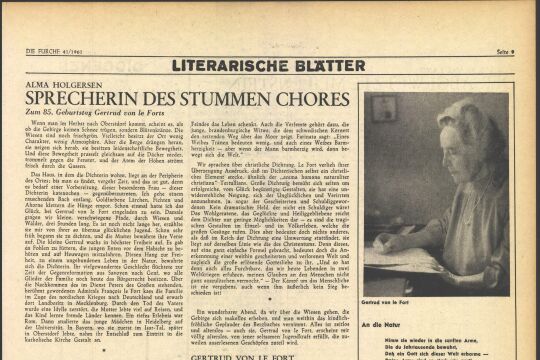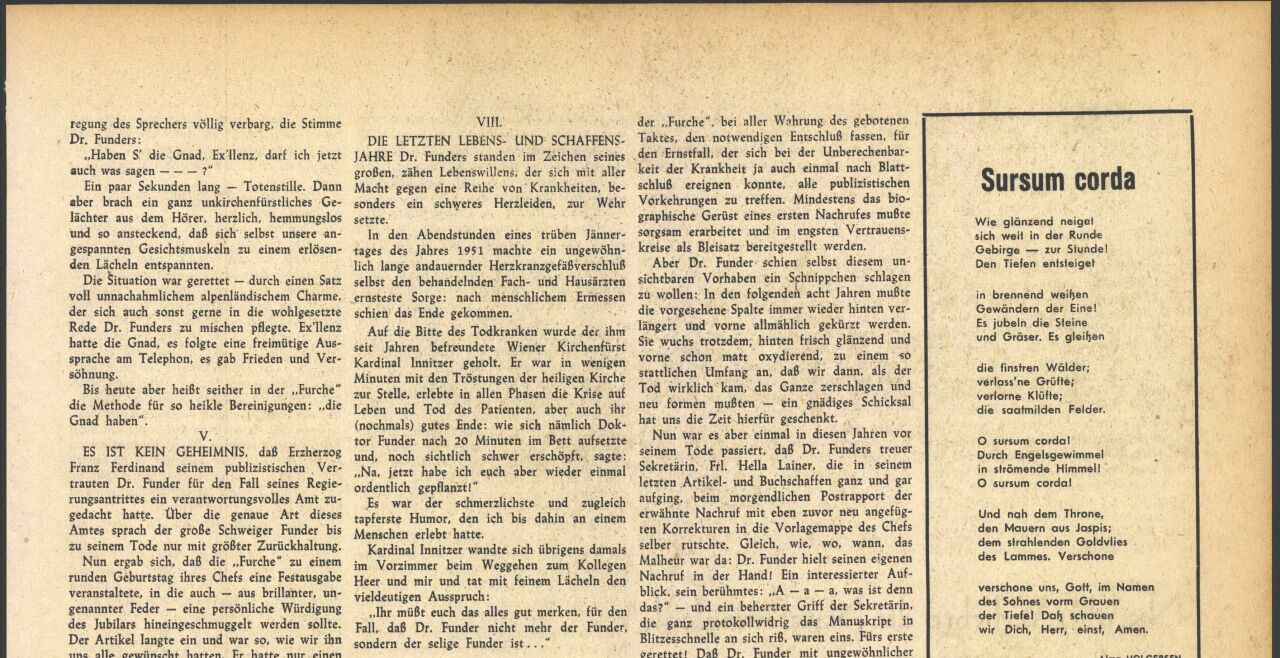
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Bekenntnis
Die Antwort auf die Frage, wie ich zu meiner Dichtung gekommen bin, ist sehr einfach: ich bin nicht zu ihr gekommen, sondern ich war immer mit ihr zusammen, soweit ich zu denken vermag. Zwar lese ich immer wieder in den Besprechungen, die man meinen Büchern schenkt, ich habe spät zu dichten begonnen. Das ist nicht richtig, ich habe im Gegenteil sehr früh begonnen. Man sagt mir, ich hätte als Kind beständig kleine, selbstverfaßte Verschen hergesagt — meine Mutter hat sie aufgeschrieben. Sie bewahrte auch, als ich dann schon schreiben konnte, meine mit schauriger Orthographie hingeschmierten kleinen Reimereien. Mit neun Jahren versuchte ich mich an einem Drama. Aber freilich, meine Entwicklung als Dichterin war eine sehr langsame. Das hing wohl zum Teil mit der Eingezogenheit zusammen, in der ich aufwuchs. Bis zu meinem fünfzehnten Jahr wurde ich privatim unterrichtet. Noch mit zwanzig Jahren nahm mir mein Vater die Romane weg. Wohl habe ich als junges Mädchen einiges veröffentlicht, obgleich nicht alles, was man mir gelegentlich zuschrieb, mir gehört. Es gab da eine Tante Gertrud le Fort, geborene v. Voigts-Retz, die uns einige sehr kitschige Romane schenkte. Meine eigenen kleinen Versuche waren jugendlich unreif, aber nicht kitschig, sie fanden zu meinem Entzücken bei guten Zeitschriften Aufnahme und Ermutigung. Dennoch hörten diese Veröffentlichungen mit meiner zunehmenden Reife fast ganz auf. Ich fühlte — im Gegensatz zu den meisten jungen Dichtern — eine Scheu vor der Öffentlichkeit, mein Maßstab war größer geworden und meine Meinung von mir selbst geringer. Und so ist es sicherlich für mich bezeichnend, daß mein erster wirklicher Erfolg ohne mein Zutun zustande kam, Die „Hymnen an die Kirche“ wurden von einem mir befreundeten Schriftsteller, dem ich sie zu lesen gab, zu meiner größten Überraschung auf die Anzeigeliste seines Verlages gesetzt. Als dieses Buch dann sogar den Beifall Paul Claudels fand, den ich als den größten Dichter unserer Zeit verehrte, erkannte icb in meiner Dichtung einen Auftrag und gab mich ihm hin.
Wenn ich nun über die Absichten meiner Dichtung sprechen soll, so komme ich etwas in Verlegenheit. Denn der Dichter hat ja keine Absichten, er nimmt sich nichts vor: Dichtung ist keine bewußte Werbung für irgendwelche Gedanken, nicht einmal für solche, die dem Dichter teuer sind. Sie hat ihr eigenes Gesetz, sie stammt nicht aus der Reflektion und dem Willen, sondern aus dem Unbewußten. Das bedeutet: sie empfängt ihr Gesetz noch immer von der Muse und ausschließlich von ihr. Man kann sie weder herbeirufen noch sie abwehren, man kann nur für sie bereit sein.
Das einzige, was ich denn auch über das Verhältnis des Dichters zu seinem Werk sagen könnte, habe ich in jenem Insel-Bändchen gesagt, dessen Verse die Überschrift tragen „Stimme des Dichters“. Dieser erscheint hier als der Sprecher eines stummen Chores, er fängt die Sehnsucht der Sprachlosen auf, die Seufzer der Natur und der menschlichen Seelen — die Klage der Toten und den Triumph der Heiligen — jede Stimme kann ihm anvertraut werden, aber in diesem Auffangen des ihm Anvertrauten vollendet und erfüllt er sich selbst — Dichtung ist also, wenn Sie wollen, eine Form der Liebe.
Das gilt nicht nur von der Lyrik: auch Geschichten denkt man sich nicht aus, sondern sie überfallen den Dichter. Mir wird von Freunden oft ein Stoff angeboten, der für mich besonders geeignet scheint, ich finde das auch, aber ich weiß gleichzeitig, daß ich mich seiner nicht annehmen kann, weil er — der Stoff — mich nicht gerufen hat. Dieser Ruf, wenn er ergeht, ist nie zufällig — der Dichter hängt, so glaube ich, gerade im Unterbewußten und Absichtslosen mit seiner Zeit und ihren Forderungen zusammen. Er tut es auch dort, wo sein dichterischer Auftrag — wie der meine oftmals — in die Räume der Vergangenheit zurückgespiegelt ist. Ich habe das Historische nie als eine Flucht aus der eigenen Zeit empfunden, sondern als den Abstand, von dem aus man die eigene Zeit schärfer erkennt.
Man sagt mir, daß in meinen Dichtungen das weibliche Element besonders hervortrete. Ich finde das nicht nur richtig, sondern es freut mich auch. Ich habe in zwei Weltkriegen von unerhörter Grausamkeit die Überbetonung der männlichen Kräfte erlebt und bin mit dem großen russischen Philosophen Berdjajew der Ansicht, daß die Frau in Zukunft eine größere Bedeutung als bisher gewinnen muß. Die Frau ist ihrem ganzen Sein nach die Trägerin und Beschützerin des Lebens, und heute gilt es wie noch nie, das Leben zu beschützen: nicht nur den Menschen, sondern auch Tier und Pflanze, ja die ganze Schöpfung! Das Hervortreten der Frau in meiner Dichtung hat denn auch nichts mit vordergründlichen Frauenproblemen zu tun — es geht um etwas viel Tieferes und Allgemeineres. Es wird nicht durch politische Aufträge und Ämter erreicht, obwohl es natürlich auch von solchen her erreicht werden kann, aber es ist nicht daran gebunden. — Die unbekannte Frau aus dem Volk kann es ebenso in die Waagschale der Welt werfen wie die an weithin sichtbaren Platz gestellte. Es geht um das Vertrauen auch auf die verhüllten Kräfte.
Von daher ist in meinem Buch „Die Tochter Farinatas“ die kleine machtlose Bice zu verstehen, die ihre Vaterstadt rettet. Von daher ist Anne de Vitre zu verstehen, die, den Haß ihres Volkes überwindend, dem Kind des Feindes das Leben schenkt. Von daher gesellt sich ihnen die „Verfemte“ zu, die junge brandenburgische Witwe, die dem schwedischen Kornett den rettenden Weg über das Moor zeigt. Vor allem aber gehört hierher mein Buch „Die Ewige Frau“: in ihm, dem nicht die Dichtung, sondern der Gedanke gebietet, hat auch die bewußte Absicht ihren Platz. Es scheint mir nicht zufällig, daß der Ruf Berdjajews nach der Frau mit einer Zeit gesteigerter Marienverehrung zusammenfällt. In der Mariengestalt, die das Christuskind im Arm hält, erscheint die Trägerin des Lebens als Trägerin des göttlichen Lebens: die vollendete Linie der Frau, die Marienlinie, weist über sich selbst hinaus, strömt über in die religiöse Berufung aller. Es war denn auch ein er-schütternd-beglückendes Erlebnis für mich, als mir der Brief eines ehemaligen französischen Kriegsgefangenen erzählte, wie er sich und seine Kameraden in dem deutschen Gefangenenlager mit meinem Buch „Die Ewige Frau“, das er ihnen übersetzte, getröstet habe. Eine ähnliche Freude ist mir nur noch einmal zuteil geworden, als mir deutsche Heimkehrer schrieben, wie sie auf dem Transport in russische Gefangenschaft aus einem westpreußischen Gutshaus mein Buch „Die Letzte am Schafott“ mitnahmen und sich dann immer wieder mit ihm trösteten. Diese beiden Briefe sind mir kostbarer als viele literarische Besprechungen.
Man mißversteht denn auch meine Dichtung, wenn man sie einseitig auf die Frau bezogen sieht. „Eines Weibes Tränen bedeuten wenig“, sagt Farinata in meiner gleichnamigen Novelle, „und auch eines Weibes Barmherzigkeit bedeutet wenig, aber wenn der Mann barmherzig wird, dann bewegt sich die Welt.“ Zu Farinata gehört die Gestalt Tillys aus meiner „Magdeburgischen Hochzeit“, dieser große unerschrockene Soldat, der zugleich den Soldaten jenes Maß von Menschlichkeit und Erbarmen lehrt, ohne das der Soldat zum Träger der Barbarei wird. In der Legende „Die Vöglein von Theres“ überwindet sich der trotzige junge Sachsenherzog, dem verhaßten Königskind der Karolinger die in den Staub gefallene Krone aufzuheben, und erweist sich dadurch unbewußt würdig der Königskrone, die er später tragen soll. In dem Roman „Der Papst aus dem Ghetto“, in dem fast nur männliche Gestalten auftreten, unterliegt der Papst Paschalis dem gewalttätigen Salier, beugt ihn aber zugleich in einer tieferen Sicht.
Hier erhebt sich die Frage nach der christlichen Bedeutung meiner Dichtung überhaupt. Meine „Hymnen an die Kirche“ beantworten sie vom Stoff, her, allein der Begriff „Christliche Dichtung“ reicht weiter. Ich bin der Überzeugung, daß im Dichterischen selbst ein christliches Element steckt, ähnlich dem, das die Theologen von der anima christiana naturaliter behaupten. Denn wirklich große Dichtung bemüht sich selten um erfolgreiche, vom Glück begünstigte Gestalten, sie hat eine unwiderstehliche Neigung, sich der Unglücklichen und Verirrten anzunehmen, ja sogar der Gescheiterten und Schuldig-Gewordenen. Kein großer dramatischer Held, der nicht ein Schuldiger wäre! Das Wohlgeratene, das Geglückte und Heilgebliebene reicht dem Dichter nur geringe Möglichkeiten dar - es sind die tragischen Gestalten im Einzelund im Völkerleben, welche die großen Gesänge rufen. Dies aber bedeutet doch nichts andere: als daß im Reich der Dichtung eine Umwertun; itattfindet, sie liegt auf derselben Linie wie du des Christentums. Denn dieses auf eine gan: einfache Formel gebracht, bedeutet doch die An erkennung einer weithin gescheiterten und verlorenen Welt und zugleich die große erlösende Gottesliebe zu ihr. Und so hat denn auch alles Furchtbare, das wir heute Lebenden in zwei Weltkriegen erfuhren, meinen Glauben an den Menschen nicht ganz auszulöschen vermocht. Ihm lebt in meinem „Schweißtuch der Veronika“ die Gestalt Spiegelchens, die sich den Dämonien eines Enzio entgegenstellt; ihm lebt die Brüderschaft der „Consolata“, die dem blutbefleckten Tyrannen im Sterben beisteht — ihm lebt die „Frau des Pilatus“, die den schuldbeladenen Gemahl nicht verläßt. So erscheint das Menschenbild bei mir zuletzt überall gerettet.
Man sagt mir, an diesem Punkt unterscheide sich meine Dichtung weithin von der meiner Zeitgenossen und werde höchst problematisch, denn die nur menschliche Liebe sei eigentlich zu schwach für diese Rettung. Vielleicht liegt der Schlüssel in den Worten meiner Novelle „Plus ultra“: „Denn wisse, Kind, es gibt in alle Ewigkeit nur eine Liebe, und die stammt vom Himmel.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!