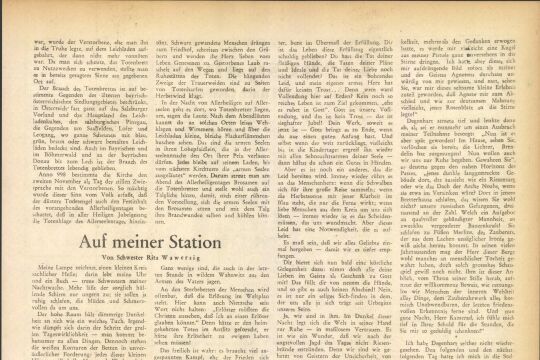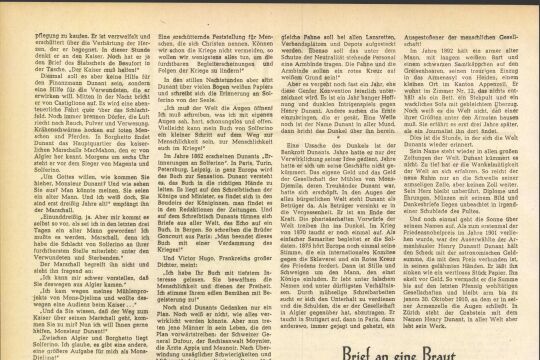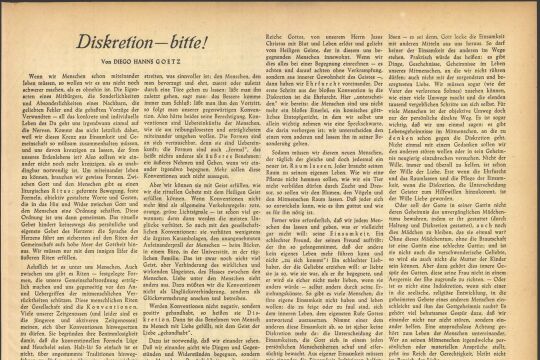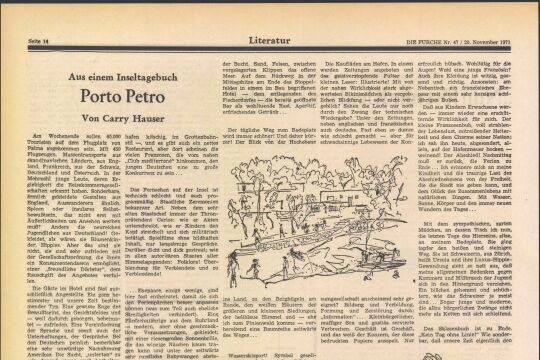Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Stunde des Zweifeins
Durch alle Zeitalter, durch alle Kulturen leuchtet der Begriff des Glücks. Auf griechischen Stelen, in römischen Palästen, unter fernöstlichen Funden, im Herrenmagazin „Playboy“, überall wird felicitas, bonheur, happi-ness, wird das Glück dekliniert und aufgeblasen zum Inbegriff des angeblich Menschenmöglichen. Sein Leuchten jedoch ist ungenau; die Botschaft erreicht uns auf Krücken.
Wenn wir etwa zu den Tonnengewölben des Diokletian-Palastes hochblicken, erstaunt über den sicheren Halt von brüchigem Stein, erkennen wir, daß die Antennen in uns verstört sind, und daß kaum zu hoffen ist, die alte Botschaft mit klarem Kopf zu empfangen. Unsere Hände, dem Tagwerk entfremdet, gehorchen uns seit langem nicht mehr, sie sind Windmühlenflügel und un-vertaute Segel.
Vor der Palastmauer finden zwei Knaben eine Eidechse. Es ist ein smaragdenes Tier mit fast menschenähnlichen Gliedern. Die Buben jagen die Eidechse über den steingepflasterten Platz. Die Bodenplatten sind fest gefügt und erlauben dem Tier kein Entfliehen. Schließlich erschlagen die Jungen das Tier. Die Knaben laufen jetzt fort und grinsen mich an; sie suchen ein neues Opfer.
Mich aber haben sie nicht entdeckt: Ich werde leben, obwohl ich um eine Spur elender weiterlebe, denn ich hätte die Eidechse retten sollen, dazwischenfahren, dem Quälen ein Ende bereiten. Aber ich kenne die Sprache des Landes und die Mentalität dieser Menschen nicht. Mit diesen Lügen verzeihe ich mir. Ich trete jetzt an das Tier heran, das ich getötet habe. Die kleinen Krallen sind unversehrt, sie schreien nach Hilfe.
Vom Turm schlägt dröhnendes Läuten die Stunde. Wenn der Ton herabfällt, sprechen die Menschen lauter. Einige freilich senken ihre Stimmen, werden still wie das Mädchen, dort auf den Stufen, tief im Mittag. Sie brechen die Sprache entzwei, wie das Mädchen die Jugend zerbricht, in zwei Hälften, Schönheit und Trauer. Einige zählen den Pulsschlag der Glocken.
Die Welt läßt Odysseus keinen Raum. Wachs in den Ohren verspricht keine Heimkehr. Natur ist tödlich, kann morden, enttäuschen, verführen, aber nie ist sie grausam. Adjektiva gehören nur uns, den fragwürdig Besitzenden. Im Schatzhaus eines schier unerschöpflichen Vorrates der Adjektiva sind wir reich und entsetzlich belastet zugleich. Kein Fisch lebt auf Dauer in Luft und Wasser zugleich, nichts bewegt sich in mehreren Dimensionen, aber wir leben in Wahrheit und Lüge, in Garten und Wüste, allein und mit dir.
Entlang der Küste hungern wir nach dem offenen Meer, aber die Inseln stehen dagegen. Wir suchen die Naht zwischen Himmel und Meer, diese Naht ist tröstlich trotz ihres Wundseins. Albert Camus dagegen schreibt im Tagebuch, der einzige Ort, an dem er, zum Unterschied von den meisten Menschen, am liebsten leben und auch sterben möchte, sei das Hotelzimmer. Ich stimme bei. Und empfinde beim Betreten solcher Zimmer die erlösende Gleichgültigkeit gegen Schmerzen und Tod. Von Würde spricht keiner. Wer im Hotel stirbt, der bleibt mitten im Leben. Der würde hinausgetragen, in aller Heimlichkeit, damit keiner es merkt. Tote sind eine Schande für ein Hotel. Aber so leichthin man den Tod im Munde führt, so sehr hat man Angst vor der möglichen Grippe.
Wir schulden den Menschen nichts, höchstens die Treue zu unseren Versprechen. Aber wer verspricht, der übernimmt sich bereits - ist es wirklich so? Wer ans Ende geht, verspricht nichts mehr. Wie die denkbare Schuld auch aussehen mag, der Sterbende schuldet sie nur noch sich selber. Er wird bescheiden und erläßt sich die Schuld. Er wäre frei, auf die Straße zu treten, Glas zu zerbrechen, Mensch zu sein. Jetzt grüßen sogar die Krämer aus ihrem sicheren Abstand, die Banken gewähren jeden Kredit. Der Sterbende ist der Herr des Lebens, im Nebel. Er schreibt auch keine Gedichte mehr, denn er fürchtet schlechten Stil.
Nichts wird fertig werden. Unter diesem Himmel wächst kein Werk zur Vollendung. Im Garten sitzen, hinter dem Haus, und nichts verstehen. Wenn Gott die Dauer gehören soll, so gehört die schnell dahinströmende Zeit einem Bereich an, der uns als Chaos vertraut ist. Wir sind aber schön, wenn wir geistige Ordnung in den Körper übersetzen. Das Gesicht des Menschen ist der beste Gottesbeweis. So laufen wir den schönen Gesichtern nach, den schönen Stimmen, den ewigen Augen. Sie haben Macht über uns. Sie bringen die Welt auf einen Nenner.
Wir denken an Menschen. An das Gesicht. Wir zerschellen in Nachtfaltertorheit am schönen Körper. Wir bereuen nicht die Liebe, wir bereuen unsere Kurzsichtigkeit, die uns suchen heißt, was uns nicht erreichbar ist.
Die berühmten Königskinder, die zusammen nicht kommen können, werden sich schon morgen anderen Menschen zuwenden, aus Neugier, aus Hunger, aus Verzweiflung vielleicht. Die ewige Liebe ist die Ironie von Sekunden. Die Harmonie der Welt erklärt sich in ihrer Störanfälligkeit, Ein Knabe längweilt sich an einem Sommertag am Wasser; er wirft Steine in den See, er baut Oktaven aus Heftigkeit. Der Ruhende, der diesen Knaben liebt, zuckt unter den klatschenden Steinen zusammen. Die entstehenden Formen werden alles sprengen, aber auch alles umfassen. Die Welt zerbricht an einem Kinderspiel.
Geschenke kommen, uner-hoffte, und halten auf uns zu. Es gibt die Goldberg-Variationen Bachs, und es gibt Mozart, die Ahnung von dem Willen Gottes, die Welt zu erlösen. Orgien der Verzweiflung gibt es. Und nachts die Sterne: Welcher ist der hellste? Gott schuf die Welt, doch schuf er auch das Echo? Es gibt kein anhaltendes Echo in dieser Welt. Das Land flieht die Landlosen. Wer eine Ankunft dennoch erlistet, der landet auf Granit. Hohe Schule der Hilflosigkeit, Wellenklatschen, unwirtliche Ufer. Es ist immer gut, auf Schiffen zu sein.
Es gibt kein Kommando für Nähe; es gibt für sie kein Wort. Nur das Wasser klatscht gegen die Felsen der Küste, jede Welle dringt ins Blickfeld, besiegelt die Ehe zwischen Augen und Welt, diese ringlose Ehe, deren Frucht in den Falten der Gesichter liegt. Auch in den gefalteten Händen.
Ich denke an Schwimmer—warum nicht Leander? Hero und Leander, die alte Geschichte. Schöne Frische, die einen Körper durchströmt, der bereit ist, ins Meer zu tauchen, einem Ziel zu.
Noch gibt es offene Fragen. Wären Trost und Hilfe verwandt? Hätte Liebe mit Wärme zu tun? Wozu brauchen wir Zärtlichkeit? Aber die Fragen sind tot, wenn keiner sie stellt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!