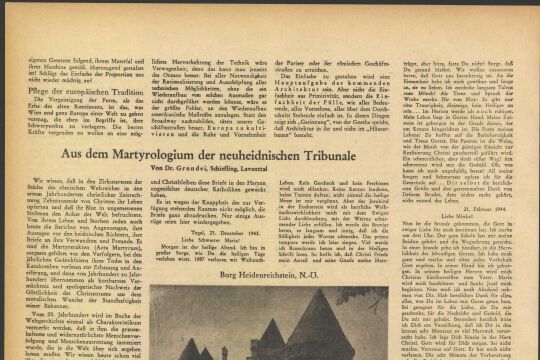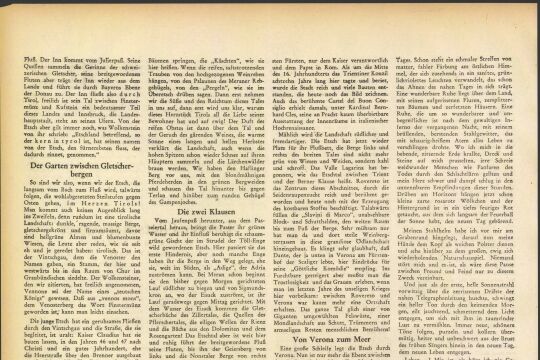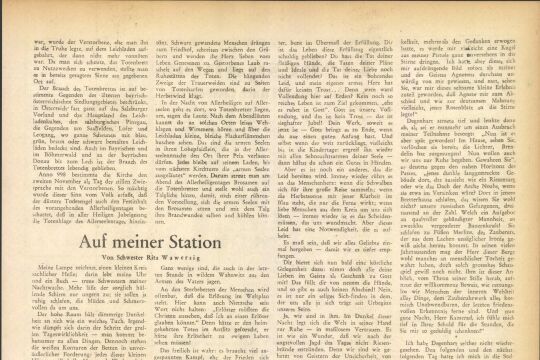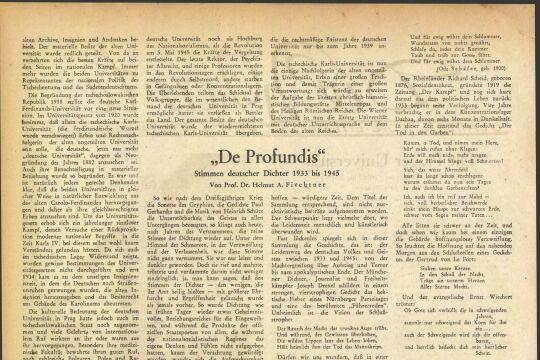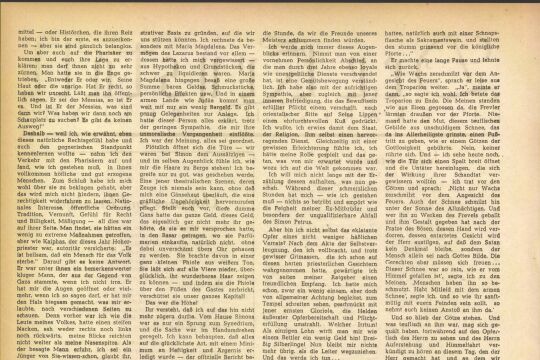Eines der schönsten Responso- rien aus der Weihnachtsliturgie lautet: „dum medium tene- runt omnia et nox in suo curso medium iter perageret, apparuit.“ („Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da stieg Dein allmächtiges Wort, o Herr, vom Himmel herab, vom königlichen Thron.“) Weish. 18,14-15. Dieser Gesangsvers stand bislang im Hintergrund aller Weihnachtsromantik mit dem Christbaum und seinen Lichtern, der Krippe im nächtlichen Stall und der Wanderung zur mitternächtlichen Mette. Heute, wo uns die Glaubensgewißheit weithin abhanden gekommen ist, die Nacht weder still noch heilig ist, bietet sich eher ein anderer Sinn an, ein symbolischer Sinn der Nacht eines Verstummtseins, eines Schweigens, einer Krise, eine Nacht der Verirrung und Sinnlosigkeit - wie das heute genannt werden mag. So erscheint aber auch in ihr nicht unmittelbar sofort das göttliche Kind, sondern andere Dinge, von denen man etwas wie einen Sinn erhofft, nur Chiffren, Zeichen, Symbole, schwer zu enträtseln, aber doch Hoffnung ahnen lassend, wie Inge- borg Bachmann auch einmal sagte: „Und glaube ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land.“ Und: „Die Nacht muß das Blatt wenden.“
Der andere Vers: „Wenn ich in diesem meinem Schweigen ein Wort finde, ist es in mein Leben gegraben wie ein Abgründ“ macht offenbar, was für Ingeborg Bachmann das Wort - der „Logos“ - bedeutet. Der Lärm einer redseligen Betriebsamkeit vernichtet das Wort, das trägt, für das man mit ganzer Verantwortung einsteht, mit dem man steht und fällt. In einem Zeitalter der Indiskretion, das alle Intimitäten vor der Öffentlichkeit ausbreitet, das in alle Intimräume lüstern hineinriecht, hat das Wort sich prostituiert. Neugier, die überall schnüffelt, Opportunismus, der sich allzeit unter dem Idol des Nutzens nach der Decke streckt, Konformismus, der sich nach allen Seiten unverbindlich anbiedert: sie alle finden kein eigenes Wort, das ihnen Sinn gäbe.
Wie eine Krätze breitet sich dieses lärmende Gerede leider auch über den Glauben aus. Man muß nicht gleich einen religiösen Glauben darunter verstehen, sondern überhaupt den Glauben an eine Liebe, einen Menschen, einen Sinn, der trägt, der mehr erahnt als formuliert wird. Schlimm aber, wenn der religiöse Glaube zu einer Glaubensmaschine entartet. Ein funktionelles Nützlichkeitsdenken, eine Eindimensionalität des Denkens, hat auch hier ein behäbiges Wort gefunden, verständlich für jeden Gebrauch, für einen forciert zeitgemäßen Gebrauch, der mit Organisation und Gott im Nachrichtennetz Berge zu versetzen sucht.
„Poesie wie Brot? Dieses Brot müßte zwischen den Zähnen knirschen und den Hunger wiedererwek- ken, ehe es ihn stillt. Und diese Poesie wird scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht sein müssen, um an den Schlaf der Menschen rühren zu können. Wir schlafen ja, sind Schläfer, aus Furcht, uns und unsere Welt wahrnehmen zu müssen“, schreibt Ingeborg Bachmann in ihren Frankfurter Vorlesungen. Widersprüchlichste Werte halten unsere Welt besetzt, von denen wir uns fromm oder unfromm einschläfern lassen. Wir denken in politischen, sozialen, wissenschaftlichen und noch in ein paar anderen Kategorien, Glauben und Aberglauben: ein Spiel mit vorgefundenen, konservativen oder progressiven Spielregeln. Alles zerfällt bei genauerem Hinsehen, wird verwischt und gestaltlos. „Nebelland hab ich gesehen und Nebelherz hab' ich gegessen.“ Niemand hat Mut zum eigenen Gesicht, zum eigenen Wort. Die Menschen rotieren in einer funktionellen Nützlichkeitswelt, reden in einer Gaunersprache, in der alle Begriffe ihre lauwarme mittlere Temperatur besitzen, „ein fortgesetztes billiges Übereinstim- men von Gegenstand und Wort, Gefühl und Wort, Tat und Wort, behäbiges, stumpfes Wort zum Übereinstimmen für jeden Gebrauch.“ (Ingeborg Bachmann)
Dann schon lieber verstummen als ersticken im Geschwätz. Wie groß die Verzweiflung werden kann, zeigt eines ihrer letzten Gedichte:
„Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen,
Was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab als eingefleischt, von jedem Schmerz beraten,
was wahr ist; rückt den Stein von deinem Grab.“
So die erste Strophe des Gedichtes „Was wahr ist“. Und der andere Vers „Was wahr ist, zieht der Erde einen Scheitel“ erinnert an Hofmannsthals Ausspruch: „Das Chaos frisiert sich nicht, Redseligkeit ist die Kunst des Gesindels.“ In dieser Nacht droht der Mund des Menschen zuzufrieren. „Ich aber liege allein im Eisverhau voller Wunden“, und sie ruft, betet, wenn man so sagen will, um das Wort „Komm, Geist aus Laut und Hauch befestig diesen Mund, wenn seine Schwachheit uns entsetzt und hemmt.“
Im Psalm Nr. 4 die ähnliche Bitte: „In die Mulde meiner Stummheit leg ein Wort und zieh Wälder groß zu beiden Seiten, daß mein Mund ganz im Schatten liegt.“
Das ist glaubwürdiger, ja auch christlicher als die Redseligkeit überhandnehmender Funktionäre aus Literaturen und Religionen. Erde, Meer und Himmel, vom Menschen durchforscht und zerwühlt, werden von einem solchen Wort umklammert. Und was die „Lieder auf der Flucht“ in ihrem achten Lied singen,' ist wahrhaft weihnachtlich, wenn auch in einem ganz anderen als den abgebrauchten Klischees alt oder modern auffrisierter Weihnachtsromantik:
„Komm und verbirg dich nicht, mein Wort, errette mich!“ „Die Nacht muß das Blatt wenden.“
So bleibt am Schluß nur noch, den Vers aus Ingeborg Bachmanns Unga- retti-Übersetzung zu zitieren: „Wenn ich in diesem meinem Schweigen ein Wort finde, ist es in mein Leben gegraben wie ein Abgrund.“
Eine andere österreichische Lyrikerin, Christine Busta, macht ähnliche Erfahrungen. Ihr Gedichtband „Unterwegs zu älteren Feuern“ sucht ebenfalls aus dem hektischen, weltlichen und religiösen Zeitbetrieb auszubrechen und „dunkle Weihnachtssteme in Rauhreif und Schnee“ zu suchen, archetypische ältere Feuer der Seele, die aus dem Dunkel der Nacht aufleuchten. Diese sehnsuchtsvolle Haltung ruft Trakl ins Gedächtnis. Hier nur ein Hinweis auf zwei oder drei Gedichte, die exemplarisch für das ganze Werk stehen, die auf seine typische Thematik von Offenbarung und Untergang hinweisen, auf eine Offenbarung, die Trakl mitten im Untergang erahnt. Ein Prosastück, das ganz auf unser Thema hinweist, trägt den Titel „Win- temacht“: Es ist Schnee gefallen. O die Finsternis. Bitterkeit und Frost erfüllen die Luft, durch die der Einsame dahinschreitet, der Verzweiflung nahe. Still schmilzt und vergessen der kühle Leib im silbernen Schnee hin. Doch beim Erwachen klingen die Glocken im Dorf. Aus dem östlichen Tor trat silbern der rosige Tag.
Ähnlich instrumentiert, doch verdichteter zu drei Strophen, ist das Gedicht „Winterabend“. Heidegger sagt zur ersten Strophe: „Der
Schneefall bringt die Menschen unter den die Nacht verdämmernden Himmel. Das Läuten der Abendglok- ken bringt sie als die Sterblichen vor das Göttliche. Haus und Tisch binden die Sterblichen an die Erde. Die genannten Dinge versammeln, also berufen, bei sich Himmel und Erde, die Sterblichen und die Göttlichen. Die vier sind ein ursprünglich-einiges Zueinander.“ Und zu den beiden letzten Versen der zweiten Strophe („Golden blüht der Baum der Gnaden aus der Erde kühlem Saft“) meint er: „Der Baum wurzelt gediegen in der Erde. So gedeiht er in das Blühen, das sich dem Segen des Himmels öffnet. Verhaltenes Wachstum der Erde und die Spende des Himmels gehören zueinander. Das Blühen birgt die unverdient zufallende Frucht: das rettende Heilige, das den Sterblichen hold ist. Im golden blühenden Baum walten Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen.“
Brot und Wein werden ebenfalls genannt, in einem zwiefälti- gen, in einem weltlichen und sakralen Sinn. Im weltlichen Sinn werden sie in anderen Gedichten auch genannt (z. B. „Die Bauern“). Brot und Wein als menschlich-irdische Nahrung, genährt am Fleisch der Erde, werden zu sättigender Speise gebrochen und getrunken. Doch sie zeigen im Gedicht „Sebastian im Traum“ ihr Geistiges. Der Dichter meint den Abend einer Wanderschaft und zeigt, wohin dieser Abendgang den Wanderer führt: an die Schwelle eines Baues. Das kann ein Haus sein, kann aber auch eine Kirche sein. Oder vielmehr der Bau wandelt sich vom Profanbau zum Sakralbau, das Weltliche also - Abend, Nahrung, Bau - wandelt sich zum Geistlichen; die Welt und ihre Landschaft wandelt sich beim Läuten der Abendglocke gleichsam zum Gottesbau, Irdisches zu einem Raum, in dem eine Wanderschaft sich ausruht - die dunkelnächtigen Pfade führen an ein Tor der Stille.
Der Wanderer tritt still herein, dem Betrieb, der oft nichts als den leiblichen Hunger stillt, entronnen. Doch Schmerz versteinert die Schwelle. Der Schmerz der durchstandenen Nacht verwandelt die Speise, umkleidet sie mit einem göttlichen Schimmer.
Wenn der Mensch diese Nacht auf sich genommen hat und in die nächtliche Besinnung eingetreten ist, wird diese Winternacht heilsam. Wenn wir sie durchstehen, werden wir die Glocken eines rosigen Tages hören, dann wird - um wieder mit Trakl zu sprechen - neben der Flöte des Todes auch die Flöte des Lichtes erklingen. Brot und Wein erscheinen in reiner Helle, der dunkle Abend des Unterganges läßt einen offenbarungdämmernden Abend ertönen: „Gewölk, . das Licht durchbricht, das Abendmahl. Es wohnt in Brot und Wein ein sanftes Schweigen“, lauten zwei Verse aus dem Gedicht „Menschheit“.
„Vom heiligen Schmerz bezwungen langt der Mensch nach Gottes Brot und Wein“, heißt es in der ersten Fassung von „Winterabend“ und im „Gesang des Abgeschiedenen“ werden Brot und Wein von Gottes Händen geheiligt. Der Bruder Mensch ruht von dorniger Wanderschaft aus, heißt es dort, in der beseelten Bläue der Nacht, im Frieden des Mahles. Eine geistliche Dämmerung breitet sich aus, in die Schweigen herabsinkt, der Dichter beführt im Nachen des Todes den nächtigen Weiher, in dem sich die Sterne spiegeln. „Sebastian im Traum“ weiß dann eine Strophe zu singen, die die dunkle Nacht der Seele wandelt:
„Frieden der Seele. Einsamer Winterabend “
Man muß das alles nicht gleich christlich verstehen. Im Gegenteil. Die letzten Gedichte Trakls reden da deutlich. Doch sind es gleichsam archetypische Stimmungen der Seele, die im christlichen Raum eine Erfüllung gesucht haben, solange es noch überzeugend und glaubwürdig war, bevor es sich selbst einer eindimensionalen Betriebsamkeit hingab. Deswegen auch das gläubige Verstummen ins Schweigen.
Das vergehende Herz steht als Lebenszeichen über diesem Dichter. Selbst wenn er in die Todesumnachtung hinabsinkt, in ein Verstummen, ist das glaubwürdiger als vorschnelle Pathetik und spektakuläre modernistisch aufgeputzte Orthodoxie. „Stummheit ist ein Attribut der Vollkommenheit“, sagte Max Brod von Franz Kafka. Nicht umsonst schreibt die Heilige Schrift einem redlichen Geschlecht ins Stammbuch: „tibi silentium laus“. „Dir ist Schweigen Lob.“ Und „wer schnell glaubt, hat ein leichtfertiges Herz.“
„Wir, befaßt mit der Sprache, haben erfahren, was Sprachlosigkeit und Stummheit sind - unsere, wenn so will, reinsten Zustände! - und sind aus dem Niemandsland wiedergekehrt mit Sprache, die wir fortsetzen werden, solange Leben unsere Fortsetzung ist.“ So schreibt Ingeborg Bachmann in einem Essay. „Wir sind unterwegs nach einer Sprache, einem Logos, durch alle schlechten Sprachen hindurch, die wir vorfinden, die nur auf Effekte ausgehen, auf Worthappen erster Güte, mit einem Schreibkrampf in der Hand. Wegfegen diese angezettelten Wortopem, sie verraten und prostituieren für das Wort.“ Unsere Sicht ist wie im Winter, so dicht fallen die Worte, schreibt Heinz Piontek. Im programmatischen Radau gilt es nicht mit diesem anschwellenden Chor der Redseligkeit ebenso lautstark mitreden zu müssen, um sich Gehör zu verschaffen. Nur die radikale Besinnung auf ein Wort, das in unser Leben eingegraben ist wie ein Abgrund, kann in dieser Nacht, die sich über Dunkel mit all den künstlichen Lichtem hinwegtäuscht, den Logos aufleuchten lassen. Die mit verantwortungsbewußtem Emst gestellten Fragen wirken glaubwürdiger als Antworten mit frommen Tendenzen und frommer Schwarzweißmalerei.
Eine junge Studentin, ehrlich abgestoßen vom christlichen und unchristlichen Radau, schrieb neulich: das Wort Glauben steht für eine Welt innerer Erfahrungen, Ereignisse des Alltages, die zum Erlebnis werden und sich dann zu Geheimnissen wandeln,' die zwar leuchten, aber selbst nicht durchleuchtbar werden. Es wird auf bittere Weise finster, läßt man sich seiner Geheimnisse berauben, vergißt oder veruntreut sie.
Diese Geheimnisse wird es immer geben. Auch die exakten Naturwissenschaftler stoßen auf sie und sind sich - wenigstens in ihren wirklichen Größen wie Einstein, Heisenberg oder Planck - ihrer bewußt. Nur ihre Epigonen, die oft eine sehr durchsichtige ideologische Politik treiben in totalitären Unternehmen von links und rechts, atheistische nicht minder als gläubige, verurteilen alle Geheimnisse, alle Tragik als zersetzend, und verordnen einen Optimismus auf Befehl. Der nach Wahrheit suchende Mensch, der Ehrfurcht vor seinem Gegenstand der Forschung hat - sei es ein wissenschaftliches Objekt oder einfach das Leben überhaupt -, wird immer wieder dem Dunkel des Geheimnisses gegenüberstehen, sich mehr oder minder schmerzlich, mit mehr oder weniger Tragik diesen Dunkelheiten stellen müssen, die ihn oft, vor allem in Zeiten der Krise, dem Verstummen überantworten und schweigend verehren lassen.
Die Rätsel Gottes oder der Schöpfung oder des Lebens sind mir lieber als voreilige Antworten, das Er- forschliche erforscht und das Uner- forschliche ruhig zu verehren, meint einmal Goethe. Robert Musil verstummt vor dem „symbolischen Gesicht der Dinge“, wie es der Logiker Wittgenstein schweigend in diesem Urerlebnis sieht. Buchstabierend nur kann er dieses Geheimnis zu fassen versuchen, wie es das gleichnamige Gedicht Pionteks aussagt: buchstabierend.
Schweigend steigen wir in den tieferen Abgrund hinab, um die Wende zu erleben. Die Nacht muß das Blatt wenden.