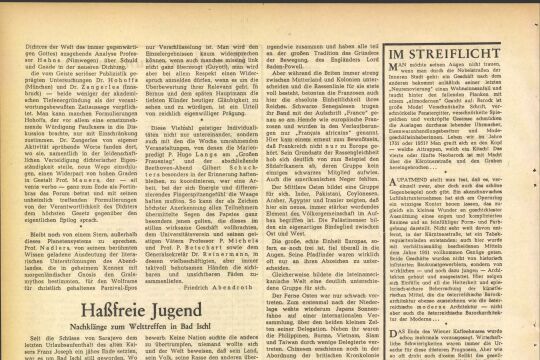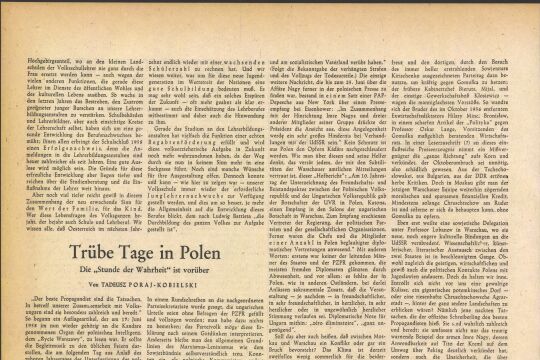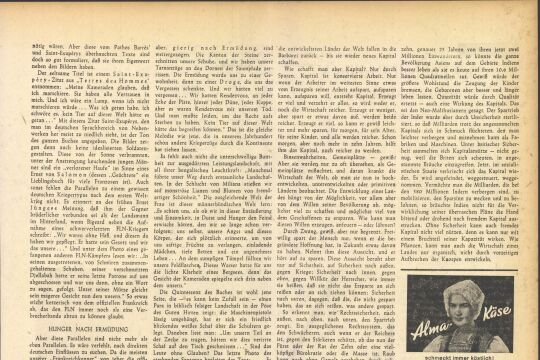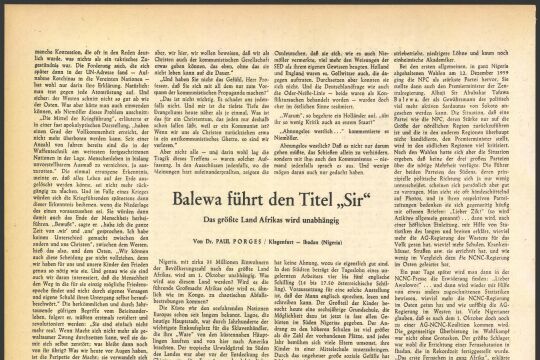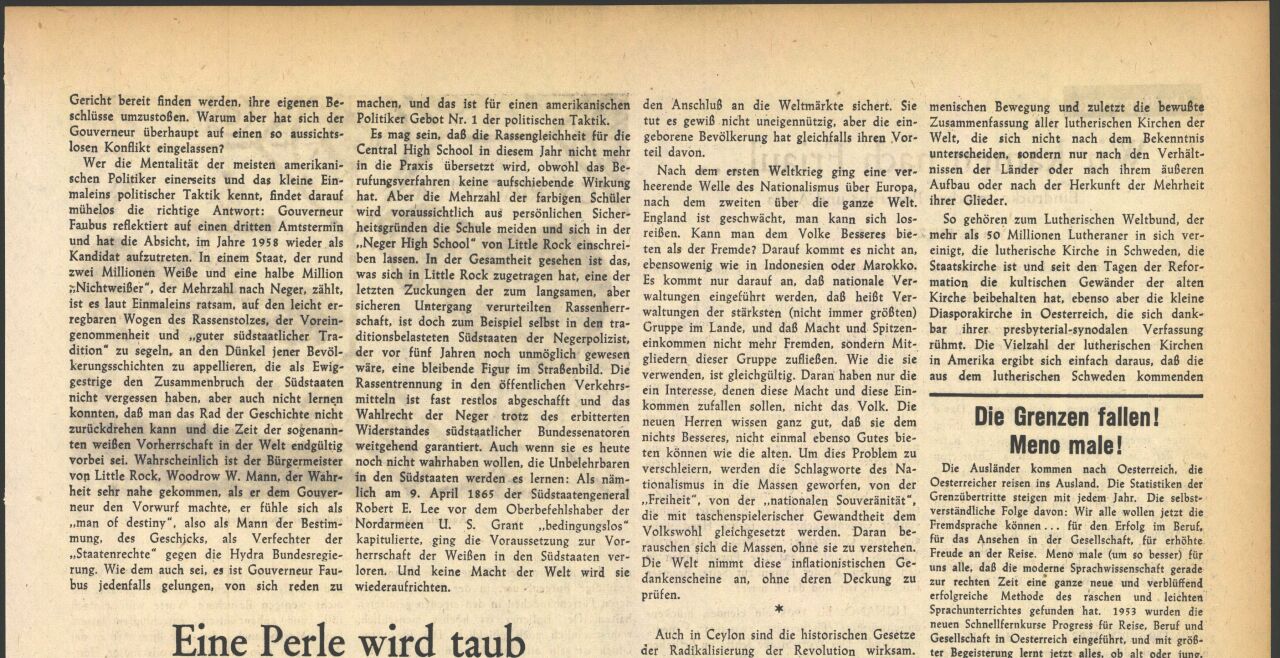
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine Perle wird taub
Das Wappen des neuen Staates Ceylon zeigt den stehenden Löwen der alten singhalesischen Könige mit einem grünen Streifen für die muselmanischen und einem gelben für die tamilischen Volksteile. Alle Gruppen sind also vertreten, bis auf die 600.000 Christen, die immerhin zahlreicher und kulturell ungleich bedeutender sind als die 440.000 Mohammedaner. Aber unter ihnen befinden sich zu viel Weiße, von denen wohl viele länger im Lande leben, als mancher aus Indien zugewahderte Buddhist oder Hindu. Die Weißen werden langsam die Parias des Ostens. Wer denkt noch daran, daß während des ägyptischen Aufruhrs vor einigen Jahręn hellhäutige Einheimische ihr Bild in die. Zeitung setzten, mit der Versicherung,, daß sie zwar1- fast weiß sind, aber doch gute Aegypter seien; man möge sie doch nicht mit den bösen Europäern verwechseln und leben lassen.
Ceylon, das Perlengehänge am Ohrlappen Indiens, wurde die „Perle des Ostens“ genannt, und manche haben den Sitz des Paradieses auf seinen Adams Peak verlegt. Wenn man von Anaradhapura, dem Pompeji Ceylons im Norden, nach der Gartenstadt Kandy und dem Welthafen Colombo im Süden fährt, so sieht man wirklich einen Garten Eden. Eine Plantage löst die andere ab, es gibt keine Frucht der Tropen, die hier nicht wächst. Die Früchte fallen den Bewohnern buchstäblich in den Mund, weder am Land noch in den Städten sieht man Hunger oder Armut. Es war nicht immer so. Und wem ist dies zu verdanken?
Ehe der Weiße kam, hatte das Verhältnis Ceylons zu Indien manche Aehnlichkeit mit dem Englands zu Europa oder Japans zii China in kriegerischer Zeit. Der Ceylonese Dutuge- munu kämpfte gegen den Inder Elala wie die Sachsen gegen die Normannen, aber zwei Jahrhunderte später fiel Gajabahu in Indien ein wie Heinrich IV. in Frankreich. Drei Jahrhunderte nach Karl dem Großen, acht Jahrhunderte vor Bismarck führte Parakramabahu I. eine Einigung mit Blut und Eisen durch, die Hekatomben von Opfern kostete. Die Natur der paradiesischen Insel, die schon den Aegyptern und den Römern bekannt war, war damals nicht ärmer als heute, aber ihre Bewohner waren es, weil ihnen alle Wohltaten der Kriege und Bürgerkriege beschieden waren, die Ehrgeiz und Machthunger weniger den vielen bescheren.
Bis 1580 die Portugiesen mit Kriegs- und Handelsschiffen kamen, die 70 Jahre später von den Holländern und 200 Jahre später von den Engländern abgelöst wurden. Deren Herrschaft war eigennützig, aber doch besser als die der heimischen Ausbeuter, und besserte sich mit der Zeit. Sie war gewiß höchst unvollkommen, wenn man hohe Maßstäbe, wie etwa die der heutigen Schweiz oder Skandinaviens, anlegt. (Zur selben Zeit herrschten übrigens auch in den skandinavischen Ländern Zustände, vor denen wir uns entsetzen, wenn wir daran denken.) Aber was ist aus Ceylon in einigen Jahrhunderten geworden? Man kann von einer Kolonialmacht kein rascheres Tempo verlangen als vom nationalen Fortschritt in entwickelteren 1 ändern.
Nach weniger als 400 Jahren war das Er
gebnis immerhin: eine Bevölkerung von über 7 Millionen auf 25.000 Quadratmeilen, seit langem durch keinen Krieg, keine Revolution, keine Seuche dezimiert; 5 Millionen Singhalesen, meist Buddhisten, 1 % Millionen Tamilen, meist Hindus, mehr als eine halbe Million Christen, weniger als eine halbe Million Mohammedaner, 50.000 Burghers, Reste der holländischen Besetzung, lebten einträchtig, ohne Rassen- und Religionsreibungen miteinander. Die Burghers erfüllen eine ähnliche wirtschaftliche Aufgabe wie die Juden in Osteuropa oder die Inder in Ostafrika, wurden darob milde angefeindet, aber nicht verfolgt. Recht und Ordnung herrschten, von wenigen britischen und nicIit zu vielen einheimischen Beamten beschützt? T efTdrbi|£'hfä8 der Weiße könnte ohne Waffe, Ohne Begldit- schutz jeden Fleck der Insel (270 Meilen in nordsüdlicher, 140 Meilen in westöstlicher Richtung) vollkommen sicher durchwandern, die von 20.000 Meilen guter, teilweise ausgezeichneter Straßen durchzogen wurde. Die größte Stadt, Colombo, mit ihren 350.000 Einwohnern ist ein Welthafen geworden; Kandy, die Priesterstadt in den Bergen, ist eine von fünf Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. Der Wohlstand der Bevölkerung hat sich von Jahr zu Jahr nicht stürmisch, aber stetig gehoben. Das hauptsächliche mineralische Exportprodukt, Graphit, geht in die Vereinigten Staaten und nach England und sichert mit dem steigenden Fremdenverkehr eine gute Handelsbilanz. In Summa ist es ein bescheidenes Paradies auf Erden, soweit es Paradiese auf dieser Erde geben kann. Wem ist das zu verdanken? Der Macht, die im Innern für Ruhe und Ordnung sorgt und
den Anschluß an die Weltmärkte sichert. Sie tut es gewiß nicht uneigennützig, aber die eingeborene Bevölkerung hat gleichfalls ihren Vorteil davon.
Nach dem ersten Weltkrieg ging eine verheerende Welle des Nationalismus über Europa, nach dem zweiten über die ganze Welt. England ist geschwächt, man kann sich losreißen. Kann man dem Volke Besseres bieten als der Fremde? Darauf kommt es nicht an, ebensowenig wie in Indonesien oder Marokko. Es kommt nur darauf an, daß nationale Verwaltungen eingeführt werden, daß heißt Verwaltungen der stärksten (nicht immer größten) Gruppe im Lande, und daß Macht und Spitzeneinkommen nicht mehr Fremden, sondern Mitgliedern dieser Gruppe zufließen. Wie die sie verwenden, ist gleichgültig. Daran haben nur die ein Interesse, denen diese Macht und diese Einkommen zufallen sollen, nicht das Volk. Die neuen Herren wissen ganz gut, daß sie dem nichts Besseres, nicht einmal ebenso Gutes bieten können wie die alten. Um dies Problem zu verschleiern, werden die Schlagworte des Nationalismus in die Massen geworfen, von der „Freiheit“, von der „nationalen Souveränität“, die mit taschenspielerischer Gewandtheit dem Volkswohl gleichgesetzt werden. Daran berauschen sich die Massen, ohne sie zu verstehen. Die Welt nimmt diese inflationistischen Gedankenscheine an, ohne deren Deckung zu prüfen.
Auch in Ceylon sind die historischen Gesetze der Radikalisierung der Revolution wirksam. Die Gironde mußte Robespierre und Kerenski mußte Lenin weichen. Zuerst geht alles ordentlich und verfassungsmäßig zu. Ein Unterhaus von 101 und ein Oberhaus mit 30 Mitgliedern wurde eingeführt. Alle beteuerten, daß niemand die Absicht habe, die Bande mit dem britischen Weltreich zu lockern, von dem man soviel Investitionen und Geld erhalten hatte und noch mehr erhoffte. Man garantierte den Schutz der Minderheiten und lächelte über die paar Kommunisten, die nur einen Stalinisten und zwei Trotzkisten zu wählen vermochten. In allen Weltbelangen trat der Ministerpräsident an der Seite Englands für Schutz des Friedens und Garantie des Rechts ein. Bei den Vereinten Nationen hielt sich die Delegation etwas zurück, wenn die nationalistische Trommel gerührt wurde.
Und plötzlich kam die Wendung. Sinnlose Schlagworte verzerren die Mehrheitsverhältnisse der Parteien, ein WaMätürZ'bringt ;ėineft Radikalei?hinaiif, der sich rhit allen demagogischen Mitteln oben halten will. Dažu ist ihm alles recht, auch wenn es den Weltfrieden gefährdet. Das erste unmittelbare Ziel sind die Flugplätze Englands, die den Sowjets ein Dorn im Fleische sind, denn sie sollen an diesem exponierten Platze Schutz gegen die Sowjetaggression bieten. Sie tun keinem Ceylonesen weh, sondern bringen Geld ins Land. Sie gefährden es nicht, sondern schützen es mit. Aber darauf kommt es den neuen Herren nicht an. Sie schauen nur, wo sie mehr kurzfristige Vorteile herausschlagen können. Dafür sind die Vereinten Nationen die Börse. Daher sieht man Ceylon (teils durch Stimmabgabe, teils durch Stimmenthaltung), dort, wo mehr versprochen wird. Eine Börse ist kein Gericht. Daher gelten nicht Argumente, sondern Anbote. Länder wie Ceylon werden gar bald für die kurzsichtige Befolgung dieser Politik teuer zu bezahlen haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!