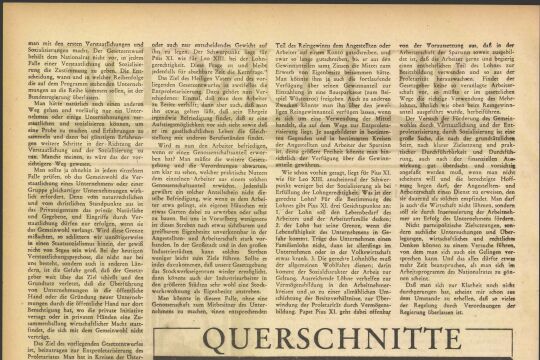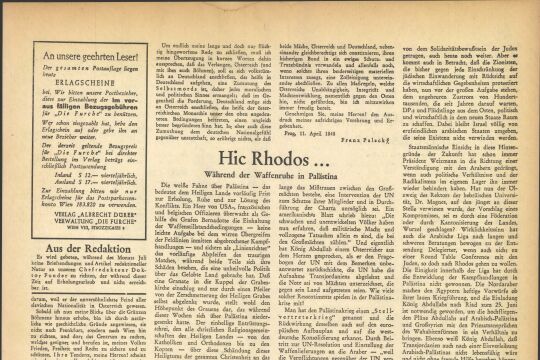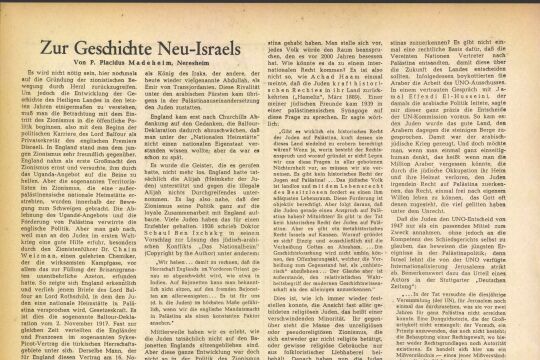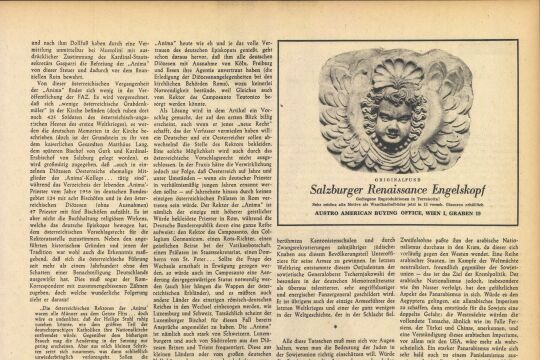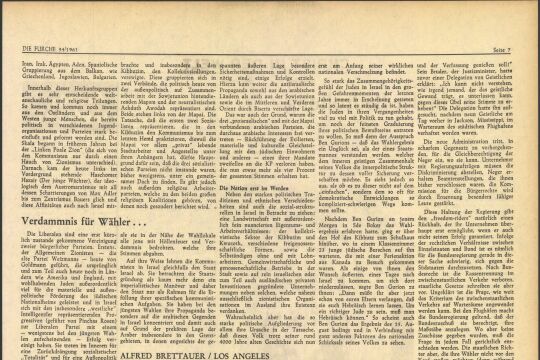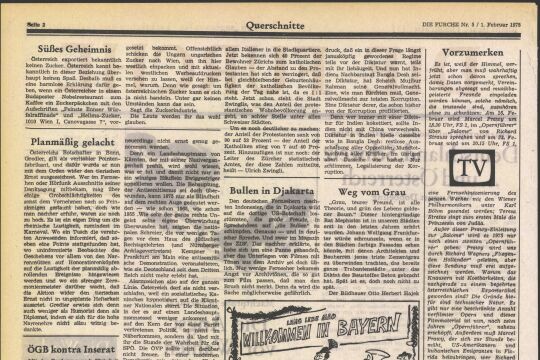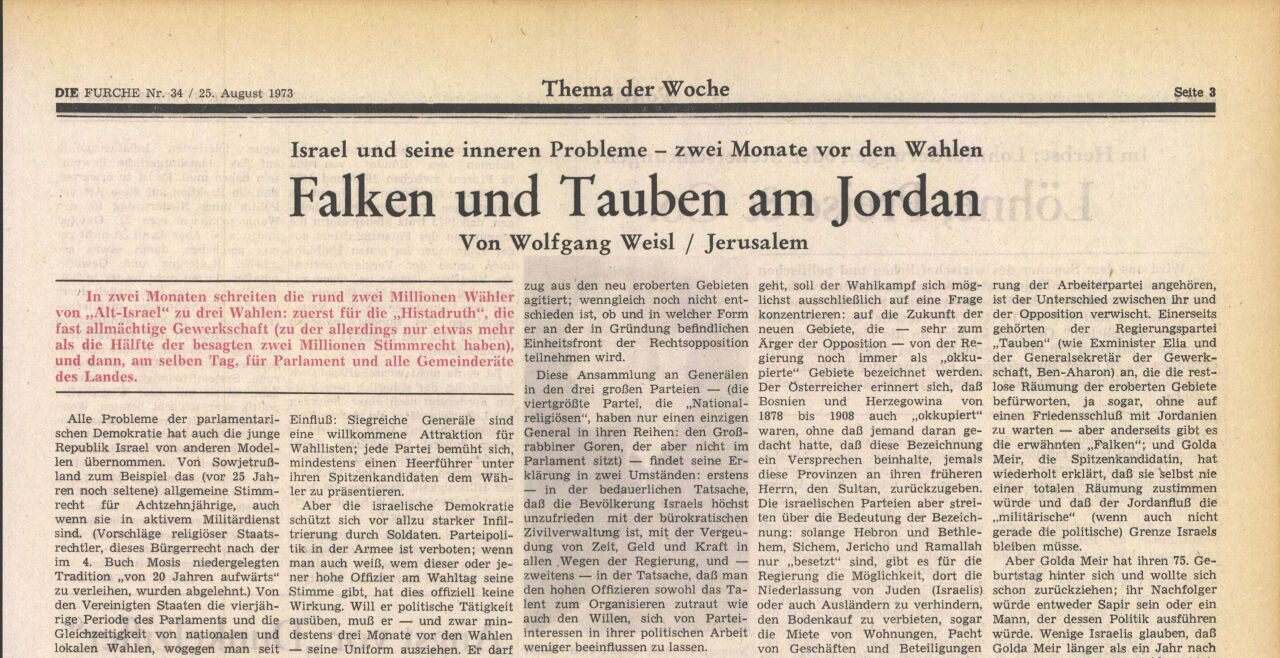
Falken und Tauben am Jordan
In zwei Monaten schreiten die rund zwei Millionen Wähler von „Alt-Israel“ zu drei Wahlen: zuerst für die „Histadruth“, die fast allmächtige Gewerkschaft (zu der allerdings nur etwas mehr als die Hälfte der besagten zwei Millionen Stimmrecht haben), und dann, am selben Tag, für Parlament und alle Gemeinderäte des Landes.
In zwei Monaten schreiten die rund zwei Millionen Wähler von „Alt-Israel“ zu drei Wahlen: zuerst für die „Histadruth“, die fast allmächtige Gewerkschaft (zu der allerdings nur etwas mehr als die Hälfte der besagten zwei Millionen Stimmrecht haben), und dann, am selben Tag, für Parlament und alle Gemeinderäte des Landes.
Alle Probleme der parlamentarischen Demokratie hat auch die junge Republik Israel von anderen Modellen übernommen. Von Sowjetrußland zum Beispiel das (vor 25 Jahren noch seltene) allgemeine Stimmrecht für Achtzehnjährige, auch wenn sie in aktivem Militärdienst sind. (Vorschläge religiöser Staatsrechtler, dieses Bürgerrecht nach der im 4. Buch Mosis niedergelegten Tradition „von 20 Jahren aufwärts“ zu verleihen, wurden abgelehnt.) Von den Vereinigten Staaten die vierjährige Periode des Parlaments und die Gleichzeitigkeit von nationalen und lokalen Wahlen, wogegen man seit etwa zehn Jahren (vergeblich) kämpft. Von der Weimarer Republik das Listenwahlsystem — das übrigens weitgehend auch das Wahlsystem der Zionistenkongresse gewesen ist. Von Großbritannien über-
nahm man den (seit nunmehr 25 Jahren „vorläufigen“) Verzicht auf eine geschriebene Verfassung. Vom Frankreich der Dritten und Vierten Republik die Beschränkung der Staatspräsidenten auf rein formale Repräsentanz: Israels Präsident ist nicht einmal dem Namen nach Oberkommandant der bewaffneten Macht, erklärt nicht Krieg und schließt nicht Frieden, ja, er verleiht nicht einmal Auszeichnungen und Dekorationen für militärische Taten (zivile Orden kennt Israel noch nicht).
Dazu kommen noch parlamentarische Usancen, die teilweise der französischen Praxis der Nachkriegszeit, teilweise der israelischen Abneigung gegen starke Persönlichkeiten entsprangen. Dazu gehört vor allem das Prinzip kollegialer Verantwortlichkeit der Gesamtregierung; das bedeutet praktisch, daß kein Minister für irgend etwas verantwortlich ist. Es bedeutet aber auch, daß der Ministerpräsident praktisch nur soviel Macht ausüben kann, wie ihm seine Kollegen freiwillig einräumen; er darf nicht einmal versuchen, auf die Gebarung eines anderen Ministeriums Einfluß zu nehmen; er kann keinen Minister absetzen oder austauschen — weder einen aus seiner eigenen Partei, geschweige denn den Vertreter der Koalition. Will er etwas an oder in der Regierung ändern, so muß der Ministerpräsident demissionieren; er kann höchstens versuchen, von den Parteiführern ersten, zweiten und dritten Ranges die Zustimmung zu Änderungen zu erhalten.
Ein Wunder des Systems aber ist es, daß die Armee — obwohl etwa 100.000 Mann am Wahltag in aktivem oder Reservedienst unter den Fahnen stehen und das Wahlrecht ausüben — nicht den leisesten Einfluß auf die Innen- oder Außenpolitik direkt ausübt. Indirekt allerdings gibt es einen gewissen
Einfluß: Siegreiche Generäle sind eine willkommene Attraktion für Wahllisten; jede Partei bemüht sich, mindestens einen Heerführer unter ihren Spitzenkandidaten dem Wähler zu präsentieren.
Aber die israelische Demokratie schützt sich vor allzu starker Infiltrierung durch Soldaten. Parteipolitik in der Armee ist verboten; wenn man auch weiß, wem dieser oder jener hohe Offizier am Wahltag seine Stimme gibt, hat dies offiziell keine Wirkung. Will er politische Tätigkeit ausüben, muß er — und zwar mindestens drei Monate vor den Wahlen — seine Uniform ausziehen. Er darf nicht einmal inoffizielle Gespräche über seine spätere Karriere führen, solange er der Armee angehört.
Immerhin: Im gegenwärtigen Kabinett sitzen vier ehemalige Generalstabschef und Armeekomman-
danten: Dayan, Allon, Galili und Barlew. Ein fünfter Exarmeekom-mandant ist Generaldirektor des Verteidigungsministeriums. Ein
sechster (nämlich Rabin, der Sieger im Sechstagekrieg) fordert einen Stiz im kommenden Kabinett. (Umstrittene) Nummer zwei der Herduth-Partei ist der frühere Stellvertreter des Generalstabschefs und Exkom-mandant der Luftwaffe, Eser Weiz-mann (Neffe des ersten Staatspräsidenten); Nummer zwei der mit der Herduth affinierten Liberalen Partei ist der brillante Panzergeneral Erik Scharon, der soeben den Dienst quittiert hat, um an den Wahlen teilnehmen zu können. Ein anderer Ex-general ist Spitzenkandidat der Opposition für den Bürgermeisterposten in Jaffa, Tel Aviv. Noch ein anderer General der Reserve, Jaffee, einer der drei Armeekommandanten im Sechstagekrieg, steht an der Spitze der „Bewegung für die Integrität Israels“, die gegen den Rück-
zug aus den neu eroberten Gebieten agitiert; wenngleich noch nicht entschieden ist, ob und in welcher Form er an der in Gründung befindlichen Einheitsfront der Rechtsopposition teilnehmen wird.
Diese Ansammlung an Generälen in den drei großen Parteien — (die viertgrößte Partei, die „Nationalreligiösen“, haben nur einen einzigen General in ihren Reihen: den Großrabbiner Goren, der aber nicht im Parlament sitzt) — findet seine Erklärung in zwei Umständen: erstens — in der bedauerlichen Tatsache, daß die Bevölkerung Israels höchst unzufrieden mit der bürokratischen Zivilverwaltung ist, mit der Vergeudung von Zeit, Geld und Kraft in allen Wegen der Regierung, und — zweitens — in der Tatsache, daß man den hohen Offizieren sowohl das Talent zum Organisieren zutraut wie auch den Willen, sich von Parteiinteressen in ihrer politischen Arbeit weniger beeinflussen zu lassen.
Dazu kommt eine dritte Tatsache: Es ist ungeschriebenes Gesetz der israelischen Armee, daß kein Offizier, und sei er noch so erfolgreich, länger als allerhöchstens sechs oder sieben Jahre am selben Posten ver-
bleiben darf. Kann er nicht befördert werden — wie jetzt zum Beispiel der Kommandant der Südarmee, Scharon, dem der Aufstieg zum stellvertretenden Generalstabschef durch Ernennung eines Kameraden aus dem Sechstagekrieg, Tal, versperrt wurde —, dann muß er in die Reserve übernommen werden und den Platz für einen Jüngeren frei machen.
Auf diese Weise kommen die populärsten Generäle in viel jüngeren Jahren in die Politik als die meisten Berufspolitiker. Sie scheiden Mitte der Vierzig aus der Armee — während das Durchschnittsalter der anderen Parlamentsabgeordneten an die Fünfzig liegt, und das der Minister in den Sechzigern. Auch das vermehrt ihre Anziehungskraft auf die Wählerschaft, von der ja ein sehr 'großer Teil diese Generäle persönlich aus den eigenen Dienstjahren kennt.
Wenn es nach dem Führer der Rechtsopposition, Menachem Begin,
geht, soll der Wahlkampf sich möglichst ausschließlich auf eine Frage konzentrieren: auf die Zukunft der neuen Gebiete, die — sehr zum Ärger der Opposition — von der Regierung noch immer als „okkupierte“ Gebiete bezeichnet werden. Der Österreicher erinnert sich, daß Bosnien und Herzegowina von 1878 bis 1908 auch „okkupiert“ waren, ohne daß jemand daran gedacht hatte, daß diese Bezeichnung ein Versprechen beinhalte, jemals diese Provinzen an ihren früheren Herrn, den Sultan, zurückzugeben. Die israelischen Parteien aber streiten über die Bedeutung der Bezeichnung: solange Hebron und Bethlehem, Sichern, Jericho und Ramallah nur „besetzt“ sind, gibt es für die Regierung die Möglichkeit, dort die Niederlassung von Juden (Israelis) oder auch Ausländern zu verhindern, den Bodenkauf zu verbieten, sogar die Miete von Wohnungen, Pacht von Geschäften und Beteiligungen an arabischen Unternehmungen zu verbieten, wie das tatsächlich bis jetzt der Fall ist.
Zwar ist es nicht das Privileg der Opposition, die eine Änderung dieser Praxis fordert; auch (und vor allem)
Moshe Dayan verlangt die Freigabe des Bodenkaufrechts und die Besiedlung in allen diesen Gebieten: „Palästina ist das einzige Land der Welt, wo es Juden gesetzlich verboten ist, Boden zu kaufen oder dort zu wohnen“, sagt Dayan. Aber er blieb im Kabinett in der Minderheit. Der derzeit mächtigste Mann der Regierungspartei, der Finanzminister Sapir, dem nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Parteiapparat gehorcht, will unter keinen Umständen die Million zusätzlicher arabischer Untertanen (und künftiger Wähler) haben — vielleicht, weil deren Einverleibung für ewig die Hoffnung der sozialistischen „alten Garde“, die Sapir anführt, vernichten würde, Israel weiter regieren zu können, ohne auf Koalitionspartner angewiesen zu sein.
Solange aber Dayan, Peres und ein Dutzend anderer Gegner einer Rückgabe der „Westbank“ (Westufer des Jordanflusses) der Füh-
rung der Arbeiterpartei angehören, ist der Unterschied zwischen ihr und der Opposition verwischt. Einerseits gehörten der Regierungspartei „Tauben“ (wie Exminister Elia und der Generalsekretär der Gewerkschaft, Ben-Aharon) an, die die restlose Räumung der eroberten Gebiete befürworten, ja sogar, ohne auf einen Friedensschluß mit Jordanien zu warten — aber anderseits gibt es die erwähnten „Falken“; und Golda Meir, die Spitzenkandidatin, hat wiederholt erklärt, daß sie selbst nie einer totalen Räumung zustimmen würde und daß der Jordanfluß die „militärische“ (wenn auch nicht gerade die politische) Grenze Israels bleiben müsse.
Aber Golda Meir hat ihren 75. Geburtstag hinter sich und wollte sich schon zurückziehen; ihr Nachfolger würde entweder Sapir sein oder ein Mann, der dessen Politik ausführen würde. Wenige Israelis glauben, daß Golda Meir länger als ein Jahr nach den Wahlen Ministerpräsident bleiben wird — und wenige haben zu ihrem vermuteten Nachfolger sehr großes Vertrauen.
So führt denn die Opposition den Wahlkampf nicht so sehr gegen die
allseits beliebte Frau, sondern gegen deren Nachfolger in spe. Und ihre Parole heißt: wollt ihr eine neue Teilung Israels? Wollt ihr, daß Tel-Aviv und Jerusalem wiederum in Reichweite feindlicher Kanonen oder Katjuschkas liegen? Oder wollt ihr das Land eurer Väter wirklich besitzen, wirklich besiedeln?
Nächst der Zukunft der „besetzten Gebiete“ ist die der „orientalischen Juden“ — der sogenannten sephardischen Juden, zum Unterschied von den europäischen „Asch-kenasim“ —, die im Ausland am öftesten diskutierte. Sie wird von der arabischen und (seltener) kommunistischen Propaganda benützt, um darzutun, daß die Machthaber Israels „Rassisten“ sind und nicht nur die palästinensischen Araber, sondern sogar ihre jüdischen Glaubensgenossen unterdrücken, falls diese nicht europäischer Herkunft und blendend weißer Hautfarbe seien.
Zweck dieser Anklagen ist ein doppelter: vor allem die kommunistische (und arabische) Behauptung zu erhärten, wonach die Juden überhaupt keine Nation (sondern höchstens eine Religionsgemeinschaft) seien und daher keinen Anspruch auf einen eigenen Staat besitzen; in zweiter Linie — die seit eh und je verkündete Hoffnung auf einen bevorstehenden Zusammenbruch des „zionistischen Kartenhauses“ zu stärken. Wenn ein solcher Gegensatz zwischen der einen und der anderen Hälfte der Israelis besteht, könne dieser Staat unmöglich überleben.
In den Jahren 1940 bis 1948, als die Juden Palästinas den Kampf gegen England und die Araber führten, waren fast drei Viertel von ihnen europäischer Herkunft; meistens Russen, Polen, Deutsche und Altösterreicher. Aus ihren Kreisen ging die Führerschaft des späteren Staates hervor.
Die Sefardim — und unter diesen vor allem die große Mehrheit, die nicht aus europäischen Ländern stammte, sondern aus Afroasien, blieben dieser Führerschicht fern und fremd. Genauso fremd blieben aber beispielsweise die viel weniger zahlreichen Einwanderer aus Westeuropa, Amerika und Südafrika. Das hatte nichts mit „Rassevorurteilen“ zu tun, sondern mit dem (sehr bedauernswerten, aber sehr natürlichen) Instinkt jeder Bürokratie, möglichst gleichdenkende Mitarbeiter heranzuziehen. Hatte dieser Einwanderer einen zu hohen oder jener einen zu niedrigen Standard, waren beide unwillkommen.
Solange die Sefardim eine kleine Minderheit bildeten, spielte das keine Rolle. Das änderte sich aber bald nach der Gründung des Staates. In (fast) allen mohammedanischen Ländern, die damals schon unabhängig waren, sowie in jenen, die bald danach ihre Freiheit erlangten, brach eine unvorhergesehene Hetze gegen alle „Fremden“ los — und zu solchen wurden nebst den Europäern auch die einheimischen Juden gerechnet. Die Tatsache, daß die halbe Million Juden Libyens, Tunesiens, Algeriens und Marokkos zum Teil ein Jahrtausend, aber mindestens
um mehr als ein halbes Jahrtausend vor der arabischen Eroberung in Nordafrika, Südarabien oder dem Irak gelebt hatten, nützte nichts. Sie waren keine Mohammedaner und daher „Fremde“; die „zionistische Aggression“ gegen Palästina — an der die armen Bergjuden der Ber-berei oder des Jemen und Hadramauts höchst unbeteiligt waren — war nur der Vorwand für die wohlbekannten „spontanen“ Demonstrationen der „kochenden Volksseele“.
Es kam in Bagdad und Basra, in Aden und Tripolis, in Tunis und Marokko zu blutigen Progromen, zu wirtschaftlichen Ausnahmegesetzen — und als Folge davon zur Massenflucht der Juden dieser Länder nach Israel, wobei die diversen Regierungen das gesamte Vermögen der Auswanderer (nach Nazimuster) konfiszierten.
Zwischen 1948 und 1953 kam rund eine halbe Million solcher Flüchtlinge nach Palästina; bis heute hat sich ihre Zahl, wenn man ihre Kinder mitrechnet, auf weit mehr als eine Million vermehrt. Vor ein oder zwei Jahren schätzte man in Israel, daß etwa die Hälfte der (jüdischen) Bevölkerung aus Afroasien stamme oder von Vätern abstamme, die aus Afroasien eingewandert waren.
Ebenso unbestritten ist, daß sie keine entsprechende Vertretung in
Staat, Städten und Gewerkschaften besitzen. Allerdings: im Rabbinat sind sie gleichberechtigt. Dem asch-kenasischen Großrabbiner steht ein sefardischer zur Seite, der ihm im Range vielleicht noch etwas überlegen sein sollte, führt er doch den Titel: „Der Erste in Zion.“ Ebenso gibt es doppelte Oberrabbiner in den Gemeinden; und gleichberechtigt sind die Sefardim auch im Handel; die zweitgrößte Bank Israels — die Diskontbank — gehört ausschließlich Sefardim.
Aber dort, wo politische Entscheidungen getroffen werden — und auch im hohen Offlzierkorps —, sind die Orientalen ebenso schwach vertreten wie im Lehrkörper der Universitäten, in der Technik, sogar im Sport.
Das hängt nicht mit dem schlechten Willen der „Europäer“ zusammen. Ben Gurion, der Schöpfer der Armee, hat oft gesagt, er werde erst dann sein Werk für gelungen erachten, wenn es einen jemenitischen General geben werde. Es gibt aber noch immer keinen, und auch keinen, der aus Marokko oder dem Irak stammen würde, aus Persien oder Afghanistan. Es gibt auch keinen Kampfflieger aus diesen Ländern — ob wo h': es treffliche Testpiloten unter ihnen gibt.
Will man — absichtlich übertreibend und sicher zu Unrecht verallgemeinernd — diese Erscheinung erklären, so müßte man sagen: 1500 Jahre Zusammenleben mit dem Islam haben diese Juden in vielen Be-
ziehungen an ihrer Entwicklung ebenso gehindert wie ihre mohammedanischen Nachbarn behindert wurden.
Dieses Problem wurde im Laufe der Jahre teils entschärft und teils verschärft. Entschärft infolge der zunehmenden „Mischehen“ zwischen europäischen und orientalischen Juden (im letzten Jahr war fast jede fünfte Ehe eine solche); verschärft aber durch eine nach vielen Tausenden zählende Schar von vorwiegend marokkanischen Jugendlichen zweiter Generation, die nicht nur nicht am sozialen Aufstieg teilgenommen haben, sondern außerhalb der Gesellschaft geblieben sind. Optimisten sprechen von 10.000 solcher Burschen und Mädchen, die aus der Volksschule entlaufen, zur regelmäßigen Arbeit zu faul und zu anspruchsvoll sind; sie sind zum großen Teil asozial; die Prostituierten des Landes und deren Zuhälter stammen größtenteils aus ihren Reihen, ebenso die jugendlichen Einbrecher und Taschenräuber, die seit 1967 in Tel-Avivs Vorstädten ihr Unwesen treiben. Die Armee, sonst das israelische Erzdehungsinstitut ersten Ranges (36 Monate aktive Dienstzeit für Männer, 20 Monate für Mädchen), nimmt die „drop-outs“ entweder gar nicht auf oder schickt sie nach den ersten paar Strafen Wieder heim. Sie büden das eigentliche soziale Problem des Landes.
Vor etlichen Jahrein organisierten sich etliche Hundert dieser Jugend-
lichen zu einer Organisation, die sich nach amerikanischem Vorbild „Schwarzer Panther“ nannte und lärmende Demonstrationen veranstaltete. Kommunisten und „Neue Linke“ waren daran beteiligt, in der Hoffnung, dadurch Einfluß auf die orientalischen Massen gewinnen zu können. Die Demonstrationen erschütterten die israelische Öffentlichkeit; bis dahin hatte man die „drop-outs“ aus der Volksschule, die zunehmende Kriminalität und Prostitution Jugendlicher nicht zur Kenntnis nehmen wollen; es widersprach zu sehr dem Bild, das jeder Israeli sich von sich und seinem Staat machen wollte.
Wohl besteht die Gruppe der „Schwarzen Panther“ nach wie vor. Sie beabsichtigt, sich am Wahlkampf sogar als Partei zu beteiligen, und ein Abgeordneter des derzeitigen Parlaments will sogar an Ihrer Spitze kandidieren. Daß sie etliche tausend Stimmen bekommt, ist wahrscheinlich; ob sie das für ein Mandat notwendige Minimum von einem Prozent der Gesamtstimmen aufbringt — vermutlich 16.000 —, ist mehr als fraglich. Ansonsten aber werden die Beziehungen zwischen orientalischen und europäischen Juden höchstens bei den Gemeindewahlen kleinerer Orte, sicher aber nicht bei denen zum Parlament eine Rolle spielen. Dort stimmt man über Weltanschauungen ab, aber nicht über die Herkunftsländer der Kandidaten.