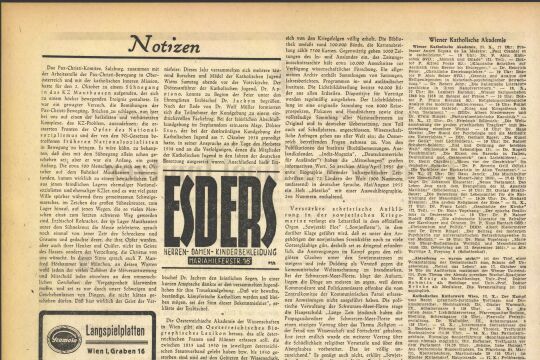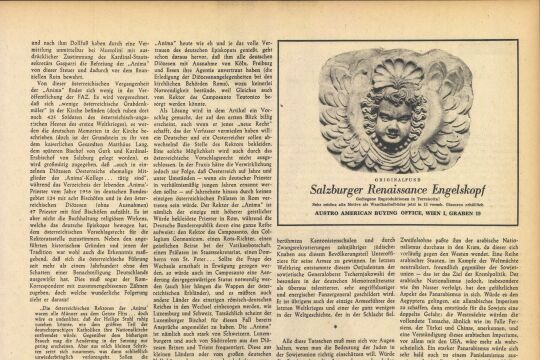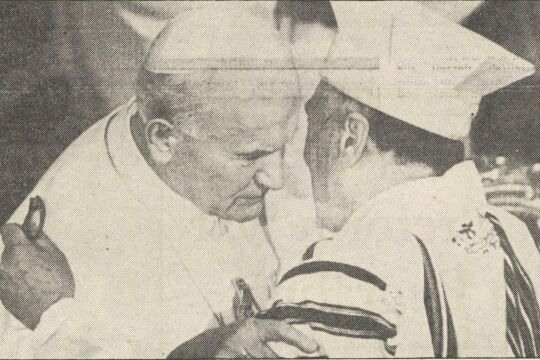Verdrängtes Leid
Überschattet vom Fall Re-der/Frischenschlager tagte vom 26. bis 28. Jänner erstmals der Gouverneursrat des Jüdischen Weltkongresses in Wien. Der sich zu einer schweren innenpolitischen Krise entwickelnde „Heldenempfang” des NS-Kriegsver-brechers ließ hiesige Medien die eigentlichen Anliegen des Kongresses übersehen.
Überschattet vom Fall Re-der/Frischenschlager tagte vom 26. bis 28. Jänner erstmals der Gouverneursrat des Jüdischen Weltkongresses in Wien. Der sich zu einer schweren innenpolitischen Krise entwickelnde „Heldenempfang” des NS-Kriegsver-brechers ließ hiesige Medien die eigentlichen Anliegen des Kongresses übersehen.
Von den österreichischen Medien nahezu unbemerkt, war der Jüdische Weltkongreß den großen Zeitungen der Welt mehrspaltige Berichte auf den Titelseiten wert. Auch das zeitliche Zusammentreffen von Reders traurigem Empfang durch Minister Friedhelm Frischenschlager — selbst wenn die Presse wie geplant davon erst nach Abschluß der Aktion, als während des Kongresses erfahren hätte — hat hierzulande nicht sonderlich gestört.
Vielleicht lagen die Akten auf verschiedenen Schreibtischen des Außenministeriums. Als dann die peinliche Konfrontation der Kongreßteilnehmer mit dem österreichischen Tagesgeschehen nicht mehr zu vermeiden war, hatte die Tagespresse ein besseres Thema: Frischenschlager. Schnell wurde er zum innenpolitischen Tagesgespräch. Koalitionsspekulationen verdrängten unverdauliche Realität.
„Es tut mir unheimlich leid”, verlas der englischsprachige Präsident Edgar Bronfmann in deutscher Sprache die „Entschuldigung” des Bundeskanzlers und betrachtete die Angelegenheit damit als für den Kongreß erledigt.
Der Jüdische Weltkongreß wurde 1936 in Genf gegründet, um die ungläubige Welt auf die Gefahr für die Juden im Nationalsozialismus aufmerksam zu machen. Bis heute hat er sich zur Aufgabe gemacht, die Rechte der Juden auf der ganzen Welt zu verteidigen, die Verbindung aller jüdischen Gemeinden mit Israel zu unterstützen und sich darüber hinaus auch mit allen NichtJuden zu solidarisieren, denen Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit am Herzen liegen.
Wien als Tagungsort hatte der Kongreß gewählt, weil er sich so unmittelbar als möglich an den Osten wenden wollte. Unter den 200 Delegierten waren Vertreter aus Rumänien, Ungarn, der DDR, Polen, der CSSR und Jugoslawien, nicht aber der Sowjetunion. Dort nämlich gibt es keine jüdischen Vereine und aus diesem Grund auch keine Mitglieder des Jüdischen Weltkongresses.
Zudem wollte man die Wahl des Tagungsortes als Dankbarkeitsgeste für die Aufnahme der Juden aus der Sowjetunion verstanden wissen. Schließlich wurde die Entscheidung ausdrücklich als „Bestreben des jüdischen Volkes wie auch der österreichischen Bundesregierung” bezeichnet, „ein neues Verhältnis zu schmieden, in dem die Realität der Zukunft die traumatischen Ereignisse der Vergangenheit ersetzen wird”.
Für so manche Teilnehmer bedeutete das freilich eine nicht geringe Anstrengung. Rabbi Arthur Schneier, Vorsitzender der Dritten-Welt-Kommission, begann seine Rede mit der Schilderung seiner frühesten Kindheitserinnerungen: Klirrendes Glas, Vater rutscht auf den Knien am Stephansplatz herum und bürstet den Gehsteig. Und das war nur der Anfang eines unvorstellbaren
Leidensweges, den viele der Anwesenden als einzige ihrer Familie überlebt haben.
„Wir Juden haben alte Erfahrungen mit dem Rassismus, wir waren seine ersten Opfer und sind das in vielen Teilen der Welt noch immer. Deshalb ist es eine Uberlebensfrage, uns mit dem Kampf aller Opfer des Rassismus zu identifizieren”. Mit diesen Worten führt Rabbi Schneier Mr. James Jonah ein.
James Jonah ist ein hochrangiger UNO-Beamter schwarzer Hautfarbe, er kommt aus der Sierra Leone. Erstmalig demonstriert der Jüdische Weltkongreß damit seine immer erfolgreicheren Bemühungen, die Entwicklungsländer davon abzubringen, in der UNO automatisch gegen Israel zu stimmen. Auch wenn diese Entwicklung sicherlich von dem Erschrecken unterstützt ist, das die finanziellen Folgen des Austritts der USA aus der UNESCO ausgelöst haben, so gewinnt man doch auf der Konferenz den Eindruck, daß geduldige menschliche Kontakte eine bedeutende Rolle spielen. Mr. Jonah schildert ausführlich, wie sich sein Verständnis der Juden langsam entwickelt hat und bleibt dann ein aufmerksamer Zuhörer aller Diskussionsbeiträge.
Auch in diesem Zusammenhang ist die Ost-West Debatte, Herzstück des Wiener Kongresses, von großer Wichtigkeit, war doch die Sowjetunion stark an der Annahme der UNO-Resolution beteiligt, die Zionismus mit Rassismus gleichsetzte.
Politisch sind die Mitglieder des Gouverneursrates durchaus verschiedener Meinung. Rabbi Alexander Schindler, Vorsitzender der Ost-West-Gespräche, formuliert einleitend, was ihnen aber allen gemeinsam ist: „Unser Protest gegen sowjetischen Antisemitismus beruht auf festen moralischen Grundsätzen. Wir weisen die verächtliche Karikatur der Sowjetunion als Schreckensreich ohne Menschlichkeit ebenso zurück wie die umfassende Entschuldigung einer .sozialistischen Moral', die Fehler in sozialistischen Gesellschaften grundsätzlich entschuldigt”.
Chefrabbiner Rosen aus Rumänien, dessen Gemeinden von 400.000 Mitgliedern nach dem Krieg auf derzeit 26.000 geschmolzen sind, wehrt sich gegen den Vorwurf, ein Ostagent zu sein. Er berichtet über akute antisemitische Aktionen in Rumänien heute, betont aber, sich auch in Zeiten der härtesten Verfolgung immer als Zionist deklariert zu haben.
Mit der Bereitschaft, sich loyal auch zum kommunistischen Staat zu verhalten, gleichzeitig aber ein religiöses jüdisches Leben führen zu wollen, sei ihm gelungen, fast alle ausreisewilligen Juden nach Israel zu bringen. Rosen hält Religion für die einzige Bresche, die man in die kommunistische Welt schlagen könne und warnt davor, sich in den Ost-West-Konflikt einzumischen.
Auf seinen engagierten Ausruf, „die Jiddischkeit ist in Gefahr, nicht das Leben der Juden in der Sowjetunion”, kontert der Vertreter der zionistischen Weltorganisation. Er sieht keine Chance für Juden in einem kommunistischen Regime, das jede Loyalität außerhalb des Landes inakzeptabel finden müsse. Auch sein Hoffnung aber ist die Ausreiseerlaubnis für Juden aus der UdSSR.
Im Laufe des vergangenen Jahres sind nicht mehr als 700 bis 800 herausgekommen, 1979 waren es 51.000 gewesen. Seit 1919 wurde in der Sowjetunion keine hebräische Bibel mehr gedruckt, obzwar 400.000 jüdische Sowjetbürger sogar jiddisch als ihre Muttersprache angegeben haben. Viele von ihnen haben auch während der ärgsten Pogrome ihre Heimat nie verlassen und wollen das auch heute nicht tun.
200.000 Ansuchen sind aber in Moskau registriert und so mancher fürchtet, sich anzumelden. Der Ruf, „Let my people go”, eint die Vertreter aller politischen Richtungen. Ihre Hoffnungen knüpfen sich an den Besuch des Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses in der Sowjetunion, der für nächste Zeit geplant ist. Termin wird noch einer genannt, Vorbesprechungen für ein Datum im März aber sollen bereits im Gange sein.
Israels Premierminister Shi-mon Peres, der während des Kongresses am Video-Schirm aus Israel eine einstündige Live-Dis-kussion mit den Delegierten absolviert, ist zu einem bisher geheim gehaltenen Staatsbesuch in Rumänien angesagt. In allernächster Zeit, so meint ein Optimist, könnten die Weichen für die nächsten 50 Jahre gestellt werden.
Um Hilfe, vor allem auf diesem Gebiet, wird auch der vom Kongreß mit besonderer Herzlichkeit empfangene Kardinal Franz König gebeten. Auf Anfrage sieht Kardinal König zudem Zeichen der Hoffnung in bezug auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen des Vatikans zu Israel.
Seine Rede wird freundlich aufgenommen. Er beschreibt die einzelnen Details der christlich-jüdischen Zusammenarbeit in Österreich, das judaistische Institut der Universität, im besonderen die Verdienste von Professor Kurt Schubert. Mit nur einem Satz erwähnt seine Eminenz, was vor 40 Jahren in dieser Stadt passiert ist. Zur religiösen Verbundenheit, die uns Christen mit dem jüdischen Glauben eint, zitiert er kurze Passagen aus dem Text der Synode.
Ich gewinne den Eindruck, wir Christen hätten die Schrecken des Holokaust noch sehr viel weniger verdaut als die Opfer. Ich habe auf diesem Kongreß viele getroffen, deren Gesicht, gezeichnet von den Grauen ihrer Kindheit, eine Güte ausdrückte, die bei Christen eine Seltenheit geworden ist.
Sinowatz erinnert sich
Elie Wiesel hatte sich den Festgästen bei der Eröffnungsveranstaltung im Redoutensaal mit einer Geschichte vorgestellt: „Jänner 1945. Irgendwo in einem dunklen Königreich hatte ein kleiner jüdischer Bub gerade den Abgrund der Verzweiflung erreicht: Sein Vater lag im Sterben und der Sohn konnte nichts dagegen tun. Er konnte nicht einmal verstehen, was der Vater in seiner Agonie versuchte, ihm mitzuteilen: Ein Gebet? Ein Testament? Eine Prophezeiung vielleicht?”
„Im Morgengrauen starb der Vater und der Sohn erkannte, daß von diesem Tag an alle Worte in eine ewige Totenklage münden würden. In Klage für eine Zivilisation, die ihre Götter verraten und Todeslager statt Gotteshäuser errichtet hatte ... Und jetzt, vierzig Jahre danach, steht der Bub vor Ihnen, um mit Ihnen die tiefe Uberzeugung zu teilen, daß immer noch stimmt, was unser Volk anderen in vielen Jahrhunderten gelehrt hat: Wir können in extremen Situationen von Verzweiflung erfaßt werden, niemals aber in Verzweiflung ersticken. Der Glaube unseres Volkes an die Auferstehung... kann versucht, nicht aber gebrochen werden.”
Elie Wiesel hat über seine Erfahrungen ein erschütterndes Buch geschrieben. Bundeskanzler Sinowatz hat auch seine persönliche Beziehung zu diesem Thema geschildert. Er erzählt, am Ende seiner Begrüßungsrede im Redoutensaal, daß er in einem bur-genländischen Industriedorf aufgewachsen sei, in dem auch Juden ansäßig waren.
Einem von ihnen gehörte das Geschäft im Ort, an dessen Fensterscheiben sich die Kinder bewundernd die Nasen platt drückten. Er freilich sei privilegiert gewesen. Weil seine Mutter bei den Mayers aufräumen durfte, konnte sie der kleine Fred jeden Freitag abholen, bekam ein kleines Geschenk und durfte all die Schätze im Lager aus der Nähe bewundern. Eines Tages stand dann einmal seine Mutter weinend am Fenster. Die Mayers von gegenüber hatten ihre Koffer gepackt und verließen ihr Haus für immer in Richtung Bahnhof.
Im November 1938 war das Burgenland praktisch „judenrein”. Die meisten Kaufleute waren freilich ohne Koffer und nicht per Bahn abgereist. Das Ganze war — ist — so unheimlich, daß auch nicht-jüdische Staatsbürger das erste Mal in der Geschichte der Zweiten Republik Schwierigkeiten mit ihrer österreichischen Identität haben.