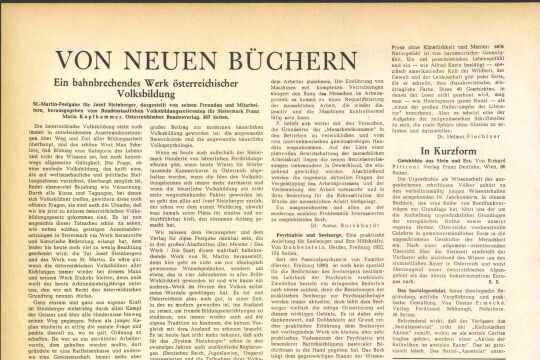In der Aprilnummer, der in München und in der Schweiz erscheinenden Zeitschrift „H o c h I a n d“ veröffentlicht Otto Heinrich v. d. Gablentz unter dem Titel „Berlin, Bildnis einer S t d t“ einen Beitrag, der nach den Worten der Schriftleitung „weniger eine erschöpfende Analyse als ein teilnehmendes Bekenntnis darstellen will“. Der Verfasser schildert dabei zunächst den Werdegang von der märkischen über die preußische zur deutschen Stadt, eine Entwicklung, die, schon vor dem ersten Weltkrieg deutlich erkennbar, in der Weimarer Republik durch das starke Anwachsen des katholischen und süddeutschen Elements verstärkt, schließlich durch den letzten Krieg vollendet wurde, da „nun in Berlin wirklich Vertreter aller Stämme hängengeblieben sind, deren inneres und äußeres Schicksal an die Stadt gebunden ist“. Daher sei es, wie es der Verfasser sieht, heute Berlin allein, „wo noch das Gesamtschicksal Deutschlands deutlich wird", woraus für die Stadt zunächst eine wichtige deutsche Aufgabe erwachse.
„Internationales Leben, an dem man sich für diese Aufgabe üben könnte, ist in Berlin genug: vier Besatzungsmächte und ihre uneinigen Einheitsorgane: Kontrollrat und Kom- mandatura, dazu die Delegationen der kleineren Alliierten Die Deutschen spielen dabei allerdings im wesentlichen nur eine passive Rolle als Befehlsempfänger oder Sachverständige. Aber man darf den Gewinn nicht unterschätzen, den schon diese Begegnungen bringen. Die ganze Bevölkerung kann vergleichen, und das bewahrt vor einseitiger Abhängigkeit und zugleich vor einseitiger Abneigung. Es verleiht Abstand, schafft Selbstbewußtsein und Selbstkritik zugleich. Und es gibt doch nicht ganz wenige Deutsche in Berlin, die dazu gekommen sind, sowohl mit Amerikanern und Engländern als auch mit Franzosen und mit Russen ernsthafte Gespräche zu führen. Sie können sich aus dem, was sie sehen und hören, und aus dem, was ihnen verschwiegen wird, ein zutreffenderes Bild der weltbestimmenden Kräfte machen, als es ei em Deutschen an irgendeinem anderen Ort möglich ist, ja ein besseres vielleicht, als die Angehörigen freier Völker selbst in ihren Heimatländern gewinnen können. Aber sie erleben Gegensätze und ihre Entladungen über unsere Köpfe hinweg... So sind einige geistige und politische Voraussetzungen gegeben für eine Berliner Aufgabe, die alle märkische, preußische und deutsche Überlieferung aufnimmt und in einen weltweiten Zusammenhang stellt. Audi die wirtschaftliche Aufgabe ergibt sich daraus von selbst in doppelter Richtung, nach innen und nadi außen. Nach innen ist es die Aufgabe eines aus christlicher Wurzel wachsenden Sozialismus. Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse Ostdeutschlands sind so, daß eine Rückkehr zur freien Wirtschaft, die im Westen manchem noch möglich scheint, undenkbar geworden ist. Wir sind aber auch der einzige deutsche Bezirk, der den Marxismus als anregende Kraft und als Gefahr wirklich kennengelernt hat und nicht überrannt wurde. Wir wissen, welche sozialistischen Elemente der Planung, des Gemeineigentums und des Mitbestimmungsrechtes unabdingbar sind, wenn die neue Wirtschaftsordnung den Massen Sicherheit, Freiheit und Gerechtigkeit verbürgen soll, und wo sie begrenzt werden müssen dutch d e auß rwirt- schaftlidien Kräfte des Rechtsstaates und der Geistesfreibeit, um dem totalen Staat zu entgehen. Wir können hier den Weg finden, der nicht an Marx vorbei, aber über Marx hinaus führt. Voraussetzung für dieses Wirken in Geist, Politik und Wirtschaft ist freilich eiine Verständigung zwischen Ost und West. Voraussetzung solcher Veiständigung ist wieder eine Vorstellung von einem Deutschland, das zu beiden gehört und nicht mehr von einer Seite gegen die andere ausgespielt werden kann. Und das muß ein eigenständiges Deutschland sein, das nach beiden Seiten hin offen ist, hörend und sprechend, aufnehmend und gebend. Dafür die Voraussetzungen zu schaffen, das ist heute die Aufgabe Berlins.“
Im Gegensatz zu diesen Hoffnungen auf ein zwischen Ost und West vermittelndes Deutschland stellt die englische Wochenschrift „The Spectator“ vom 16. April in einem dem „Eckpfeiler des Friedens“, der anglo-amcrikanischen Freundschaft, gewidmeten Aufsatz fest:
„Es bleibt nunmehr eine unerläßliche Pflicht, Westdeutschland mit den Aufbti'bemühungen seiner demokratischen Nachbarn zu verbinden. Jede Anstrengung ist gemacht und vielleicht sogar zu lange verfolgt worden, die deutsche Einheit zu bewahren. Rußland hat das unmöglich gemacht und die Konsequenzen seiner Haltung müssen gezogen werden.“
„W ozu das alle s?“. fragt Sir George Schuster in einer Betrachtung über die Voraussetzungen der menschlichen Zufriedenheit („T he Listener“ vom 15. April). Entsprechend einer schon von
Aristoteles formulierten Einsicht, beruhe das menschliche Glück auf der regen Betätigung der besten Fähigkeiten eines Menschen, auf „intensiver Tätigkeit bei etwas, was man gut mach t“. Dafür aber müßten zwei weitere Voraussetzungen gegeben sein, nämlich einmal „persönliche Freiheit als Grundbedingung persönlicher Verantwortlichkeit“, vor allem aber die Ausübung dieser Tätigkeit im Geist menschlicher Kameradschaft und Liebe. Die Hauptschwierigkeit liege hier darin, daß die
Industriearbeit — und die moderne Gesellschaft sei eben nun einmal eine vorwiegend industrielle Gesellschaft — mit üblen Erinnerungen belastet sei.
„Es ist heute unser Fluch, daß. entsprechend der Art, in der diie industrielle Revolution in dieses Land kam und Arbeit mit FabrLksarbeit unter sdilediten Bedingungen, übermäßiger Arbeitszeit und der Furcht vor Ausbeutung identifiziert wurde, Arbeit selbst schließlich als ein Übel betrachtet wurde, als etwas, was man möglichst einschränken muß, und nidit, wie es sein sollte, ab die wahre Grundlage des menschlichen Glücks. Der bedauerlichste Zug im modernen industriellen Leben ist der Verlust der Schöpferfreude für so viele. Nichts ist wichtiger als deren Wiedergewinnung.“
Dazu aber bedürfe es zunächst der Freiheit in der Arbeit, die nicht minder wichtig sei als die politische Freiheit. Diese Arbeitsfreiheit bestehe nicht nur in der freien Berufswahl, sondern auch darin, daß dem Arbeiter die Möglichkeit gegeben werde,
„sich selbst in seiner Arbeit auszudrüdten, einen Anteil an der Feststellung zu haben, wie sie gemacht werden soll, nicht wie an automatischer Maschinenteil behandelt zu werden, der nicht zum Denken bezahlt wird.“
Noch wichtiger, aber sei dabei der Geist menschlicher Nächstenliebe und Kameradschaft.
„Ich will keine Predigt halten. Aber ich kann nicht meine eigene tiefe Überzeugung verbergen, die jeden Tag starker wird, daß der Schlüssel zu allen unseren Problemen in einer christlichen Ethik gefunden werden kann, getragen von religiösem Glauben... Ich denke nicht an irgendeine Art verwaschener Sentimentalität und verkenne nicht die Realitäten der Buchführung. Das geht nicht. Wir alle müssen wirklich unser tägliches Brot verdienen. Aber ich sage, daß in einem Land von frei erzogenen Menschen und nicht von Sklaven man selbst zur Erzielung der besten materiellen Resultate in der Industrie die richtigen menschlichen Beziehungen braucht und daß man diese nicht haben kann ohne Glauben an seine Mitmenschen, ohne Liebe und Kameradschaft, ohne daß man den ändern als gleichberechtigt betrachtet.“
Die englische katholische Wochenschrift „The Tablet“ vom 24. April bringt unter dem Titel „Au f dem Wege zum europäischen Föderalismus“ einen Bericht von A. Hepburn Smith über die Konferenz des „M ouvement International des Intellectuels Catholique s“, die anfangs April in Regensburg abgehalten wurde and bei der die Vertreter von zehn Staaten in einer Resolution auf die „ständig wachsende Notwendigkeit" hinwiesen, „föderalistische Einrichtungen in Europa zu schaffen, die mit ausreichenden Befugnissen ausgestattet sind, um das Leben der europäischen Kultur in neuen Formen wiederaufbauen zu kön- nen .
,,Die Resolution fügte hinzu, daß diese Erneuerung des europäischen Lebens nicht nur eine geistige Aufgabe sei, sondern auch die Umwandlung der politischen, sozialen und ökonomischen Struktur, die Verbesserung der Lebensbedingungen und eine gerechtere Verteilung des Reichtums verlange. Diese Aufgabe könne nicht gelöst werden, ohne daß die Staaten föderativen Organen verschiedene ihrer Rechte übergeben. Dementsprechend sollten Organe für jedes der Probleme erriditet werden, die noch nicht internationaler Regulierung unterworfen sind, Ogane, denen Vertretungskörper mit gesetzgeberischer Gewalt beigegeben werden sollten.“
Unter den Rednern dieser Tagung befanden sich der bayrische Ministerpräsident Dr. E h a r d, der die wechselseitige Ergänzung von deutschem und europäischem Föderalismus hervorhob, sowie der Schweizer Universitätsprofessor P i 11 e r, welcher in einem umfassenden Vortrag die Übereinstimmung des föderalistischen Prinzips im weitesten Sinn mit der katholischen Lehre der Subsidiarität darlegte. „Selbst innerhalb des Staates sei im Grunde nur der ökonomische und politische Föderalismus in der Lage, eine vernünftige Lösung zwischen den Extremen von Liberalismus und Kollektivismus ZU bieten.“
In der Märznummer der neuen italienischen Zeitschrift „Le pettatore 11 a- 1 i a n o“ bringt Salvatore Rosati Gedanken zum Verhältnis zwischen der Wissenschaft der Psychoanalyse und der romantischen Dichtung. Der Grund für den starken Einfluß der Psychoanalyse auf die moderne Literatur unseres Jahrhunderts liege „im romantischen Element, das den Mittelpunkt der Freudschen Lehre bildet: im Unbewußten".
Dieses Unbewußte sei seit dem Beginn der romantischen Neubewertung des Gefühls unter dem Namen der Inspiration und Intuition auf den Thron erhoben worden. Freud selbst habe ja einmal den Titel eines „Entdeckers des Unbewußten“ zurückgewiesen und betont, daß die Dichter und Philosophen vor ihm das Unbewußte entdeckt hätten, während er für sich selbst nur das Verdienst der Entdeckung wissenschaftlicher Methoden zur Erforschung des Unbewußten in Anspruch genommen habe. Hier aber liegt, nach der Ansicht des italienischen Kritiken gerade der Widerspruch der Psychoanalyse, ein Widerspruch, der iedcJtii schon seit jeher auch der der romantischen Kunst gewesen sei.
„Der Widerspruch dec romantischen Kunst liegt gerade hier: zwischen der Funktion einer Erforschung, einer Kenntnis, die sie — mit Hilfe der von Kant abgeleiteten Erkenntnistheorie — beansprucht, und in ihrer Ablehnung des Denkens, das doch das einzige und un- ersetzlidie Instrument der wissenschaftlichen Forschung ist."
Daher habe die Psychoanalyse auch mehr zerstörend als aufbauend gewirkt und in ihrem Einfluß auf die Literatur zur Auflösung der menschlichen Persönlichkeit, ja selbst zu jener der Sprach.: beigetragen.