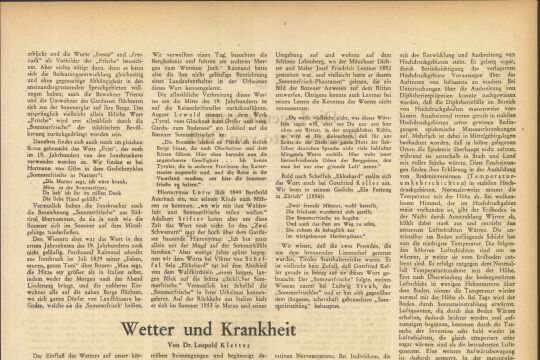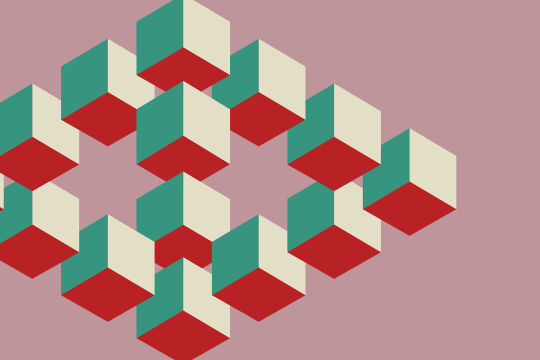Die Medizin hat die Sterblichkeit von Frühchen in den vergangenen Jahren senken können. Um die Lebensqualität zu steigern, müsste das Gehirn intensiver beforscht werden.
Wie kleine, bunte Campingzelte sehen die Bettchen auf einer der drei Neonatologie-Stationen des AKH in Wien aus. Denn längs über jedem Minibett ist eine Schnur gespannt, die eine farbige Decke trägt: das Zeltdach. Dieses schützt die empfindlichen Augen der Frühgeborenen vor zu viel Licht. Die kleinen Zwerge schlafen friedlich darunter, manche zu den beruhigenden Klängen von leisem Meeresrauschen. Allein die digitalen EKG-Schirme über den Bettchen geben noch einen Hinweis auf den dramatischen Lebensbeginn dieser kleinsten Erdenmenschen. Seit den ersten Stunden begleitet sie die moderne Technik, und unter den wärmenden Kuscheldecken kleben immer noch Elektroden an den winzigen Körperchen.
Künstliche Lungenreifung
Doch die, die hier unter den Zelten schlummern, haben bereits ein gutes Stück auf dem Lebensweg beschritten. Noch unsicherer ist das Überleben jener, die in den zwei anderen Intensivstationen umsorgt werden. Diese gerade erst und viel zu früh Geborenen liegen in Brutkästen mit genau kontrollierter Temperatur, Magensonden, die eine künstliche Nahrungsaufnahme ermöglichen, und einer streng geregelten Sauerstoffzufuhr - wobei die Lungen zum Teil mit Medikamenten künstlich gereift wurden, so dass diese Winzlinge überhaupt atmen können. Oberärztin Katrin Klebermaß erklärt: "Die Hochrisikogruppe ist heute jene mit 500 bis 750 Gramm Gewicht. Von ihnen überleben rund 80 Prozent." Anders gesagt: Jedes fünfte Kind stirbt. Das mag grausam klingen. Tatsächlich aber hat die Medizin die Sterblichkeitsrate in den letzten Jahren kontinuierlich senken können.
Diesem Erfolg zum Trotz hat sich an den Langzeitfolgen, unter denen die Frühchen leiden, wenig geändert: Ein Drittel zeigt schwere Beeinträchtigungen, ein Drittel leichte und ein Drittel ist gesund. "Die motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen treten erst mit ein, zwei Jahren zutage. Solange das Baby noch kleiner ist, merken die Eltern kaum, dass ihr Kind ein wenig anders ist", erklärt Renate Fuiko. Und die Psychologin, die am AKH für die Nachsorge der Frühgeborenen zuständig ist, meint weiters: "Unsere Aufgabe ist es dann, die Eltern so zu begleiten, dass sie die Behinderungen auch annehmen können."
Der medizinische Grund für die Beeinträchtigungen ist klar: Nicht nur Lungen, Magen und Augen sind bei den Frühgeborenen extrem unterentwickelt, sondern vor allem auch das Gehirn. Dieses besser zu verstehen, will Klebermaß im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit erreichen. Eine spezielle Form der EEG-Messung erlaubt dabei einen neuen Einblick in die neuronalen Prozesse. "Wir wissen noch wenig darüber, wie das Gehirn eines Frühgeborenen funktioniert. Es unterscheidet sich aber wesentlich von jenem eines Neugeborenen", resümiert die Oberärztin. Das Ziel ihrer Forschung formuliert sie ganz allgemein so: Je mehr man weiß und je früher man es weiß, desto eher lassen sich therapeutische Maßnahmen entwickeln und maßgeschneidert anbieten. Diese Ansicht vertritt auch Matthias Keller, ehemals an der Medizinischen Universität Innsbruck tätig und jetzt Privatdozent für Neonatologie an der Universität Erlangen. Mit dem Tiroler Biotech-Unternehmen Biocrates durchsucht Keller zurzeit Hunderte von Molekülen im Blut, um einige zu finden, die als Biomarker Hinweise auf mögliche Gehirnschädigungen geben könnten.
Frühe Diagnose wichtig
"Es gibt nur ein kurzes therapeutisches Zeitfenster, wenn man den Zelltod im Gehirn verhindern will. Deshalb ist es so wichtig, diese Entwicklung früh diagnostizieren zu können," erklärt Keller. Das besondere an der Methode, der sogenannten Tandem-Massenspektroskopie, ist, dass sie weltweit nur von einer Handvoll Forschern beherrscht wird und lediglich sehr kleine Blutplasmamengen - 10 Mikroliter - benötigt. Keller betont: "Für Frühgeborene ist das optimal." Denn jeder kleinere Eingriff - ein Nadelstich, aber auch Medikamente, Licht und Lärm - wird als Signal an das unreife Gehirn weitergeleitet und kann die Entwicklung desselben mitbeeinflussen.
Doch während sich erste interessante Ergebnisse allmählich abzeichnen, läuft das dreijährige EU-Forschungsprojekt, an dem viele weitere europäische Institutionen beteiligt sind, im Oktober aus. "Zurzeit haben wir keine zusätzlichen Fördermittel. Lobbying für die Forschung an Neugeborenen gibt es auf europäischer Ebene leider nicht. Ja, das Wort Neonatologie taucht im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm nicht einmal auf", bedauert Keller. Eine längerfristige Forschungsfinanzierung wäre aber gerade für diese Art von Forschung vonnöten: weil manche Schädigungen erst Jahre später sichtbar werden, etwa im Kindergartenalter.
Das sei auch ein Grund, warum die Pharmaindustrie kaum in die Erforschung der Frühchen investiere, erläutert Keller. Und Klebermaß ergänzt: "Die Entwicklung von Medikamenten gegen hohen Blutdruck oder Diabetes ist ungleich attraktiver. Der Markt für Neugeborene ist einfach viel zu klein." Deshalb gibt es auch kaum spezielle Medikamente für Frühgeborene. Und selbst der Zugang zu gebräuchlichen Medikamenten - etwa Schmerzmitteln - ist für die kleinen Patienten ein verzögerter. Zuerst werden Studien an Erwachsenen gemacht, dann vielleicht Daten für ältere Kinder erhoben, ganz zum Schluss sind die Säuglinge und Frühgeborenen dran. Vielfach kommt es so zu Off-Label-Use. Das heißt: Ein an Erwachsenen getestetes Medikament wird an Kindern, an denen es nicht geprüft wurde, ausprobiert. "Die europäische Gesundheitsbehörde EMEA nimmt diese Wissenslücke mittlerweile sehr ernst und will in Zukunft eine Liste an häufig eingesetzten Medikamenten gezielt untersuchen und in Studien die optimale Dosis für kleine Patienten feststellen", weiß Keller.
Bald bessere Therapien?
Wird die medizinische Versorgung für Frühchen also demnächst große Sprünge machen? Obwohl Keller auch an Studien beteiligt ist, in der Substanzen untersucht werden, die das Gehirn schützen sollen, äußert er sich sehr zurückhaltend: "Ich möchte keine falschen Hoffnungen wecken. Ich denke, dass die Ursachenforschung zurzeit sehr limitiert ist und wir mehr Unterstützung, mehr Projekte und mehr Mittel bräuchten."
Klebermaß hingegen fehlen momentan weniger die Gelder, vielmehr ermangelt es ihr an einer anderen wertvollen Ressource: Neben dem klinischen Arbeitsalltag - einer 50 bis 60 Stunden Woche - findet sie kaum mehr Zeit zum Forschen. Dennoch glaubt sie an einen kontinuierlichen, wenn auch vielleicht langsamen Fortschritt: "Wir betreiben Grenzzonenmedizin. Und die Grenzen werden sich nach unten verschieben. Vor rund zehn Jahren wurde die Lebensgrenze bei der 28. Schwangerschaftswoche gezogen, heute gelten Frühchen der 24. Schwangerschaftswoche als lebensfähig."
Noch jüngere Frühchen haben freilich noch unreifere Organe, und die Herausforderung für die Medizin dürfte so noch steigen. Folglich werden auch einige zukünftige Eltern kaum je so ruhig schlafen wie ihre Winzlinge unter den farbenfrohen Campingzelten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!