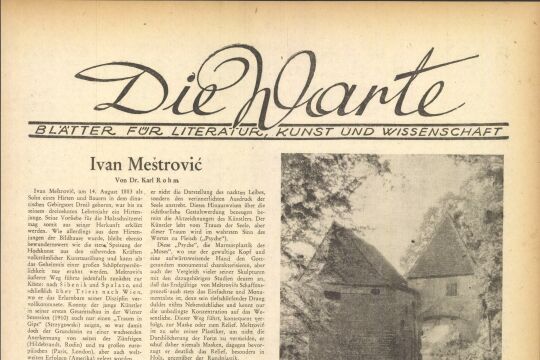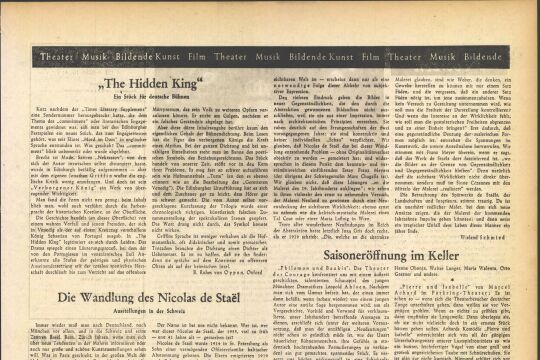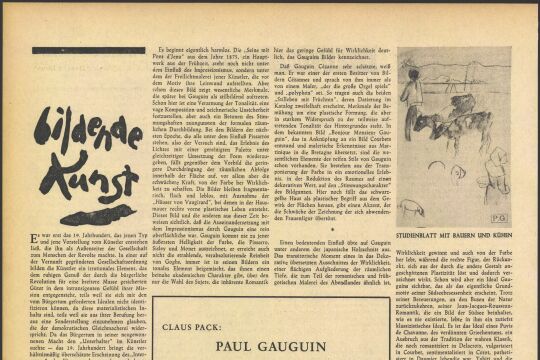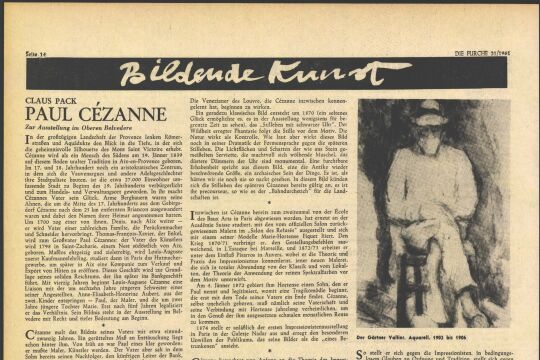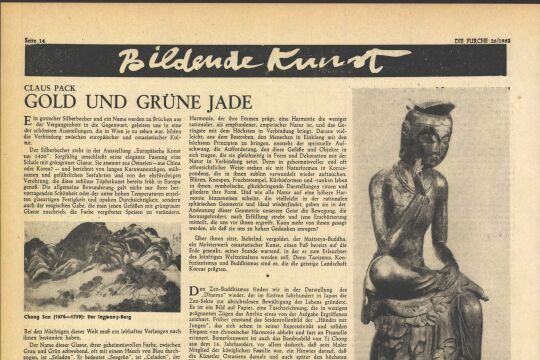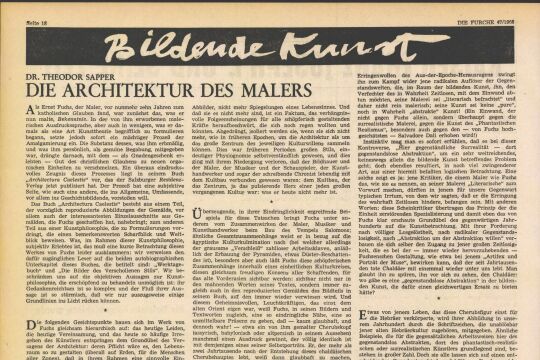„AUCH ICH WAR IN ARKADIEN“
Claude Lorrain und Nicolas Poussin. Zur Ausstellung in der Albertina.
Claude Lorrain und Nicolas Poussin. Zur Ausstellung in der Albertina.
In seinem Testament, das Claude Gellėe 1663 — schwer erkrankt — verfaßt, vermacht er seiner damals elfjährigen Tochter Agnes nebst Stücken seiner beweglichen Habe und dem Bett in dem er schlief samt Betthimmel sowie den Erträgnissen aus elf Grundstücken, auch den größten Schatz der „immer in der Familie bleiben sollte“: einen Band, der damals 157 Zeichnungen nach seinen Gemälden enthielt, das „Libro d’Invenzioni ovvero Libro di Verita“. Als er fast zwanzig Jahre später, 1682, stirbt, umfaßt es 200 Zeichnungen; und viele der Bilder waren, worauf er mit Recht stolz sein konnte, im Auftrage der verschiedensten europäischen Fürsten entstanden, seinen Ruhm und seinen Namen über den ganzen Kontinent verbreitend. — In der Mitte des 18. Jahrhunderts gelangte diese Sammlung von Zeichnungen von Paris nach England, wo sie 1770 der Herzog von Devonshire erwirbt und wo sie 1774—77 durch den Stecher Richard Earlom als Schabstiche in zwei Bänden reproduziert wurden, um neuerlich den Ruhm Claude Gellėes zu vermehren und zu verbreiten.
Diese Blätter muß Goethe vor Augen gehabt haben, als er 1829 zu Eckermann sagte: „Da sehen Sie einmal einen vollkommenen Menschen der schön gedacht und empfunden hat und in dessen Gemüt eine Welt lag, wie man sie nicht leicht irgendwo draußen trifft. Die Bilder haben die höchste Wahrheit, aber keine Spur von Wirklichkeit. Claude Lorrain kannte die reale Welt bis ins kleinste Detail auswendig, und er gebraucht sie als Mittel, um die Welt seiner schönen Seele auszudrücken. Das ist eben die wahre Idealität, die sich realer Mittel zu bedienen weiß, daß das erscheinende Wahre eine Täuschung hervorbringt, als sei es wirklich.“
Mit diesen Worten hat Goethe Wesentliches und Tiefes über die Kunst Claudes und — Poussins ausgesagt. Denn dieser andere Große der Malerei des an Künstlern so überreichen 17. Jahrhunderts hatte es schon fast zweihundert Jahre früher niedergeschrieben, worin für ihn der Begriff der Schönheit bestand:
„Der Inbegriff der Schönheit kann nicht mit dem Stoff verschmolzen werden, wenn dieser nicht soviel wie möglich dazu vorbereitet ist; diese Vorbereitung besteht in dreierlei: in der Ordnung, im Maß und in der Gattung oder Form. Die Ordnung besagt die Intervalle der Teile, das Maß hat Bezug auf die Quantität, die Form besteht in Linie und Farbe. Ordnung und Intervalle der Teile genügen nicht allein, noch daß alle Glieder des Körpers ihre natürliche Lage haben, wenn nicht das Maß hinzukommt, das jedem Gliede die gehörige, zum Körper proportionierte Größe „verleiht,. und wenn nicht außerdem die Form beachtet wird, sp dgß die Linien mit Grazie behandelt und Licht und- Schatten in sanfter Harmonie verteilt sind. Aus allen diesen Dingen sieht man deutlich, daß die Schönheit im großen und ganzen nichts mit dem Stofflichen des Körpers zu tun hat, dem sie sich nur verbindet, wenn er durch unkörperliche Vorbereitungen dazu geeignet worden ist. Und daraus ergibt sich der Schluß, daß die Malerei nichts andres ist als eine Vorstellung unkörperlicher Dinge, und daß sie im Darstellen von Körpern nur Ordnung und Maß an einer besonderen Art von Dingen zur Erscheinung bringt; ferner, daß Kunst mehr auf die Idee der Schönheit bedacht ist, als auf irgend eine andre…“
Soweit der Freund Claudes, der auch als Theoretiker große Poussin, von dem Bernini mit Recht sagte „ehe lavora di lä“ und dabei mit dem Finger auf die Stirn zeigte.
Claude Gellėe war etwas anderer Art, obzwar er — wie seine Landschaften in überirdischer Harmonie zeigen — gleich empfunden haben muß.
Als Kind armer Leute im Jahre 1600 in dem kleinen lothringischen Moseldorf Chamagne geboren — wovon ihm der Name Lorrain verblieb unter dem er in der ganzen Welt bekannt wurde — lernte er nie recht lesen und schreiben. Bei einem Pastetenbäcker in der Lehre, verlor er mit zwölf Jahren beide Eltern, worauf er zu seinem älteren Bruder Johann zog, der in Freiburg im Breisgau angeblich Holzschneider war und der ihn das Zeichnen von Ornamenten und Blattwerk lehrte. Bald wanderte die Waise aber mit einem Verwandten nach Rom, wo er im Dienste des Dekorateurs Cavaliere Giuseppe d’Arpino unter dem Maler Agostino Tassi arbeitete. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges lernt er in Neapel bei einem flandrischen Maler Goffredo Architekturzeichnen und Perspektive um dann wieder in Rom bei Tassi zu arbeiten. 1625 bricht er über den Brenner nach München auf, wo ein Verwandter Koch des bayrischen Kurfürsten war, um schließlich in Nancy unter dem Hofmaler Claude Deruet die Scheinarchitekturen in der damaligen Karmeliterkirche zu malen. Doch die Sehnsucht nach Rom, der römischen Landschaft, ließ ihn nicht ruhen, und der Sturz eines Malers vom Gerüst neben ihm gab den Ausschlag: er zog über Lyon nach Marseille und gelangte nach einer abenteuerlichen, stürmischen Seefahrt krank und mittellos nach Civitavecchia. Am 16. Oktober 1627, dem Tag des Schutzpatrones der Maler, des Heiligen Lucas, betrat er wieder die Ewige Stadt, wo er nun endgültig blieb. Bald macht er sich selbständig und malt wie bei Tassi: „allerley Bäume in Lebensgröße herrlich gebildet, als ob sie rausche- ten und vom Wind bewegt würden“ und „etliche Berge an einem Seeort mit allerley Schiffzeug, auch viel in einem offnen wilden Meer durch die Winde beunruhigten Schiffe“.
Niemand denn die Niederländer, deren es damals viele in Rom gab, zeichneten vor oder in der Natur. Die reiche Seele Claudes aber dürstete darnach, in der Ölmalerei die wechselnden Landschaftsstimmungen, in denen er sein eigenes Ich zutiefst erlebte, einzufangen, und so „suchte er — (wie Sandrart schreibt) — auf alle Weiss der Natur beyzu- kommen, läge vor tags und bisz in die Nacht im Felde, damit er die Tagröhte, der Sonnen Auf- und Nidergang neben den Abendstunden recht natürlich zu bilden erlernte, und wann er eins oder das andere im Feld wol betrachtet, temperierte er alsobald seine Farbe darnach, liefe damit nach haus und wandte sie an sein vorhabendes Werk mit viel größerer Natürlichkeit, als kein anderer vor ihm getan.“ Mit Staunen sah er, wie Sandrart vor der Natur arbeitete, ungleich einem anderen Deutschen — Adam • Elsheimer 1573 bis 1610), der vor ihm in Rom gelebt hatte und tiefe Wirkungen apf Tassi, die Niederländer und jetzt auch auf-ihn' ausübte lind über Lastmann mit seiner stillen Größe auch Rembrandt noch beeinflußen sollte. Jener hatte es immer abgelehnt vor der Natur selbst zu zeichnen, war aber halbe und ganze Tage vor einigen schönen Bäumen gelegen oder gesessen, um sie nachher in allen Einzelheiten, durch seinen Geist verklärt, daheim abzubilden.
Lorrain wohnte seit 1627 in der Via Margutta in der Parallelstraße der Via Paolina (Babuina), wo seit 1625 Nicolas Poussin eingezogen war, dessen Nachbar er ab 1650 werden sollte. Auch Poussin zog es hinaus in die römische Landschaft. Mit Sonnenaufgang durchstreifte er, von Freunden begleitet, im angeregten Gespräch die Umgebung Roms, um ihre wechselnden Schönheiten zu zeichnen oder in sich aufzusaugen. Wie Claude wird auch er zum unermüdlichen Schilderer der römischen Landschaft, des antiken Roms, dessen Reste er in seine Bilder als Elemente einbaut. Doch der 1594 in Villers bei Les Andelys in der Normandie Geborene ist anders als der Lothringer geartet. Mehr als für diesen wird ihm nach dem Einfluß der Carraccis, Renis, Domenichinos und der Venezianer die Antike zum unauslöschlichen Leitbild, eine rationale Formenklarheit, eine geistige Harmonie, die ihn an die Seite Descartes, Corneilles und Pascals stellt. Recht treffend unterscheidet sie Luigi Lanzi wenn er schreibt: „Eine Landschaft von Poussin oder Rosa überschaut man in kurzer Zeit von einem Ende bis zum anderen, wenn man sie mit einer von Claude, auch von viel kleinerem Umfange, vergleicht. Er bietet dem Beschauer hunderterlei Dinge, leitet sein Auge so viele Wasser- und Landwege, zeigt ihm so viel Sehenswürdiges, daß er Atem schöpfen muß, als ob er reiste; endlich läßt er ihn eine solche Ferne von Bergen und Küsten erblicken, daß er sich gleichsam ermüdet fühlt.“ Und nicht der Mensch ist es der in den Bildern Claudes dominiert, sondern das Gesetz der Natur ist es, das in ihnen über ihn herrscht, im höchsten Sinne wird er zur „Staffage“ ohne die aber auch wieder diese Natur nicht denkbar ist weil sie sonst ins Uferlose ausfahren würde. Als Poussin später von den großen figuralen Kompositionen, in denen die Landschaft die Staffage gewesen war, zu Landschaften und einem neuen Verhältnis zwischen Natur und Mensch findet, ist es nur fast oder scheinbar dem Claude ähnlich. Der Klassiker Poussin stellt den Menschen gleichwertig der Natur gegenüber, selbst wenn sie — wie in dem herrlichen „Winter“-Bild des Louvre, der „Sintflut“ — über ihn anscheinend triumphiert. Die Arche im Hintergrund verweist auf den tragischen Gehalt des Bildes, der daraus resultiert, und darum haben vor allem dieses Bild bis heute die größten Maler rückhaltslos bewundert und geliebt.
So ist auch das Licht Claude Lorrains ein anderes als das seines Landsmannes. Die Luminosität seiner Bilder, oft von der im Bild sichtbaren Lichtquelle, der Sonne oder dem Mond, ausgehend, scheint von der ganzen Natur auszustrahlen, sie ist in Lieht förmlich gebadet, von ihm durchdrungen wie vom göttlichen Gedanken, der in ihren Maßen zum Ausdruck kommt. Als Panentheist, als Schilderer einer Natur die in Gott ruht, müßte Claude eher bezeichnet werden denn als Pantheist, und dieses Strahlen des Göttlichen ist es auch, das uns heute vor seinen schönsten Blättern in der Albertina so tief bewegt. Alles umfassende Liebe ist in ihnen vorhanden, die sich in einer sittlichen Klarheit darstellt, ein Menschsein wie es im bukolischen Frieden des Schäferparadieses Arkadien denkbar war, der Glanz eines verlorenen und durch die Kunst wiedergefundenen Paradieses.
Bei Poussin wird auch das Licht vom Geist geordnet, aucli hier tritt höchstes Menschsein in Erscheinung, kühler, verhaltener, übersichtlicher, aber im Innersten von tiefer Leidenschaft getragen. Dafür zeugen die Bewältigungen der „Bacchanale“, deren Thema für jemanden, der in der Malerei durch die Form Ideen verkörpern wollte — und nicht nur die der Schönheit — nicht von ungefähr gekommen sein muß.
Poussin war der größere Geist — die grössere Seele Claude. So ergänzten sich die beiden Rom zugewachsenen Franzosen als glückliches Dioskurenpaar, das der französischen Kunst für die kommenden Jahrhunderte ein gigantisches Fundament schuf.
Wie Claude sich fortzeugt in Watteau, Corot und Monet so wirkt Poussin weiter in Ingres, Delacroix, Degas und Cėzanne. Als der eine am 16. November 1665 und der andere am 23. November 1682 starb, konnten sie jeder von sich mit jenem mehrdeutigen und tiefsinnigen Spruch sagen: „Et in Arcadia ego“ — „Auch ich war Schäfer in Arkadien“. Durch das ausgleichende Schicksal wieder vereint ruhen sie beide in der Kirche S. Luigi dei Francesi.