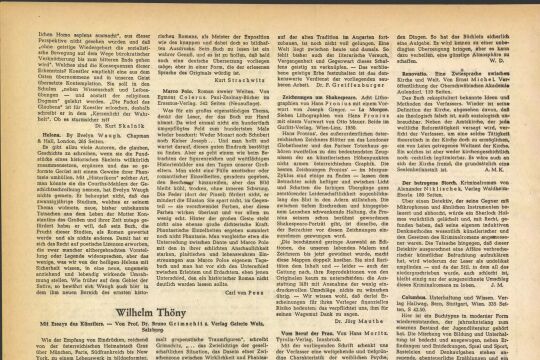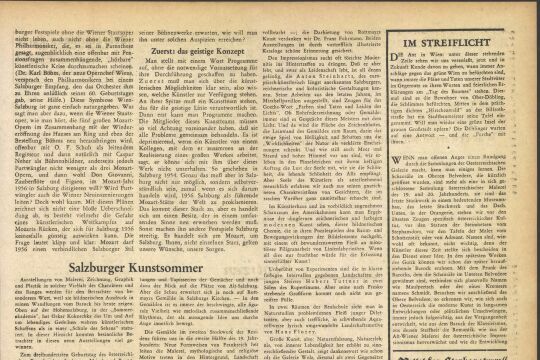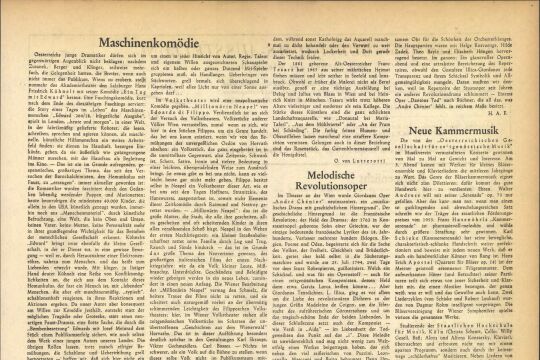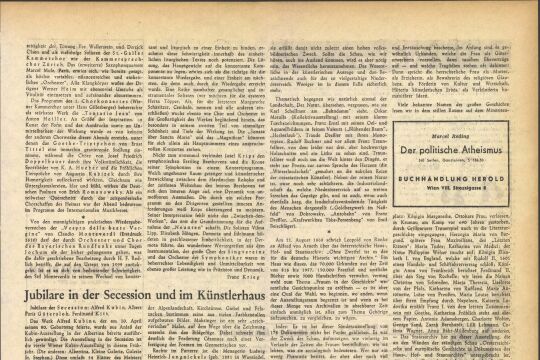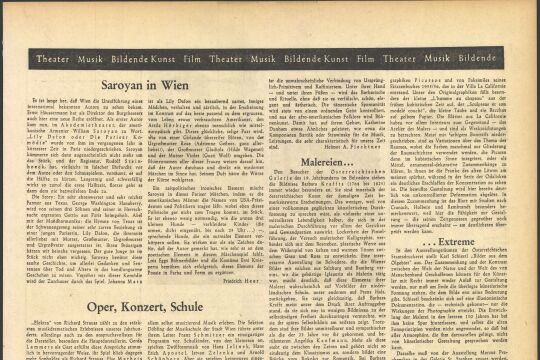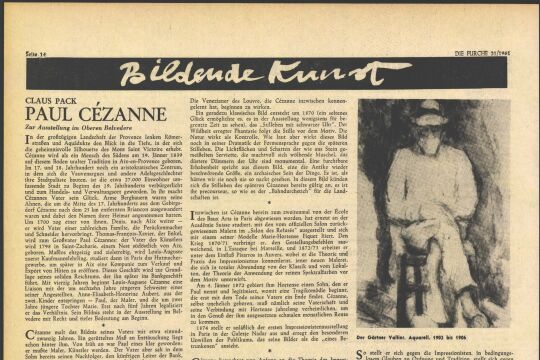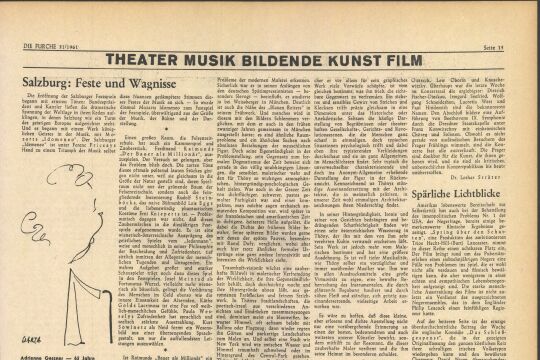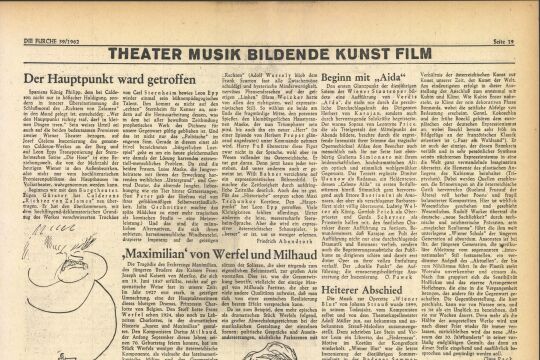Die Ausstellung „österreichische Malerei 1908 bis 1938” ist eine wichtige Schau. Sie ist so wichtig, daß man wünscht sie hätte schon längst — bald nach 1945 — stattgefunden und nicht in Graz, sondern in Wien. Das heißt nicht dėn Ruhm der Grazer Stadtverwaltung schmälern wollen, deren Amt für „Kultur, Sport und Fremdenverkehr” sie veranstaltet, im Gegenteil. Ihre Königsidee, vom Graizer Maler Prof. Fred Hartig stammend und von Dr. Emst Koller, dem neuen Kunstkonsulenten und Direktor der im Entstehen begriffenen Galerie der Stadt, realisiert — unsere Konfrontation mit einer noch recht nahen künstlerischen Vergangenheit —, ist aber so wichtig und notwendig, daß sie unbedingt in einem würdigeren Rahmen (man versteht und billigt die lauteren Gründe der Sparmaßnahmen zwar, muß sie aber bei diesem Anlaß doch bedauern) hätte stattfinden müssen und mit der Möglichkeit einen weiteren Kreis als in dem zwar bezaubernden aber verkehrstechnisch doch abgelegenen Graz zu erreichen.
Die Fülle von Erkenntnissen, Bestätigungen und manchmal sogar Entdeckungen, die sie anbietet, ist so reichhaltig, daß sie eine wiederholte Betrachtung notwendig macht — zumal die Hängung nicht unbedingt ihre Lesbarkeit unterstützt. Tritt man ein, nachdem man sich genügend über die unverantwortliche Placierung der beiden Bilder Sebastian Isepps — eine der Entdeckungen der Ausstellung — im Vorraum geärgert hat, so muß man sich von dem Eindruck frei machen, den die falsche Dominanz des Faistauer-Porträts des „Kammersänger Mayr als Ochs von Lerchenau” an der Hauptwand kraft des knallroten Rockes ausübt. Nicht hier in diesem lauten aber keineswegs überzeugenden Stück Malerei liegen die Kraft- und Höhepunkte dieser Ausstellung, auch nicht in den recht peinlichen Landschaften Faistauers, die es rahmen, sie liegen verstreut im Raum, manchmal gesammelter, manchmal allein. Um sie zu würdigen und die Lehre dieser Ausstellung zu verstehen, ist es aber gut, sich einiges vor Augen zu halten.
1908 fand die erste Veranstaltung der „Klimt-Gruppe” in der sogenannten „Kunstschau” statt, einer von Josef Hoffmann auf dem Gelände des Konzerthauses errichteten Baracke. Dieser Notbau sollte den 1905 mit Klimt aus der Sezession ausgetretenen Künstlern die Möglichkeit geben, in der Öffentlichkeit auszustellen. Hier feierte Oskar Kokoschka sein Debüt, und hier begann die Abwendung von den Verfeinerungen des „Jugendstils” der Sezession. Sein Meister — Klimt — reiste im gleichen Jahr nach Paris und setzte sich mit Vuillard und Bonnard auseinander, was seine Malweise auflockerte und freier machte. Mit Kokoschka debütierte Egon Schiele in der „Kunstschau”, während im gleichen Jahr Richard Gerstl, eine bedeutende Begabung, Fragmente hinterließ, als er sein Leben durch Freitod endete. Alfred Kubin lebte zu dieser Zeit noch in München, ülbte aber auf die jungen österreichischen Künstler, denen er wohl bekannt war, großen Einfluß aus.
In den folgenden Jahren traten in der „Neukunstgruppe” die Maler Anton Kolig, Anton Faistauer, A. P. Gütersloh, Franz Wiegele und Sebastian Isepp hervor. Das war die Situation bevor der erste Weltkrieg ausbrach und als unheilvolle Zäsur in das Kunstgeschehen eingriff. Österreich wurde zerschlagen und die Vielvölkermonarchie, deren Provinzen direkt und indirekt regen Anteil an dem Kunstschaffen genommen hatten, versank. Übrig blieb ein Rumpf-Österreich, dessen Hauptstadt plötzlich nicht mehr der Mittelpunkt eines Reiches war, sondern der überdimensionierte Rest einer glanzvollen Vergangenheit, an die Grenzen Europas, in die Provinz hinabgedrängt. Mit der Zerschlagung Österreichs ging die soziale Umschichtung Hand in Hand. Die kulturtragenden Klassen wurden entmachtet und aufgerieben — bis heute ist bei uns keine neue Gesellschaftsschicht entstanden, die kulturelle Verantwortung besitzt oder trägt. Hatte vor dem ersten Weltkrieg, um die Jahrhundertwende, die Elite der Künstler kaum leibendige Verbindungen mit Paris gehabt — die traditionelle Verbindung nach dem Norden wirkte sich dann zum Nachteil aus —, so riß sie später ganz ab. In provinziellem Selbstbehagen zehrte man am wenigen gebliebenen Kapital, und wenn man ins Ausland ging, so blieb man, weil nahezu überall mehr Malerei geschah als hier — sogar in Prag und Brünn, deren Künstler schon vor dem ersten Weltkrieg Picasso, Braque und den Kubismus aufgegriffen hatten. Denn das war inzwischen in der Welt, vor allem in der damaligen Hauptstadt der Malerei — Paris —, geschehen.
1906 war das letzte „Mont-Sainte-Victoire”-Bild Cėzannes entstanden und er gestorben, 1905 hatten sich schon um Matisse die jungen Maler Braque, Vlaminck, Derain, Dufy u. a. versammelt, man nannte sie bald „Les Fauves”, die Wilden. Ihre Malerei verband die vehementen Farben van Goghs mit dem dekorativen Stil Gauguins und befreite sich mehr und mehr vom Einfluß der „art nouveau”. 1907 malte Henri Rousseau die „Frau mit Schlange”, ein Meisterwerk der „primitiven” Malerei, Picasso die „Demoiselles d’Avignon”, mit denen er die entscheidende Wendung zum Kubismus vollzog, und Edvard Munch porträtierte Walter Rathenau. 1908 entstand der Begriff „Kubismus”, dem sich nun auch Georges Braque zuwendete und nun mit Picasso gemeinsam den analytischen Kubismus ausarbeitete.
1909 setzte Kandinsky das erste üngegenständliche Bild, 1910 malte Delaunay den Eiffelturm und das erste futuristische Manifest erschien. Zwischen 1910 und 1918 entstanden die „Roten Pferde” von Marc, der „Blaue Reiter” wurde gegründet, Rouault begann das „Miserere”, Malevich „gründete” den Suprematismus, Feininger und Klee begannen hervorzutreten, Kandisky malte seine „Improvisationen”, Mondrian seine ersten Abstraktionen, der Dadaismus entstand, und Picasso leitete zum „synthetischen Kuhismus” über, nachdem er Koilagen geschaffen hatte. 1922/23 gab der „Schützengraben” von Otto Dix den Auftakt zum magischen Realismus der neuen Sachlichkeit, der Surrealismus löste bald darauf den Dadaismus ab, und Picasso entfaltete die räumlich formalen Ideen des Kubismus zu alternierenden klassischen und expressiven Phasen, in denen er das Problem einer neuen Raumdarstellung bis in seine letzten, vorwiegend graphisch-malerischen Verästelungen ausging. 1937 entsteht „Guernica”.
Betrachtet man die Ausstellung „österreichische Malerei von 1908 bis 1938 vor diesem Hintergrund der Weltkunst des 20. Jahrhunderts — und man muß es tun, will man zu einer gerechten Einschätzung und zu einer Lehre kommen — dann erheben sich nur einige wenige Gipfel aus provinzieller Befangenheit. Da ist zuerst Klimt, der in seinen kultivierten und Urbanität atmenden Bildern, durch seine Beziehungen zur „art nouveau” in die internationale Entwicklung, wenn auch nur in ihre peripheren Manifestationen, hineinreicht. Schon Schiele hat nicht seine Statur. In Goaz nicht uninteressant vertreten, atmet sein Oeuvre eine viel größere Bedingtheit und Enge als jenes von Klimt. Nach Aussagen eines erst jüngst verstorbenen Freundes, wollte er knapp vor seinem Tod 1918 nach Paris gehen, um „endlich wirklich malen zu lernen”. Gerstl vollends ist ein tragischer Fall. Während das „Liechtensteinpalais” ein schönes, mit sensibler Verve gemaltes Bild im Sinne deutscher Freilichtmalerei darstellt und zu Slevogt und Corinth tendiert, sie beide aber an Empfindung übertrifft, ist das „Selbstbildnis” in seinem Jugendstilformat zwar stellenweise ein Stück reicher Malerei, aber im ganzen nur ein Versprechen, das das „Bildnis Alexanders v. Zemlinsky” nicht hält. Das Fragmentarische der letzten Bilder Gerstls, die unter einem ungeheueren inneren Druck entstanden sind, wird hier zur Tragödie. Gerstl mit Munch vergleichen zu wollen, ist nur aus provinzieller Befangenheit zu verstehen, ihn aber als Vorläufer schon wieder abgelebter Tendenzen zu feiern, eine Beleidigung seiner Not. Wo Munch Stil setzt, geschieht bei Gerstl „Stilbildung aus Unvermögen” (Berenson) — und noch so heroisches Scheitern ergibt noch kein Bild oder Kunstwerk.
Die beiden wirklich großen Persönlichkeiten, deren Kunst über die Grenzen Österreichs hinauszielte, sind nach Klimt Kokoschka und Herbert Boeckl. „Die Freunde” sind zwar kein großes oder gutes Bild, dazu ist Fläche und Raum zu wenig beherrscht und gestaltet, aiber eine Sammlung von mit hailuzinativer Expression gemalten Gesichtern, ein wogendes Gewebe von verschiedenen magischen Grautönen. Auch bei dem Bildnis „Marcel v. Nemes” fasziniert nur der, mit rüder Eindringlichkeit gemalte Ballonkopf des Sammlers — Leib und Raum verschwinden in vagen Angaben. Die „Grinziiger Landschaft” blüht wie ein ungeordneter Blumenstrauß, in manchmal etwas bengalischem Feuer, aber voll reichem Leben. Kokoschka verbindet Wien mit Berlin und Dresden, Prag und München, wie bei Kubin ist bei ihm böhmisches Erbe spürbar, eine Grundsubstanz der Monarchie. In seinem sehr persönlichen psychologisierenden Expressionismus schließt er an eine mitteleuropäisch-nordische Bewegung der Kunst des 20. Jahrhunderts an. Auch Herbert Boeckl beginnt mit einem sehr persönlichen aber nüchterneren Expressionismus. Das in seinem 21. Lebensjahr entstandene „Bildnis Grimschitz” in die Auswahl aufzunehmen, war eine fragwürdige Tat. Ebenso die Wahl der „Blumenvase”, die Skizze geblieben ist, und des „Liegenden weiblichen Aktes”. Nein, Boeckl ist leider gegenüber Kokoschka nicht in der Bedeutung repräsentiert, die ihm zukommt. Der „Steinbruch mit rotem Schatten”, das „Stilleben mit springendem Pferd” sind zwar kapitale Bilder von europäischem Format, aber im Verhältnis zur Größe dieses Malers an Zahl zu wenige Akzente in einer so wesentlichen Ausstellung. Nach diesen beiden großen Malern fallen Kolig und Wiegele stark ab. Die Herkunft Koligs von Münchener Ateliermalerei ä la Angelo Jank und dem späten Trübner wird immer evidenter — mit Expressionismus im klassischen Sinn hat er wenig zu tun. Nicht alles, was fahrig gemalt oder skizzenhaft hinge- schleudert wurde, ist Expressionismus. Wie man Wiegele einst mit Waldmüller und Cėzanne (!) in Beziehung setzen konnte, wird immer unbegreiflicher. Das ist — nicht einmal beste — Münchener Schule und Carl Fahringer, der nicht besonders vertreten ist, ist dann mindestens ebenso „bedeutend”. Clementschitsch fasziniert durch ein frühes Straßenbild, und man bedauert, was später an ihm als Maler verloren ging. Rudolf Wacker steigt zu immer bedeutenderer österreichischer Statur auf, Dobrowsky, R. C. Andersen und Sergius Pauser erweisen ihre eminente Bedeutung im Rahmen malerischer Kultur österreichischer und im Falle Dobrowskys tschechischer (Kremlicka!) Prägung.
Die neue Sachlichkeit hatte damals auch auf Carry Hauser gewirkt, der sie zu einem sehr persönlichen Stil naiver Innigkeit entwickelte. Eine Entdeckung, neben dem Jugendstilkomposition mit Matissefarben verbindenden Isepp, ist der frühverstorbene Jean Egger, dessen Bildnisse sich vom frühen Kokoschka zu einem gemäßigten Soutine und Kis- ling hin entwickelten, der farbig feinnervige Boeckl-Freund Esteri, ebenfalls frühverstorben, die in ihrer Frische und Weite bemerkenswerte Landschaft von Zinkenbach von Emst Huber, die stille Poesie der Landschaft von Rudolf Klaudus, die fest gefügte Freilichtmalerei von Carl Moll (die anscheinend Andersen befruchtete), der farbig reiche Nikodem, die „Wäscherin” von Leo Putz, der wirklich „magische” Sedlacek, den sich die „Wiener Phantasten” besser ansehen müßten, das recht atmosphärische „Schloß Leopoldskron” von Steinhart, die sehr zusammenhängende Kollektion von Thöny, das Bildnis von Viktor Tischler, die „Schnitterinnen” von Hans Josef Weber-Tyrol und manches aus der nicht ganz glücklichen Kollektion Wickenburg. Ferdinand Kitt ist leider nicht gut vertreten, Mopp ebensowenig, und vieles, sagen wir manches, wäre besser weggeblieben. Und doch ist im Gesamten eine äußerst sehenswerte und lehrreiche Ausstellung entstanden, die uns nahelegt, daß erst in dem Augenblick, in dem die österreichische Kunst ihre engen Grenzen verläßt und sich nach den Polen alter Tradition und lebendiger Kunst richtet und wendet, Lebendiges und Neues auch in unseren Grenzen entstehen kann.
Und daß die in ihr enthaltenen Faktoren dem unverwechselbaren Gesicht eines eigenen Volkes, einer eigenen Schicksalsgemeinschaft entsprechen, daß sie das persönliche Gesicht eines besonderen Genius zeigt.