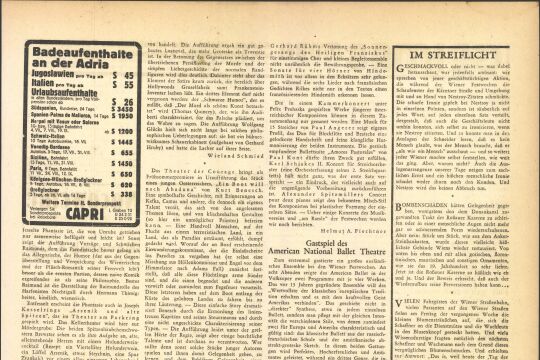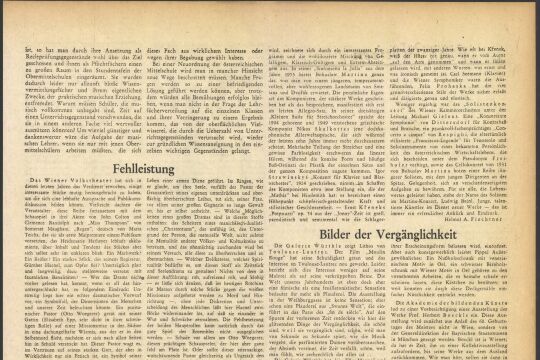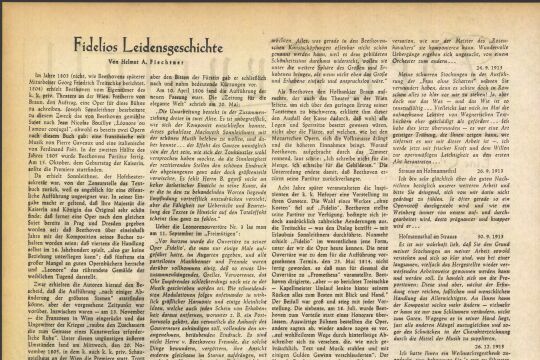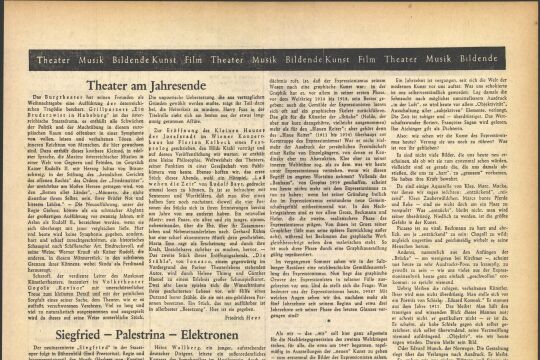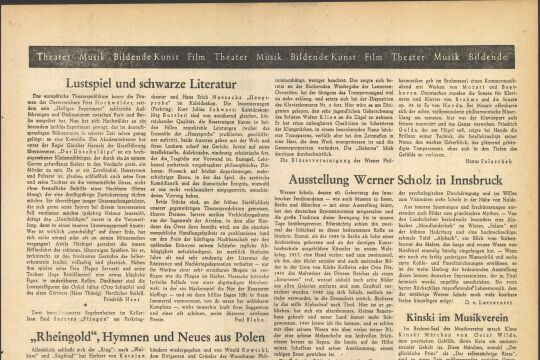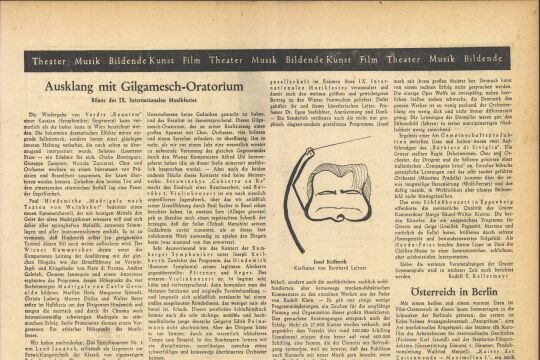Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von LEONORE 1805/06 zu LEONORE 1940/45
Betrachtet man die Programme unserer beiden großen Konzertinstitute, so könnte man auf die Idee kommen, daß sie während der Wiener Festwochen Opernwettspiele veranstalten. Im Musikverein führt man „Fidelio“ und Hugo Wolfs „Cor-regidor“ konzertant auf und im Konzetthaus „Die Frau ohne Schatten“, „Le Martyre de Saint-Sebastien“ von Debussy, Orffs „Trionfi“ und — szenisch — eine neue „Leonore“ (weder nach Sonnleithner noch nach der Bürgerschen Ballade, wie man in einer Tageszeitung lesen konnte). Der bekannte deutsche Musikschriftsteller Dr. Heinrich Strobcl, Wortführer der „modernen“ Richtung, Debussy- und Hindemith-Biograph, schrieb für den Schweizer Komponisten Rolf Liebermann einen sketchartigen, ansgielungsreichen Text mit ernstem Zeithintergrund und pazifistisch-völker-versöhnender Tendenz. Daher der Untertitel „Opera semiseria“. Die Geschichte der treuen Liebe eines deutschen Besatzungssoldaten zu der Pariserin Yvette zieht in sieben Bildern vorüber: vom ersten zum vierten sich immer mehr verdüsternd und dann, unter Mithilfe des Schutzengels „Monsieur Emile“, sich wieder aufhellend. Dazwischen sind geistvolle, wirklieh amüsante musikalische Gags eingestreut, wie man sie von den beiden versierten Autoren nicht anders erwartet. So, wenn in einem Pariser Konzertsaal zur Erbitterung der Zuhörer Liebermanns stürmische Klaviersonate gespielt wird und sich Besatzung und Besetzte in schöner Gefühlsharmonie beim nächsten Stück, Liszcs „Liebesträumen“, wieder erholen; oder wenn, in Erinnerung an „herrliche Zeiten“, ein Wagner-Zitat vorüberhuscht und bei der Erwähnung von Wallenstadt der Marsch aus Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“ anklingt; oder wenn in einem Zwischenspiel die Fidelio-Fanfaren und auf dem dramatischen Höhepunkt ein anderes Motiv aus der Ouvertüre kurz und heftig zitiert wird. Alles geschieht gewissermaßen auf mehreren Ebenen; aber erst die komplizierte und anspruchsvolle Musik gibt dem Ganzen die dritte Dimension. Ein gewisser lyrischer Chromatismus erweist sich, wenigstens in diesem Werk, als Liebermanns Stärke und Eigenart, birgt anderseits aber auch die Gefahr der Monotonie in sich. Auf jeder Seite aber zeigt die Partitur die Handschrift eines gewandten und immer geschmackvollen Könners. — Nachdem sich Linz vor einigen Wochen die Lorbeeren der österreichischen Erstaufführung geholt hat, folgte nun das Wiener Konzerthaus im Rahmen des 5. Internationalen Musikfestes mit einer Aufführung, deren bescheidene szenische Mittel im Espressostil sehr geschickt und wirkungsvoll eingesetzt wurden. Hans R o s b a u d dirigierte die Symphoniker und den Wiener Kammerchor, Rita Streich und Rosette Anday repräsentierten als Mutter und Tochter Frankreich (nebenbei: größtenteils in französischer Sprache), Helmuth Krebs und Walter Berry (Vater und Sohn) Deutschland; Rauol Aslan, weise und elegant, im grauen Anzug mit Flügeln, markierte als Monsieur Emile den Helfer von oben; — Im Unterschied zu .Berlin wurde die Tendenz des Stückes richtig, das heißt ohne böse Spitze gegen irgendjemand, verstanden und freundlich akklamiert.
Kurz vorher fand im M u s i k v e r e i n als Abschluß des Beethoven-Zyklus eine konzertante Aufführung von Beethovens „Fidelio“ statt, dessen Titel ja ursprünglich „Leonore ou l'amour conjugal“ lautete und den der Komponist nur ungern (wegen Verwechslungsgefahr mit einer zeitgenössischen Leonora-Oper) aufgab. Die Besetzung mit Martha Mödl und Elisabeth Schwarzkopf, Wolfgang Windgassen, Joseph Metternich, Rudolf Schock und anderen kann nicht anders als „glanzvoll“, die Aufführung durch die Symphoniker und den Singverein als „perfekt“ bezeichnet werden. Das Ganze aber würde der weise Monsieur Emile aus der neuen „Leonore“ vielleicht mit dem unübersetzbaren „gratuit“ abtun. *
Bei der Besprechung der Werke, die in den letzten Konzerten aufgeführt wurden, müssen vtic auf jene verzichten, die den bekannten Grundzügen des betreffenden Komponisten keine neuen hinzufügen (so Werner Egks an dieser Stelle bereits angezeigte „Tentation de Saint Antoine“, Hanns Jelineks „Suite für Streicher“ op. 11 und Frank Martins Violoncello-Ballade). Als Uraufführung hörten wir Josef Matthias Hauers Kantate für Soli, Chor und Orchester „D e x Menschen Weg“, nach Worten von Friedrich Hölderlin: von einer auch für den Laien erkennbaren Gesetzmäßigkeit und höchst eindrucksvollen inneren Verwandtschaft zu den pathetisch-trauervollen Hymnen des schwäbischen Griechenschwärmers. Die meist metrische Deklamation der Texte, ohne Wortwiederholungen, ihre sparsame Ornamentierung und strengstilisierte Harmonisierung machen einen tiefen, geschlossenen und vollkommenen Eindruck.
Nach seiner fast kammermusikalischen 5. Symphonie überraschte der Münchner Karl Amadeus Hartmann mit einer bläser- und schlagwerkgewaltigen Sechsten, die den Großen Konzerthaussaal erzittern ließ und das Publikum zu lebhaften Pro- und Anti-Demonstrationen hinriß. Das Riesenorchester stimmt zunächst ein breitangelegtes, hochexpressives Adagio an und stürzt sich dann in drei gewaltige Fugen, für deren jede dem Orchester der Wiener Symphoniker ein „Bravo“ gebührt. Die Musik Hartmanns hat, bei aller Härte, Substanz und Kraft. Eine gewisse Ueberladenheit nimmt man gern in Kauf, besonders, wenn man unmittelbar vorher W o 1 f g a n g Fortners oratorische Szene „I s a a k s Opferung“ im strengen. Zwölftonstil gehört hat, eine jener abstrakten, uninspirierten Kompositionen, deren konstruktive Logik wohl nur dem Autor (und vielleicht noch dem Leser der Partitur), aber nicht dem Hörer einleuchtet.
Deutschlands Allerjüngsten untet den bereits Berühmten, den 26jährigen Han Werner H e n 2 e, lernten wir in einem Konzert des Col-legium musicum unter Kurt Rapf kennen. Von einem sehr hübschen „Jugendwerk“ im Stil der Spielmusik, den frühen Hindemith oder Casellas (Kammerkonzert für Flöte, Klavier und Streicher) soll sich der Komponist bereits distanzieren. So rasch ändern sich die Zeiten — und mit ihnen die Stile! Dagegen zeigt die Vertonung eines etwas schwülstig-rhetorischen Werfel-Gedichtes mit dem fatalen Titel „Der Vorwurf“ angeblich Henzes neuen Stil: jene Mischung von abstrakt und naiv-illustrierend, wie sie Schönberg inaugurierte und wie sie seither von den Zwölftönern für jede Art von Text — ob es sich nun um einen Fahrplan oder die Bibel handelt (siehe „The Santa-Fe-Time Table“ von Krenek und „Isaaks Opferung“) — angewendet wird. Helmut A. Fiechtner
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!