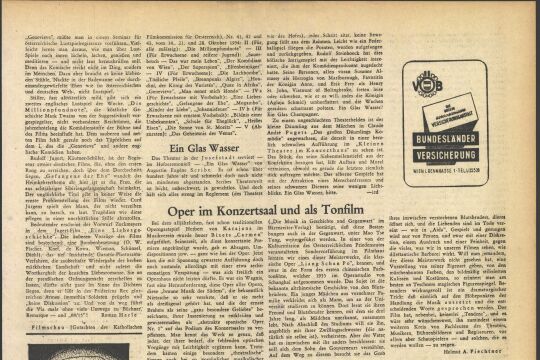Gäbe es eine Zeittafel, eine Art synchronistischer Tabelle, auf der die maßgeblichen Werke der Dichtung, des Theaters, der Oper und der bildenden Künste verzeichnet sind, so müßte man wohl feststellen, daß die Oper, das Musiktheater, infolge seines luxuriösen und sehr komplexen Charakters, das „konservativste“ Genre ist. Das durch die moderne Naturwissenschaft, die Tiefenpsychologie im besonderen, die neuere Philosophie und die Dichtung (sowohl in der Lyrik als auch in Roman und Sprechstück) erarbeitete und dargestellte neue Menschenbild findet auf der Opernbühne nur zögernd und mit jahrzehntelanger Verspätung seine entsprechende Spiegelung. Nur in ganz vereinzelten Werken finden wir Versuche zu seiner Gestaltung, etwa in der „Salome“ von Richard Strauss (1905), in der „Elektra“ von 1909 oder in Schönbergs Monodrama „Erwartung“ aus dem gleichen Jahr. Die Meisterwerke der „Moderne“ folgen in der Oper wesentlich später: Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“ (nur getanzt und gesprochen, 1918), des gleichen Autors oratorische Oper „Ödipus Rex“ (1926), Alban Bergs „Wozzeck“ (1925), Schönbergs „Moses und Aron“ (1933, zunächst unaufgeführt) bis herauf zu Hindemiths „Mathis der Maler“ (1934). Nicht zu vergessen die Sensationserfolge der zwanziger Jahre, Brechts „Dreigroschenoper“ und „Mahagonny“ sowie Ernst Kreneks „Jonny spielt auf“.
-Heute, wo man geradezu, von einer^ Jagd der ambitionierten (vornehmlich deutschen) Opernhäuser nach dem Avantgardistisch-Neuen sprechen kann, stehen moderne Opern und Ballette viel weiter vorne. Das bezeugen Experimental-werke wie die „Abstrakte Oper No. 1“ von Egk und Blacher, „Der Gefangene“ von Dallapiccola, Einems „Prozeß“ nach Kafka und viele andere, bis zu Birger-Blomdahls Weltraumoper „Aniara“ und den zahlreichen Balletten zu elektronischer Musik. Textdichter und Komponisten bevorzugen Grenzsituationen, extreme Lagen des Menschen, „ausgefallene“ Sujets. Naturalismus und Realismus sowie psychologisch Konventionelles findet wenig Interesse. Das Irreale, Visionäre, Phantastische und Absurde hat sich der Opern-und Ballettbühne bemächtigt.
Diese Eindrücke mußte jedenfalls ein Besucher der Berliner Festwochen 1960 gewinnen, die alljährlich in der zweiten Septemberhälfte in Berlin stattfinden und von Dr. Gerhart von Wester-man als ihrem Intendanten geleitet werden. Insgesamt konnte man innerhalb einer Woche zwei neue Opern und acht Ballette besuchen. — Da gab es zunächst die (Welt-) Uraufführung des neuesten Bühnenwerkes von dem in Westberlin lebenden und unterrichtenden Balten Boris Blacher. „Rosamunde Floris“ ist der Titel dieses sehr merkwürdigen Opus, dessen Text von Georg Kaiser stammt, der das Stück (gleichen Namens) während der Zeit seiner inneren Emigration in den Jahren 1936/37 schrieb, ohne die geringste Aussicht, es jemals auf der Bühne zu sehen. Die Heldin mit dem blumenhaften Namen ist ein höchst abseitiges und gefährliches Geschöpf. Als junges Mädchen erlebt sie — drei kurze Wochen lang — ihre große Liebe mit einem Mann, der sie auf Nimmerwiedersehen verläßt, um in die Tropen, woher er gekommen ist, zurückzukehren. Von ihm erwartet sie ein Kind, und dieses — sowie sich selbst mit ihrer Liebe zu dem Entschwundenen — schmuggelt die schöne Betrügerin nun in eine sehr penible, spießbürgerliche Familie. Sie tut es, indem sie einen der Söhne, dessen Namen sie für das zu erwartende Kind braucht, aus dem Wege räumt, indem sie eine Mitwisserin ihrer Tat in den Abgrund stürzt und an dem zweiten Sohn, der aus Pflichtgefühl für seinen Bruder als Vater in die Bresche springen will, mit einem Giftmord bedroht. Bei Georg Kaiser tut Rosamunde Floris noch einiges mehr, aber es sind auch so noch genug der Greuel Das Absurde ist nun, daß es dem Dichter gelingt, für seine schöne Verbrecherin Sympathie hervorzurufen: sie lebt in ihrer Liebe wie eine Schlafwandlerin und beseitigt — gleichsam reflexartig — alles, was sich ihr in den Weg stellt. An diesem Libretto (das Gerhart von Westerman nach dem Stück Georg Kaisers geschickt eingerichtet hat), hat Boris Blacher Gefallen gefunden und dazu eine sehr transparente, karge, zuweilen fast dürftig wirkende Partitur geschrieben, in welcher die fast durchweg rezitativisch eingesetzte Singstimme durchaus dominiert (was die Wortverständlichkeit bedeutend fördert). Als Regisseur hatte man den bekannten Theatermann Erwin Piscator gewonnen, der zum ersten Male eine Oper inszenierte, als Bühnenbildner den hochtalentierten jungen Augsburger Hans-Ulrich Schmückle, der außerordentlich aparte, glasige Bühnenbilder und Requisiten sowie entsprechende, meist in Grautönen gehaltene Kostüme schuf. Ein ausgezeichnetes Ensemble, von dem nur die beiden beanspruchten Sängerinnen Stina Britta Melander und ihre Gegenspielerin Kerstin Meyer als Schwester Wanda genannt seien, wurden von Richard Kraus und dem Orchester der Städtischen Oper präzis und fein begleitet.
Die Hamburger Staatsoper gastierte mit der an dieser Stelle bereits besprochenen Oper „Der Prinz von Homburg“ von Hans Werner Henze, dem talentiertesten deutschen Komponisten der mittleren Generation. Für ihn hat die Österreicherin Ingeborg Bachmann das bekannte Schauspiel zu einem Operntext geformt, ohne die Kleistschen Verse zu verändern. In Text und Musik auch hier: eine Betonung des Visionären, Somnambulen, Abseitig-Einmaligen dieses „Falles“ aus der brandenburgischen Geschichte, das von Henze mit einer ungemein reicneft..y4ejiajbigen(1 bald zarten, bald kräftigen Musik, untermalt,wird, die auch der starken dramatischen Akzente nicht entbehrt. — Die Inszenierung durch Helmut Käutner und die Bühnenbilder und Kostüme von Alfred Siercke waren viel zu realistisch, handfest und historisierend, so daß gerade jenes Element, auf das es dem Komponisten und seiner Librettistin (und wohl auch Kleist) ankam, im Optischen fast völlig verdrängt wurde. Albert Bittner von der Hamburger Staatsoper hat die komplizierte Partitur sauber und klangschön interpretiert, von den Hauptdarstellern seien wenigstens Vladimir Ruzdak als Prinz, Liselotte FöLser als Natalie, Mimi Aarden als Kurfürstin und der unglücklich kostümierte und maskierte Helmut Melchert als Kurfürst hervorgehoben. Nach den einzelnen Akten und am Schluß: minutenlanger Beifall, ohne die bei Henze-Premieren üblichen Pfiffe und Protestrufe der Galerie.
Auch auf dem Gebiet des Tanztheaters gab es eine interessante Begegnung mit einem Standardwerk der Weltliteratur, diesmal mit dem nach einer Legende der Kabbala verfaßten Drama „Der Dybbuk“, das Herbert Ross für seine „Ballets of Two Worlds“ zu einem abendfüllenden choreographischen Drama in 3 Akten und sechs Bildern gestaltet hatte. Es handelt sich hier, wie in dem Stück, um die Geschichte der schönen Leah, die an ihrem Hochzeitstag in der Synagoge von dem Studenten Channon erblickt wird, der-, von verbotener Leidenschaft zu Leah erfaßt, zunächst -Gott um Hilfe bittet, und als dieser ihm nicht beisteht, zum Bösen seine Zuflucht nimmt und sich daraufhin in ein Gespenst, einen Dybbuk verwandelt, der von Leah Besitz ergreift. Hauptszene und Kulminationspunkt des Dramas ist eine große Beschwörungsund Austreibungszeremonie, durch die Leah von dem Dybbuk befreit werden soll. Aber als der böse Geist aus ihrem Körper fährt, ist auch ihr Leben zu Ende, und die Schatten der beiden unheimlichen Liebenden vereinigen sich. Man sieht viel jüdische Folklore, die meist jungen Tänzer sind mit großer Hingabe bei ihrer schwierigen, fast unlösbaren Aufgabe, aber die Berliner Kritik hat das ganze Unternehmen als einen Versager gekennzeichnet. Man ist nämlich der spezifischen (und ungewöhnlichen Form) des „choreographischen Dramas“, das nicht mit den Maßstäben des Balletts, geschweige denn denen des klassischen, gemessen werden darf, nicht ganz gerecht geworden. Freilich hat die unprofilierte, melodisch einfallslose und unangenehm dissonant wirkende Musik von Robert Starer viel zu diesem Mißerfolg beigetragen.
Daß die Truppe etwas kann, über Einfälle und Talente verfügt, sah man an einem zweiten Abend, als die jungen Tänzer (die bei den Festspielen in Spoleto großen Erfolg hatten) vier kürzere Ballette zeigten, deren Themen übrigens das eingangs Ausgeführte über das moderne Tanztheater erhärten. Da gab es zunächst, nach Musik von Bela Bartök („Kontraste“ für Geige, Klarinette und Klavier), vier Tanzszenen nach den bekannten „C a p r i c h o s“ von Goya: makabre und unheimliche Bilder, die mit großer Intensität in Bewegung umgesetzt wurden. Dann folgte, auf Musik von Laurence . Rosenthal, eine „R a sh o m o n - S u i t e“ nach dem gleichnamigen japanischen Film: die viermalige Darstellung eines Verbrechens, wie es sich in den Aussagen der vier Zeugen spiegelt. „Die Zofen“, merkwürdigerweise von zwei Männern getanzt, lehnt sich an das Schauspiel von Jean Genet an und wird zur Musik von Darius Milhaud getanzt. Schließlich beteiligte sich das ganze Ensemble mit sichtlichem Vergnügen an einer Tanzszenenfolge mit dem Titel „Angel He ad“, welche das Verhalten der untereinander und yonu ihrer Umwelt isolierten „Beatniks“ darstellt und dessen Quintessenz Hasjmußgslosigjkejt ^und Langeweile sind. Hier gab es viele gelungene, auch humoristische Details und stellenweise einen sehr reizvollen Kontrast zwischen den müden, fragmentarischen Bewegungen der Tänzer und der lärmenden, quicklebendigen Musik von Lionel Hampton, ein Effekt, der in dieser Art wohl noch nie so bewußt ausgenützt wurde.
In Neuland stieß auch das mittlere Stück eines Ballettabends in der Städtischen Oper vor. Es handelt sich um das Ballett „P a e a n“ für eine Tänzerin, neun Solotänzer und Bewegungschor auf elektrophonische Musik des amerikanischen Komponisten Remi Gassmann, die dieser mit Hilfe von Oskar Sala, dem Erfinder und Spieler des Mixtur-Trautoniums, realisierte. Hier werden die Möglichkeiten der elektronischen Musik mit denen der in Paris praktizierten Musique concrete verbunden, die sich ja besonders zur Illustrierung unheimlicher Vorgänge und seelischer Grenzsituationen eignet. Ohne Dekorationen und kostümliche Ausstattung soll hier „die Kurve des menschlichen Lebens“ dargestellt werden, und „Paean“ bedeutet Lobgesang. Aber auch hier dominierten die düsteren Farben und die dunklen Leidenschaften. Gisela Deege, die in unseren Berliner Berichten immer wieder erwähnt wurde, tanzte mit großem Können die weibliche Hauptpartie. Tatjana Gsovsky, seit vielen Jahren schon Ballettmeisterin und Choreographin der Städtischen Oper, war auch die Spielleiterin einer Tanzdichtung nach Maurice Ravels „L a V a 1 s e“, die nicht zu den gelungensten Schöpfungen dieser interessanten und anregenden Künstlerin zählt, sowie des „R o m e o-und-Julia“- Balletts nach der Musik von Prokofieff. O^-er das Werk wurde an dieser Stelle anläßlich der Wiener Premiere ausführlich berichtet. Die Berliner Ausstattung (Dimitri Bouchene und Ulrich Elsässer) ist origineller, aber weniger prunkvoll als die Wiener, die (gestraffte) Form trägt zur dramatischen Intensivierung viel bei. Die beiden Hauptakteure waren allererste Klasse: Gert Reinholm von der Städtischen Oper und Yvette Chauvin*, die Primaballerina der Pariser „Grand Opera“, als Gast. Hier wurden, im Gegensatz zum „Dybbuk“, Choreographin und Tänzer von der Musik nicht im Stich gelassen, sondern empfingen aus dem Orchester sehr wesentliche Impulse, was ja nicht nur bei der Oper, sondern auch beim Ballett wichtig ist.