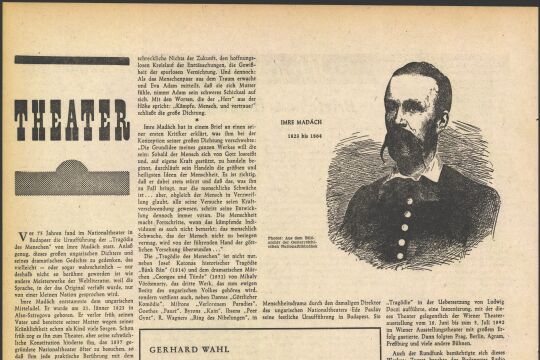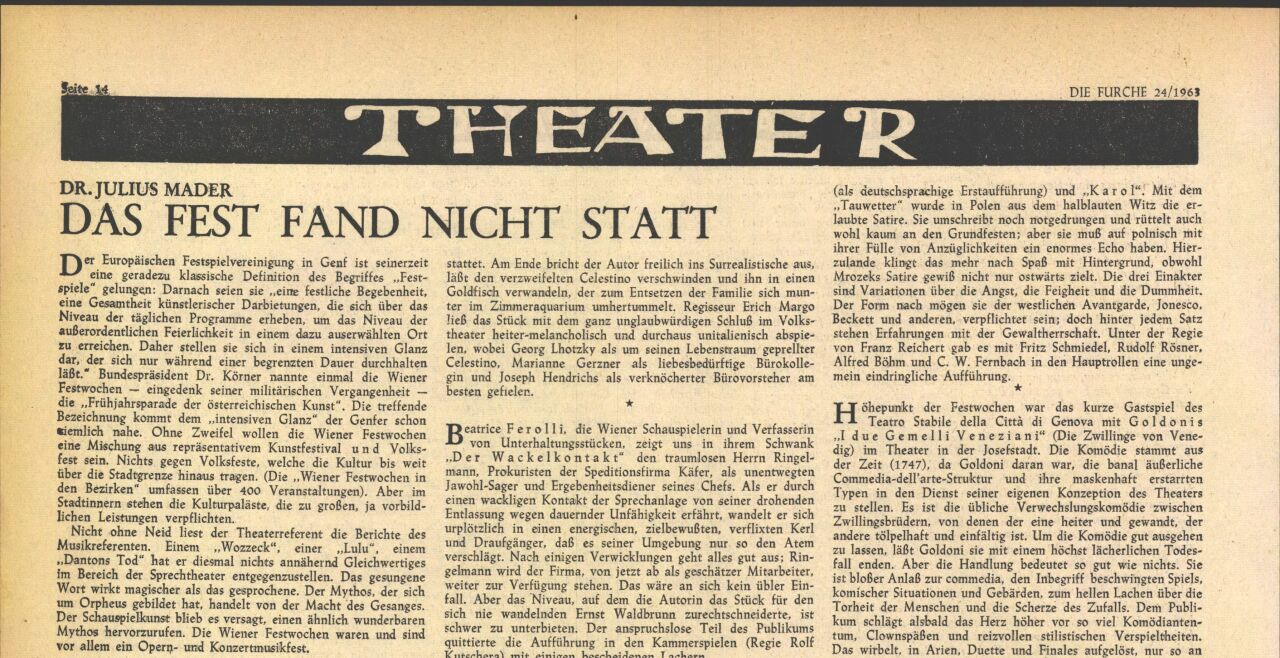
T*Ver Europäischen Festspielvereinigung in Genf ist seinerzeit *“ eine geradezu klassische Definition des Begriffes „Festspiele“ gelungen: Darnach seien sie „eins festliche Begebenheit, eine Gesamtheit künstlerischer Darbietungen, die sich über das Niveau der täglichen Programme erheben, um das Niveau der außerordentlichen Feierlichkeit in einem dazu auserwählten Ort zu erreichen. Daher stellen sie sich in einem intensiven Glanz dar, der sich nur während einer begrenzten Dauer durchhalten läßt.“ Bundespräsident Dr. Körner nannte einmal die Wiener Festwochen — eingedenk seiner militärischen Vergangenheit — die „Frühjahrsparade der österreichischen Kunst“. Die treffende Bezeichnung kommt dem „intensiven Glanz“ der Genfer schon iemlich nahe. Ohne Zweifel wollen die Wiener Festwochen eine Mischung aus repräsentativem Kunstfestival und Volksfest sein. Nichts gegen Volksfeste, welche die Kultur bis weit über die Stadtgrenze hinaus tragen. (Die „Wiener Festwochen in den Bezirken“ umfassen über 400 Veranstaltungen). Aber im Stadtinnern stehen die Kulturpaläste, die zu großen, ja vorbildlichen Leistungen verpflichten.
Nicht ohne Neid liest der Theaterreferent die Berichte des Musikreferenten. Einem „Wozzeck“, einer „Lulu“, einem „Dantons Tod“ hat er diesmal nichts annähernd Gleichwertiges im Bereich der Sprechtheater entgegenzustellen. Das gesungene Wort wirkt magischer als das gesprochene. Der Mythos, der sich um Orpheus gebildet hat, handelt von der Macht des Gesanges. Der Schauspielkunst blieb es versagt, einen ähnlich wunderbaren Mythos hervorzurufen. Die Wiener Festwochen waren und sind vor allem ein Opern- und Konzertmusikfest.
“Dedenken über das Gebotene gelten daher — immer wieder — •*- nur den Wiener Sprechbühnen. Beginnen wir mit dem Zyklus Shakespearscher Königsdramen im Burgtheater. Mit „Richard IL“, dem Eröffnungsstück der sogenannten Lan-caster-Serie in der gewaltigen dramatischen Bilderreihe, wurde er fortgesetzt. (Eigentlich war „Heinrich VI.“ an der Reihe und versprochen, doch der mußte verschiedener Schwierigkeiten wegen auf später verschoben werden.) Das Erstaunliche an diesem Drama ist, daß es sich — ähnlich wie „Hamlet“ — ganz im Diesseits bewegt, aber vom Jenseits bewegt wird. König Richard ist von außen her, durch Gottes Gnaden, zum König gesalbt, und darum unabsetzbar, auch wenn er unrecht tut. Nicht nur Boling-broke, der ihn stürzt, wird schuldig, jeder in diesem Stück wird es. Richard ist der Gnade nicht gewachsen, die (und das ist das Rätselhafte) nicht von ihm weichen will. Daß Macht den Keim des Bösen in sich trägt, zeigt Richard, der selbstgefällig sein Königtum im wahrsten Sinne des Wortes verspielt, ebenso wie sein Gegner Bolingbroke, der die erraffte Macht nur mit Hilfe des Bösen aufrecht erhalten kann.
Jede Inszenierung dieses großen Stückes muß auf dem Wort stehen, das hier gedanklich tief und dem gereimten Vers weithin verpflichtet ist. Aber Leopold lindtberg, der sonst so treffliche Regisseur und Betreuer des Zyklus“ im 'Burgtheater, achtete diesmal leider zu wenig auf die sprachliche Disziplin der Darsteller. Es gab ganze Partien, die unverständlich blieben. Oder es ertönte jenes Burgtheaterpathos, gegen das sich Lindtberg in seiner ausgezeichneten Schrift „Shakespeares Königsdramen“ so scharf ablehnend wendet. Walter Reyer war im Anfang als schauspielernder Kronenträger, von üblen Kreaturen umgeben, zu wenig hochfahrender, pflichtvergessener Genießer. Erst im zweiten Teil, da Richard vor dem Parlament abzudanken gezwungen wird, und vor allem in der Analyse der Verzweiflung, die der abgesetzte König im Verlies von Pomfret selbst anstellt und aus der zugleich das Weitschweifige, Phantasie- und Gefühlvolle zu hören sein muß, erst da gelangen Reyer einige packende Momente. Fred Liewehr, ein bemerkenswert guter Sprecher, wirkt als Bolingbroke viel zu sympathisch. Nicht einen Augenblick glauben wir ihm den harten, bösen Gegenspieler, der dem weichlichen Richard vor allem das berechnende Wartenkönnen, das überlegene Disponieren voraus hat. Mit der scharfen Profilierung der beiden Hauptgestalten, des dramatischen Zentrums aber steht und fällt das personenreiche Stück. So erlebt man alles andere denn eine glanzvolle Aufführung, die einem keineswegs populären Drama Shakespeares Gehör verschafft hätte.
*
Es gibt noch immer Theaterdirektoren, die überzeugt sind, daß eine Uraufführung den angemessenen oder belebenden oder bekenntnishaften oder zumindest attraktiven Beitrag zu den Festwochen darstelle. Diesmal wurden gleich fünf Uraufführungen angesetzt, darunter vier österreichische Stücke. Das erste war Franz Theodor Csokors „Zeichen an der Wand“ im Volkstheater. In unserer Besprechung („Furche“ 21/1963) mußten wir feststellen, daß es dem Senior unter den lebenden österreichischen Dramatikern, dem Autor des ergreifenden Requiems auf den Zerfall Österreich-Ungarns, „3. November 1918“, nicht gelungen ist, das große Drama des Nationalsozialismus zu schreiben. Zwanzig Jahre trennen uns von den schrecklichen Gewalttaten. Eigentlich hätte der Welt in diesen zwanzig Jahren ein Dichter erstehen können, der den schauerlichen Stoff bewältigt. Er ist bisher nicht aufgetaucht.
Weit hinter dem immerhin beachtlichen dramatischen Versuch F. Th. Csokors rangieren die anderen bisherigen Uraufführungen. Die Mitte nimmt Aldo Nikolajs „Die Welt des Wassers“ ein. Der italienische Autor hat sich offenbar Wien für die Uraufführung seiner Stücke erwählt. Wir sahen von ihm bereits im Kleinen Haus der Josefstadt „Die Zwiebel“ und „Das Pendel“ („Furche“ 15/1963). Nikolaj sieht das Ungute, das Böse im Menschen und in der Welt nur mit Nachsicht, mit liebenswürdigem Spott und Witz. Da neben der dramatischen Begabung auch ein Stückchen Poet in ihm steckt, entstehen ansprechende, nette Bühnenwerke, die ihr Publikum finden und erheitern. In der „Welt des Wassers“ ist es der Träumer Celestino, der so frei sein möchte wie die Fische im Meer, dem seine ganze Sehnsucht gehört. Aber ihm hängt die schreckliche Familie an: Mutter, Schwester, Schwager und am Ende noch eine Braut, die er heiratet. Und so wird er statt ein freier Fischer ein kleiner unglücklicher Staatsbeamter, dem sie zu Hause jeden Ersten das magere Gehalt für Ratenkäufe abnehmen. Das ist durchaus realistisch gesehen, weniger auf Handlung anlegt, mehr in der Art eines Volksstückes mit gut charakterisierten Typen ausge-
stattet. Am Ende bricht der Autor freilich ins Surrealistische aus, läßt den verzweifelten Celestino verschwinden und ihn in einen Goldfisch verwandeln, der zum Entsetzen der Familie sich munter im Zimmeraquarium umhertummelt. Regisseur Erich Margo ließ das Stück mit dem ganz unglaubwürdigen Schluß im Volkstheater heiter-melancholisch und durchaus unitalienisch abspielen, wobei Georg Lhotzky als um seinen Lebenstraum geprellter Celestino, Marianne Gerzner als liebesbedürftige Bürokollegin und Joseph Hendrichs als verknöcherter Bürovorsteher am besten gefielen.
★
Beatrice F e r o 11 i, die Wiener Schauspielerin und Verfasserin von Unterhaltungsstücken, zeigt uns in ihrem Schwank „Der Wackelkontakt“ den traumlosen Herrn Ringelmann, Prokuristen der Speditionsfirma Käfer, als unentwegten Jawohl-Sager und Ergebenheitsdiener seines Chefs. Als er durch einen wackligen Kontakt der Sprechanlage von seiner drohenden Entlassung wegen dauernder Unfähigkeit erfährt, wandelt er sich urplötzlich in einen energischen, zielbewußten, verflixten Kerl und Draufgänger, daß es seiner Umgebung nur so den Atem verschlägt. Nach einigen Verwicklungen geht alles gut aus; Ringelmann wird der Firma, von jetzt ab als geschätzer Mitarbeiter, weiter zur Verfügung stehen. Das wäre an sich kein übler Einfall. Aber das Niveau, auf dem die Autorin das Stück für den sich nie wandelnden Ernst Waldbrunn zurechtschneiderte, ist schwer zu unterbieten. Der anspruchslose Teil des Publikums quittierte die Aufführung in den Kammerspielen (Regie Rolf Kutschera) mit einigen bescheidenen Lachern.
„Man mußte nur die vielfachen Stimmungen und Situationen des Originals, die schon Musik in sich hatten, in die Sphäre des Chansons überführen, man konnte ohne allzu harte Eingriffe das, was in den heiteren und nachdenklichen Dialogen gesagt war, konzentrieren und sorgsam ergänzen und für das Josef Städter Ensemble mundgerecht machen; der Herbst 1913, neu gesehen im Frühjahr 1963 ...“, meint Hans W e i g e 1, der Bruno Schupplers Komödie „Junger Herr von vierzig Jahren“ (1949) bearbeitet hat, woraus dann mit der Musik von Robert Stolz das musikalische Lustspiel „Ein schöner Herbst“ geworden ist. Ein schon in die Jahre kommender Junggeselle hält sich an seinem Geburtstag drei ihn heimsuchende ehemalige Herzensdamen vom Leib und erlebt mit einer Jungen einen neuen Liebesfrühling. Glück reimt sich da auf Augenblick, und wo das Wort versagt, hilft die Stolzsche Musik mit Melodien, die einem alle so merkwürdig bekannt vorkommen, rettend aus. Das ganze wäre im Frühling 1963 wirklich kaum der Rede wert, hätte man bei der Uraufführung im Theater in der Josefstadt nicht bekannte, ja prominente Schauspieler für dieses Musi-calettchen aufgeboten. Immerhin mimt, singt und tanzt Leopold Rudolf den notorischen Herzensbrecher, einen recht dünnen Extrakt aus Hofmannsthals „Schwierigem“ und Schnitzlers Herrn von Sala im „Einsamen Weg“, .während Elfriede Ott eine zwischen Hernais und Paris beheimatete Chansonette hinlegt, daß die übrige junge Weiblichkeit zu faden Mauerblümchen degradiert wird. Nur Anni Rosar tut einem leid, für die man die winzige Episodenrolle der böhmakelnden (warum eigentlich?) Frau Welsperg als eine Art Huldigung zum 75. Geburtstag gedacht hatte. Hätte man doch nur die große Künstlerin während der Festwochen die „Perser“ rezitieren lassen und den „Schönen Herbst“ in den heißen Sommer verlegt!
Von da ab kann es nur noch aufwärts gehen. Vielleicht setzt sich Hans Friedrich K ü h n e 11 mit seinem Flüchtlingsdrama „Straße ohne Ende“, über das im nächsten Referat gesondert berichtet werden soll, an die Spitze der österreichischen Uraufführungen.
*
Im Konzerthauskeller der Josefstadt wurden drei Einakter des mutigen polnischen Satirikers Slawomir M r o z e k (Jahrgang 1930) aufgeführt: „S t r i p -1 e a s e“, „Auf hoher See“
(als deutschsprachige Erstaufführung) und „Karo 1“. Mit dem „Tauwetter“ wurde in Polen aus dem halblauten Witz die erlaubte Satire. Sie umschreibt noch notgedrungen und rüttelt auch wohl kaum an den Grundfesten; aber sie muß auf polnisch mit ihrer Fülle von Anzüglichkeiten ein enormes Echo haben. Hierzulande klingt das mehr nach Spaß mit Hintergrund, obwohl Mrozeks Satire gewiß nicht nur ostwärts zielt. Die drei Einakter sind Variationen über die Angst, die Feigheit und die Dummheit. Der Form nach mögen sie der westlichen Avantgarde, Jonesco, Becke und anderen, verpflichtet sein; doch hinter jedem Satz stehen Erfahrungen mit der Gewaltherrschaft. Unter der Regie von Franz Reichert gab es mit Fritz Schmiedel, Rudolf Rösner, Alfred Böhm und C. W. Fernbach in den Hauptrollen eine ungemein eindringliche Aufführung.
Höhepunkt der Festwochen war das kurze Gastspiel des Teatro Stabile della Cittä di Genova mit G o 1 d o n i s „I due Gemelli Veneziani“ (Die Zwillinge von Venedig) im Theater in der Josefstadt. Die Komödie stammt aus der Zeit (1747), da Goldoni daran war, die banal äußerliche Commedia-deH'arte-Struktur und ihre maskenhaft erstarrten Typen in den Dienst seiner eigenen Konzeption des Theaters zu stellen. Es ist die übliche Verwechslungskomödie zwischen Zwillingsbrüdern, von denen der eine heiter und gewandt, der andere tölpelhaft und einfältig ist. Um die Komödie gut ausgehen zu lassen, läßt Goldoni sie mit einem höchst lächerlichen Todesfall enden. Aber die Handlung bedeutet so gut wie nichts. Sie ist bloßer Anlaß zur commedia, den Inbegriff beschwingten Spiels, komischer Situationen und Gebärden, zum hellen Lachen über die Torheit der Menschen und die Scherze des Zufalls. Dem Publikum schlägt alsbald das Herz höher vor so viel Komödianten-tum, Clownspäßen und reizvollen stilistischen Verspieltheiten. Das wirbelt, in Arien, Duette und Finales aufgelöst, nur so an einem vorüber, zumal es die italienischen Schauspieler bei aller unwahrscheinlichen Zungenfertigkeit zuwege bringen, die Sprache mühelos in Musik übergehen zu lassen. Triumph des Theaters: eines seiner Genies vermag die Zuschauer in die holde Täuschung zu versetzen, es müßte auch ihnen gelingen, so leicht, so heiter und so gutgelaunt zu leben und zu lieben wie die Komödianten dort oben auf der Bühne. Hier strahlten Stück und Aufführung wahrhaftig „intensiven Glanz“ des Festlichen aus. Nur zwei Namen von allen nennenswerten: Die Inszenierung besorgte Luigi Squarzina, in Wien auch als namhafter Dramatiker bekannt, die Doppelrolle der Zwillingsbrüder
spielte mit nicht zu überbietender Verve Alberto Lionello.
*
Jahrelang war ich zu sehr mit den zerstörerischen Impulsen des Daseins beschäftigt. Von nun ab will ich mich freundlicheren Aspekten widmen ...“, bekannte Tennessee Williams, berühmter und berüchtigter Erfolgsdramatiker Amerikas, während er an seinem Stück „Die Nacht des L e g u an“ schrieb. Tatsächlich klingt in der Geschichte von dem ausgestoßenen Priester Shannon mit seiner männerfressenden Wirtin und der alternden Schnellmalerin Hannah, die mit ihrem 97jährigen .Großvater-Poeten durch die Lande .zieht,,,ei, neueri versöhnlicherer Ton an. Es kommt nicht mehr zur endgültigen Vernichtung: das Leben geht weiter. Vieles in dieser bei Williams üblichen Verquickung von verbissener Psychoanalyse und Symbolik enthält noch die alte Standardaufmachung der früheren Bühnenwerke mit ihren Unappetitlichkeiten und Peinlichkeiten. Aber zumindest eine Gestalt, die des alternden Mädchens Hannah, eine „reine Seele“ und ein „fröhlicher Engel“, verleiht dem Stück Bedeutung. Das Gastspiel des Berliner Renaissance-Theaters im Akademietheater zeigt eine intensive Aufführung (Regie Willy Maertens), in der die zarte, sensible Grete Mosheim
als Hannah Jelkes eine überrapende, ergreifende Leistung bot.
★
Die Wiener Festwochen sind vorbei, die Theatersaison neigt sich dem Ende zu. Die führenden Theater Wiens haben bereits ihre Spielpläne für 1963/64 veröffentlicht. Die zwei ältesten Theater, das Burgtheater und das Theater in der Josefstadt werden seltene Jubiläen feiern. Laßt uns hoffen, daß es ein festliches Jahr wird.