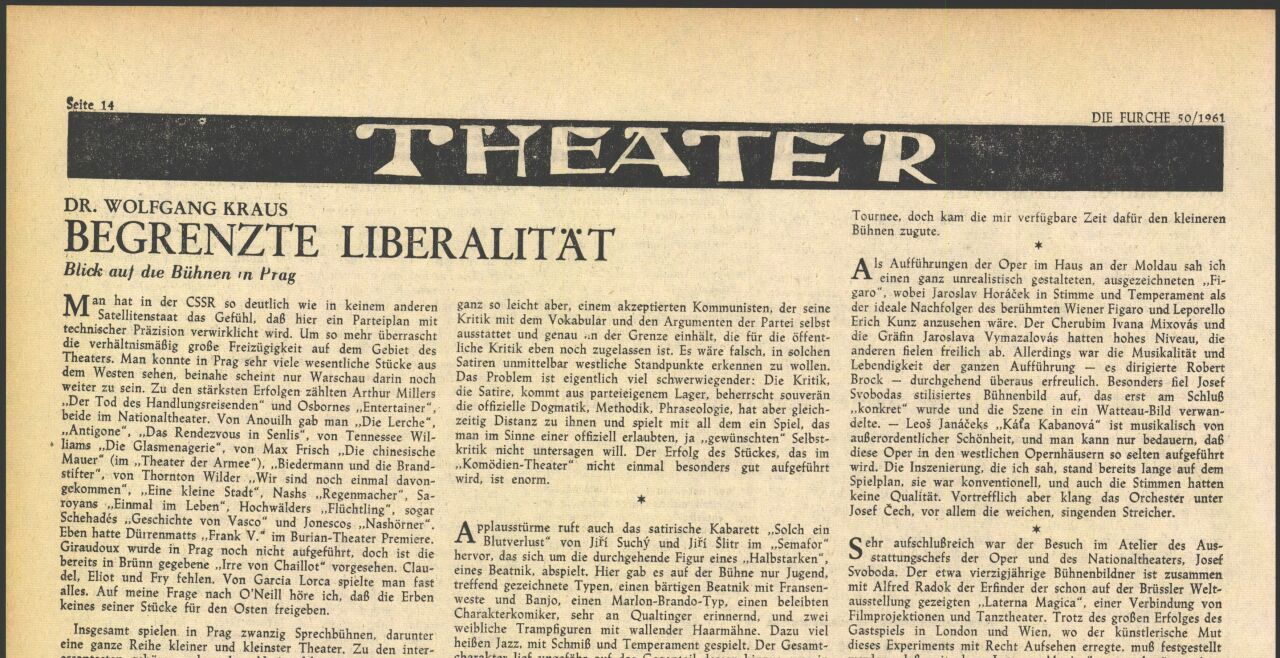
Man hat in der CSSR so deutlich wie in keinem anderen Satellitenstaat das Gefühl, daß hier ein Parteiplan mit technischer Präzision verwirklicht wird. Um so mehr überrascht die verhältnismäßig große Freizügigkeit auf dem Gebiet des Theaters. Man konnte in Prag sehr viele wesentliche Stücke aus dem Westen sehen, beinahe scheint nur Warschau darin noch weiter zu sein. Zu den stärksten Erfolgen zählten Arthur Millers „Der Tod des Handlungsreisenden" und Osbornes „Entertainer", beide im Nationaltheater. Von Anouilh gab man „Die Lerche“, „Antigone“, „Das Rendezvous in Senlis“, von Tennessee Williams „Die Glasmenagerie“, von Max Frisch „Die chinesische Malier (im „Theater der Armee“), „Biedermann und die Brandstifter , von Thomton Wilder „Wir sind noch einmal davongekommen , „Eine kleine Stadt“, Nashs „Regenmacher“, Saroyans „Einmal im Leben“, Hochwälders „Flüchtling“, sogar Schehades „Geschichte von Vasco“ und Jonescos „Nashörner“. Eben hatte Dürrenmatts „Frank V." im Burian-Theater Premiere. Giraudoux wurde in Prag noch nicht aufgeführt, doch ist die bereits in Brünn gegebene „Irre von Chaillot“ vorgesehen. Claudel, Eliot und Fry fehlen. Von Garcia Lorca spielte man fast alles. Auf meine Frage nach O’Neill höre ich, daß die Erben keines seiner Stücke für den Osten freigeben.
Insgesamt spielen in Prag zwanzig Sprechbühnen, darunter eine ganze Reihe kleiner und kleinster Theater. Zu den interessantesten gehören neben dem Nationaltheater, das im alten Ständetheater, wo Mozarts „Don Giovanni“ uraufgeführt wurde, und alternierend mit der Oper im großen Haus an der Moldau zu sehen ist, noch das „Theater der Armee", das „Burian- Theater“, das „Theater ABC“ und das „Realistische Theater". Als kabarettistisch-satirische Bühne hat das „Semafor“ besonderen Erfolg. Die Oper spielt, außer im Haus an der Moldau, täglich im Smetana-Theater, dem ehemaligen Deutschen Landestheater.
T’Xrei der augenblicklich laufenden „Bestseller" konnte ich sehen. Davon war vom Stück her am eindrucksvollsten Vratislav Blažeks satirische Komödie „Und das am Weihnachtsabend“. Man gerät in wachsendes Staunen, je weiter das Spiel sich entfaltet, denn die Kritik, die darin an den heutigen Verhältnissen geübt wird, ist klar und deutlich und vor allem aus genauester Kenntnis der Situation entstanden. Als Hauptfigur hat man einen kommunistischen Direktor vor sich, einen Manager volksdemokratischer Prägung, der nur noch in seinen Konferenzen lebt und die Realität seiner Familie und privaten Umgebung vollkommen übersieht, und das, was er sieht, nicht erkennen will- Am Weihnaę tsabend bricht diese private RSaJlfSt nun über ihn herein: rni Sohn und seine Töchter sind alles ‘‘das, was sie nach den Pa?teiideen des Vaters nicht sein bllen. Der Sohn nennt sich Gerard, trägt enge Hosen und bringt eine „Madeleine“ mit, und die Tochter einen jungen Innenarchitekten, der erklärt: „Ich habe keine positive Einstellung rum volksdemokratischen Regime. Ich habe überhaupt nichts — nur Hanka.“ Eine. schaurige Szene gibt es dann mit einem von der Tochter aus der Nachbarschaft eingeladenen ehemaligen, jetzt diffamierten Advokaten, der dem Direktor ins Gesicht schleudert: „Am 1. Mai gehe ich auf die Straße und juble, mein Gott, ich juble, wie kein Fabrikarbeiter jubelt — denn er braucht sich ja keine Sorgen zu machen, ob ihn gerade jemand sieht oder nicht. Eine Woche lang krächze ich nur, mit solcher Begeisterung pflege ich zu jubeln. .Und etwas später heißt es von einem Hochschullehrer, der seine Gesinnung ein paarmal gewechselt hat: „Es kommt nur darauf an, wo der steht, der die Feder in die Hand nimmt“, und der denkwürdige Ausspruch des Professors wird zitiert: „Wenn man es von mir verlangt hätte, wäre ich auch bereit, zu lehren, Jan Hus sei ein Rabbi gewesen.“ Die Vieldeutigkeit solcher Worte ist offenkundig. Und auch die Tatsache, daß der Direktor am Schluß des Stückes den „nihilistischen“ Zwanzigjährigen in seiner Familie aufnimmt, ihm hilft und selbst zu eigenen Gedanken kommt, liegt weitab von jedem Schematismus. Das ausgezeichnet gebaute und treffend pointierte Stück ist, wie man hört, das Werk eines durchaus überzeugten Kommunisten der jüngeren Generation. Und das gibt dem westlichen Betrachter manche Erklärung. Denn es ist leicht, einem politisch Indifferenten das Wort zu verbieten, nicht ganz so leicht aber, einem akzeptierten Kommunisten, der seine Kritik mit dem Vokabular und den Argumenten der Partei selbst ausstattet und genau -.n der Grenze einhält, die für die öffentliche Kritik eben noch zugelassen ist. Es wäre falsch, in solchen Satiren unmittelbar westliche Standpunkte erkennen zu wollen. Das Problem ist eigentlich viel schwerwiegender: Die Kritik, die Satire, kommt aus parteieigenem Lager, beherrscht souverän die offizielle Dogmatik, Methodik, Phraseologie, hat aber gleichzeitig Distanz zu ihnen und spielt mit all dem ein Spiel, das man im Sinne einer offiziell erlaubten, ja „gewünschten“ Selbstkritik nicht untersagen will. Der Erfolg des Stückes, das im „Komödien-Theater“ nicht einmal besonders gut aufgeführt wird, ist enorm.
Applausstürme ruft auch das satirische Kabarett „Solch ein Blutverlust“ von Jiri Suchy und Ji?i Slitr im „Semafor“ hervor, das sich um die durchgehende Figur eines „Halbstarken“, eines Beatnik, abspielt. Hier gab es auf der Bühne nur Jugend, treffend gezeichnete Typen, einen bärtigen Beatnik mit Fransenweste und Banjo, einen Marlon-Brando-Typ, einen beleibten Charakterkomiker, sehr an Qualtinger erinnernd, und zwei weibliche Trampfiguren mit wallender Haarmähne. Dazu viel heißen Jazz, mit Schmiß und Temperament gespielt. Der Gesamtcharakter lief ungefähr auf das Gegenteil dessen hinaus, was in der Jugendorganisation gewünscht wird. Doch kann auch hier keine Rede von „Untergrund“ sein. Man kennt diese Explosionen an offizieller Stelle genau und läßt in der Satire und im Kabarett das dringend nötige Ventil aus sehr genau überlegten Gründen bis zu einem gewissen Grad offen.
Jan Drdas „Das sündige Dorf" im „Theater der Armee“ ist ein ganz anderes Kaliber. Drda ist der offizielle Parteidichter, ein mit Ehrungen überhäufter und schwer verdienender Autor. Sein Stück ist eine überaus geschickt und vital volkstümlich verpackte atheistische Propaganda. Ein aus der Hölle gesandter Teufel verführt als Priester die Menschen eines Dorfes. Der Höllenfürst sieht mit weißem Gewand und Bart genau so aus wie die übliche Darstellung von Gottvater. Ein anderer Teufel verwandelt sich sozusagen real in einen Menschen, so daß schließlich auch der Begriff „Hölle“ aufgelöst erscheint. Das alles wird mit viel Theaterbegabung in mitunter Nestroyschen Situationen entwickelt, wirkt aber in den Tendenz derart gewollt, daß ein mehr als peinlicher Eindruck entsteht. Die kräftige Volkstümlichkeit einzelner Szenen findet freilich Resonanz.
Vielbeachtet ist ein Pantomimen-Theater, darin der Pantomime Ladislav Fialka mit seiner Truppe großen Erfolg verzeichnet. Übrigens die einzige nicht vom Staat subventionierte Bühne Prags. Im selben Haus spielt auch das „Schwarze Theater“, deshalb so genannt, weil die Tänzer in schwarzen Trikots auftreten und gegen den schwarzen Hintergrund nur mit dem Gesicht und weiß markierten Stellen sichtbar sind. — Das Nationaltheater befand sich während meines Besuches auf einmonatiger
Tournee, doch kam die mir verfügbare Zeit dafür den kleineren Bühnen zugute.
Als Aufführungen der Oper im Haus an der Moldau sah ich einen ganz unrealistisch gestalteten, ausgezeichneten „Figaro“, wobei Jaroslav Horäcek in Stimme und Temperament als der ideale Nachfolger des berühmten Wiener Figaro und Leporello Erich Kunz anzusehen wäre. Der Cherubim Ivana Mixoväs und die Gräfin Jaroslava Vymazaloväs hatten hohes Niveau, die anderen fielen freilich ab. Allerdings war die Musikalität und Lebendigkeit der ganzen Aufführung — es dirigierte Robert Brock — durchgehend überaus erfreulich. Besonders fiel Josef Svobodas stilisiertes Bühnenbild auf, das erst am Schluß „konkret“ wurde und die Szene in ein Watteau-Bild verwandelte. — Leoš Janačeks „Käfa Kabanovä" ist musikalisch von außerordentlicher Schönheit, und man kann nur bedauern, daß diese Oper in den westlichen Opernhäusern so selten aufgeführt wird. Die Inszenierung, die ich sah, stand bereits lange auf dem Spielplan, sie war konventionell, und auch die Stimmen hatten keine Qualität. Vortrefflich aber klang das Orchester unter Josef Čech, vor allem die weichen, singenden Streicher.
Sehr aufschlußreich war der Besuch im Atelier des Ausstattungschefs der Oper und des Nationaltheaters, Josef Svoboda. Der etwa vierzigjährige Bühnenbildner ist zusammen mit Alfred Radok der Erfinder der schon auf der Brüssler Weltausstellung gezeigten „Laterna Magica", einer Verbindung von Filmprojektionen und Tanztheater. Trotz des großen Erfolges des Gastspiels in London und Wien, wo der künstlerische Mut dieses Experiments mit Recht Aufsehen erregte, muß festgestellt werden, daß mit der „Laterna Magica“ zwar Ansätze eines neuen Ausdrucksmediums herauisgebildet wurden, aber noch viele weitere Schritte getan werden müßten, um zu einem voll überzeugenden Ergebnis zu kommen. Auch ist das Programm „Expo 1958“ zu sehr auf das Thema „Tschechoslowakei“ beschränkt, als daß man die ganze Breite der vielleicht möglichen
Ausdrucksskala erkennen könnte. Das Spiel zwischen den auf die Leinwand projizierten Vorgängen und Menschen, die mitunter durch die realen Modelle selbst gedoubelt werden, so daß sich etwa ein Dialog zwischen dem Filmbild der Darstellerin und ihr selbst ergibt, ist stellenweise unbedingt reizvoll. Besonders schön, wenn ein Tänzer das auf eine Leinwand geworfene Bild einer bukolischen weiblichen Erscheinung mit einer ovalen Scheibe abhebt und in pantomimischem Spiel bis an die Bühnenrampe trägt. Allerdings erweisen sich diese Überraschungen vielfach als Gags, die sich rasch verbrauchen. Sicher hat man hier eine Richtung eingeschlagen, die weiterzugehen reichlich lohnen kann. Man ist eben dabei, ein neues Programm zu gestalten, vielleicht ist es darin gelungen, das neue Ausdrucksmittel zu verallgemeinern und zu vertiefen.
Das Programm „Expo 1958" lief in Prag mit einem ausgezeichneten Vorfilm, der die Weltausstellung so mondän wie möglich zeigt, bis heute mehr als tausendmal, und ist bei hohen Preisen immer noch ausverkauft. Svoboda war übrigens der Bühnenbildner jener avantgardistischen „Zauberflöte", in der die Sänger in heutiger Kleidung auftraten und ein KZ sichtbar wurde. Es gab damals einen vielbeachteten Skandal, und der Regisseur Herlitschka ging nach dem Westen. Auch die szenische Gestaltung von Luigi Nonos „Intoleranza“ in Venedig stammte von Svoboda. Die Photos, die Svoboda zeigte — er hat eben zum zweitenmal den ersten Preis der Biennale in Sao Paulo erhalten —, liegen an der vordersten Linie des abstrakten Theaters. Ein „Troubadour" besteht nur aus Kuben und Kurven, „Hoffmanns Erzählungen“ sind am ehesten mit dem Stil Dalis zu vergleichen, ein „Hamlet" arbeitet nur mit Licht und einem besonders raffiniert verwendeten Gegenlicht, das merkwürdige Lichtvorhänge und Effekte ergibt, die dem Bayreuther Stil entfernt verwandt sind. Es besteht kein Zweifel, daß solche Bühnenbilder auch im Westen als experimentelle Spitzen gelten würden. „Und das können Sie hier machen?“ frage ich. „Nun, ich arbeite eben nicht anders. Es gibt zwar harte Diskussionen, aber es geht, wie Sie sehen.“
Die Möglichkeiten vor allem auf dem Theater — in der Malerei oder Buchliteratur ist es schon schwerer —, sind also in der CSSR nicht unerheblich. Aber man kann erst richtig urteilen, wenn man die Grenzen genau erkennt und auch alles das, was die Bedingungen dieses kulturellen Lebens von der Tagesrealität her entstehen läßt: Die Durchführung des Parteiprogramms im Alltag ist außerordentlich rigoros und ohne jede Geschmeidigkeit, die in anderen Satellitenstaaten doch gestattet, manches zu arrangieren. Die Bevölkerung ist jedoch gleichzeitig von hoher Intelligenz, althergebrachter Kultur und starkem, eigenwilligem Temperament. So also gestattet man im Theater und im kulturellen Bereich eine lizenzierte und kontrollierte Liberalität, um irgendeinen Spielraum für das Individuelle zu lassen. Man erkennt diese Notwendigkeit und plant — ein solcher Eindruck jedenfalls entsteht — die Liberalität und ihre Grenzen im kulturellen Leben nach genauen Überlegungen ebenso präzis ein wie die Ausländeruniversität, die Arbeitsbrigaden und auch die kleinste Verordnung für den Alltag.




































































































