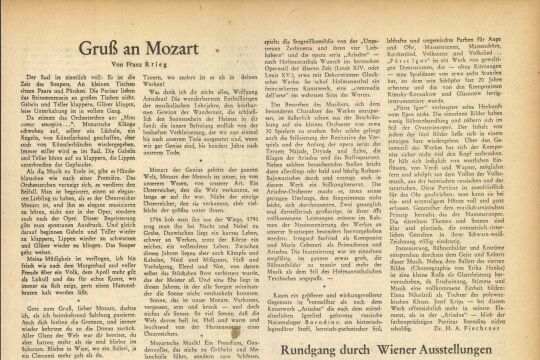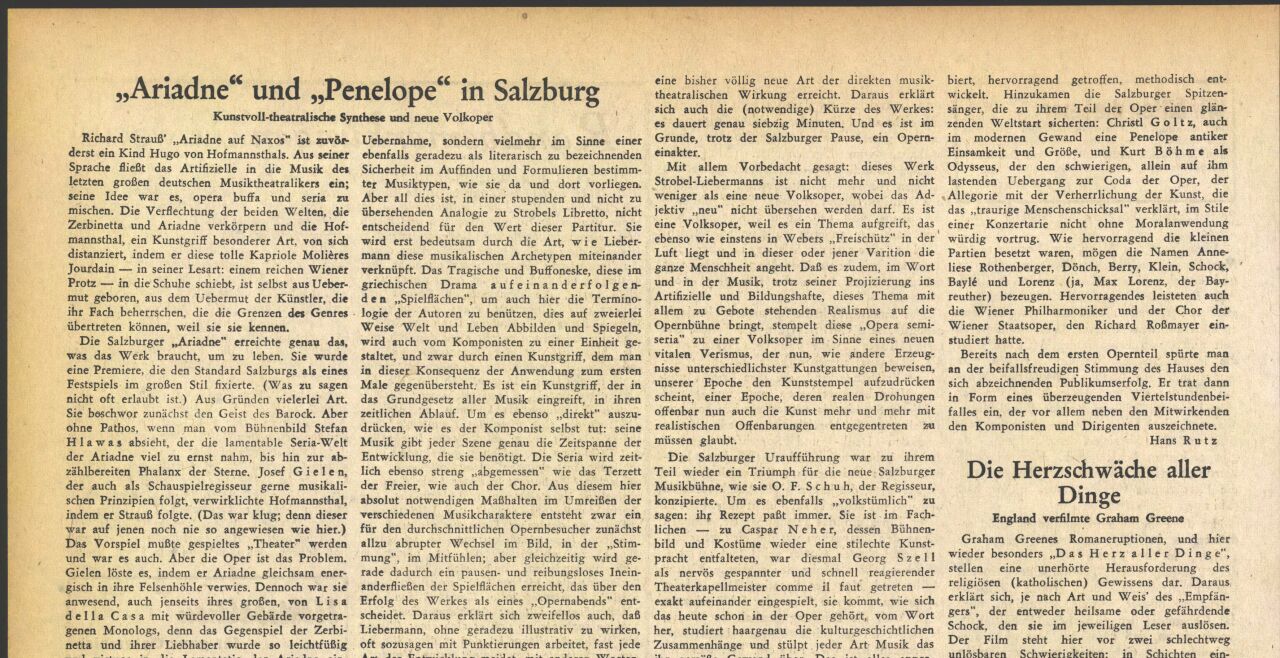
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Ariadne“ und „Penelope“ in Salzburg
Kunstvoll-theatralische Synthese und neue Volkoper
Kunstvoll-theatralische Synthese und neue Volkoper
Richard Strauß’ „Ariadne auf Naxos" ist zuvör- derst ein Kind Hugo von Hofmannsthals. Aus seiner Sprache fließt das Artifizielle in die Musik des letzten großen deutschen Musiktheatralikers ein; seine Idee war es, Opera buffa und seria zu mischen. Die Verflechtung der beiden Welten, die Zerbinetta und Ariadne verkörpern und die Hofmannsthal, ein Kunstgriff besonderer Art, von sich distanziert, indem er diese tolle Kapriole Molieres Jourdain — in seiner Lesart: einem reichen Wiener Protz — in die Schuhe schiebt, ist selbst ausUeber- mut geboren, aus dem Uebermut der Künstler, die ihr Fach beherrschen, die die Grenzen des Genres übertreten können, weil sie sie kennen.
Die Salzburger „Ariadne" erreichte genau das, was das Werk braucht, um zu leben. Sie wurde eine Premiere, die den Standard Salzburgs als eines Festspiels im großen Stil fixierte. Was zu sagen nicht oft erlaubt ist. Aus Gründen vielerlei Art. Sie beschwor zunächst den Geist des Barock. Aber ohne Pathos, wenn man vom Bühnenbild Stefan H la was absieht, der die lamentable Seria-Welt der Ariadne viel zu ernst nahm, bis hin zur abzählbereiten Phalanx der Sterne. Josef Gielen, der auch als Schauspielregisseur gerne musikalischen Prinzipien folgt, verwirklichte Hofmannsthal, indem er Strauß folgte. Das war klug; denn dieser war auf jenen noch nie so angewiesen wie hier. Das Vorspiel mußte gespieltes „Theater" werden und war es auch. Aber die Oper ist das Problem. Gielen löste es, indem er Ariadne gleichsam energisch in ihre Felsenhöhle verwies. Dennoch war sie anwesend, auch jenseits ihres großen, von Lisa della Casa mit würdevoller Gebärde vorgetragenen Monologs, denn das Gegenspiel der Zerbinetta und ihrer Liebhaber wurde so leichtfüßig und virtuos in die Lamentatio der Ariadne eingefügt, so direkt auch als Buffo-Einlage gesehen, daß gleichsam der Wunsch, Ariadnes Liebes- und Todessehnsucht bis zum hochgetürmten Quartsextakkord-Triumph zu erleben, lebendig blieb. Und genau das wollten die Autoren. Genau diesem Ziel diente auch Karl Böhm, der sich wieder als ein Meister theatralischer Musikregie zeigte, der niemals vergaß, daß Ariadne zwar eine Schwester der Elektra ist, aber nicht Chrysotemis, vielmehr Zerbinetta ihr Gegenpart. Diese war Hilde G ü d e n, die wohl den größten Triumph ihrer bisherigen Laufbahn feierte: virtuose Koloratur und dennoch von intimer Wärme in der lyrischen Kanti- lene. Zweite große musikdarstellerische Leistung dieses „perfekten" Salzburger Opernabends: Irmgard Seefried als Komponist: aus wenigen Takten erwuchs die dominierende Figur des Vorspiels. Im übrigen hervorragend ebenfalls bis vortrefflich: Schöffler als Musiklehrer, Peter Klein als Tanzmeister, Rudolf Schock als Bacchus, das Terzett Rita Streich, Hilde Rößl-Majdan und Lisa Otto, das Quartett mit Alfred Poell, August Ja- resch, Oskar Czerwenka und Murray Dickie. Stärkster Beifall, auch schon bei offener Szene. Gerade weil „Ariadne" nie eine echte Repertoireoper wird, ist sie zur Festspieloper geboren. Salzburg hat das jetzt — übrigens zum ersten Male! — überzeugend nachgewiesen.
Was keiner der Experten sämtlicher heute kursierenden musikalischen Stilarten erwarten konnte oder wollte, trat ein: die neue Oper „Penelope" des jüngsten Autorengespanns am Himmel jenes Musikgenres, das ununterbrochen totgesagt wird und noch immer lebt, erwies sich bei ihrer Uraufführung im Salzburger Festspielhaus, in dessen Parkett sich die Fachleute aus aller Welt ein Stelldichein gaben, als eine neue Volksoper. Wer vom Text Heinrich Strobels herkam und glaubte, die Oper „Penelope" mit ihrem heutzutage einzig nach gediegenem Fachwissen riechenden Untertitel „Semiseria" sei so etwas wie eine literarische Spielerei, lediglich ein Produkt bester humanistischer Bildung, sah sich im wesentlichen getäuscht. Das Entscheidende dieser Opernvorlage ist nämlich die außerordentliche Perfektion, mit der Strobel Eleusis und Moderne verknüpft hat. Trotz — zugegeben — literarisch-verzwickter und manchmal sogar leicht manierierter, ja tendenziös gefärbter Einzelszenen: das Buch ist, als Ganzes besehen, derart geschickt und nahtlos entworfen und seine Idee, das Schicksal der auf Odysseus wartenden Penelope mit einem heutigen Heimkehrerdrama im Sinne des Exemplarischen, Beispielhaften zu verbinden, kommt derart unmittelbar zur Wirkung, daß man beinahe sagen möchte: diesem Vorwurf wird jede Art Musik gerecht, sei sie nur bühnenwirksam.
Sie ist sehr direkt, diese Musik von Rolf Liebermann, ob sie nun den Hexametern des Chors, den aus der Konversation zu echter tragischer Größe emporwachsenden Monologen Penelopes oder aber den Buffonerien der drei Freier in fast minutiöser Treue folgt. Es läßt sich behaupten, daß sich da wohl die verschiedenartigsten musikalischen Charaktere gegenüberstehen, ja, daß die Gattung Oper hier zur großen dramatischen Einzelszene im Sinne Monteverdis wird, der zweifellos nicht ohne tiefere Bedeutung einmal genannt und musikalisch zitiert wird, und dort zur kabarettistischen Einlage sich zuspitzt, zumal, wenn die drei Freier sich von der antiken Spielfläche schnurstracks auf die moderne begeben, um dort als Funktionäre der Heimat die Heimkehrer zu begrüßen. Es ist richtig: das alles geschieht auch musikalisch, ungeachtet der gedanklichen Ueber- legungen, die den Komponisten geleitet haben mögen, an Hand oft geradezu greifbarer Vorlagen, wenn auch keineswegs im Sinne eklektizistischer Uebernahme, sondern vielmehr im Sinne einer ebenfalls geradezu als literarisch zu bezeichnenden Sicherheit im Auffinden und Formulieren bestimmter Musiktypen, wie sie da und dort vorliegen. Aber all dies ist, in einer stupenden und nicht zu übersehenden Analogie zu Strobels Libretto, nicht entscheidend für den Wert dieser Partitur. Sie wird erst bedeutsam durch die Art, wie Liebermann diese musikalischen Archetypen miteinander verknüpft. Das Tragische und Buffoneske, diese im griechischen Drama aufeinanderfolgenden „Spielflächen", um auch hier die Terminologie der Autoren zu benützen, dies auf zweierlei Weise Welt und Leben Abbilden und Spiegeln, wird auch vom Komponisten zu einer Einheit gestaltet, und zwar durch einen Kunstgriff, dem man in dieser Konsequenz der Anwendung zum ersten Male gegenübersteht. Es ist ein Kunstgriff, der in das Grundgesetz aller Musik eingreift, in ihren zeitlichen Ablauf. Um es ebenso „direkt" auszudrücken, wie es der Komponist selbst tut: seine Musik gibt jeder Szene genau die Zeitspanne der Entwicklung, die sie benötigt. Die Seria wird zeitlich ebenso streng „abgemessen" wie das Terzett der Freier, wie auch der Chor. Aus diesem hier absolut notwendigen Maßhalten im Umreißen der verschiedenen Musikcharaktere entsteht zwar ein für den durchschnittlichen Opernbesucher zunächst allzu abrupter Wechsel im Bild, in der „Stimmung", im Mitfühlen; aber gleichzeitig wird gerade dadurch ein pausen- und reibungsloses Ineinanderfließen der Spielflächen erreicht, das über den Erfolg des Werkes als eines „Opernabends" entscheidet. Daraus erklärt sich zweifellos auch, daß Liebermann, ohne geradezu illustrativ zu wirken, oft sozusagen mit Punktierungen arbeitet, fast jede Art der Entwicklung meidet, mit anderen Worten, eine bisher völlig neue Art der direkten musiktheatralischen Wirkung erreicht. Daraus erklärt sich auch die notwendige Kürze des Werkes: es dauert genau siebzig Minuten. Und es ist im Grunde, trotz der Salzburger Pause, ein Operneinakter.
Mit allem Vorbedacht gesagt: dieses Werk Strobel-Liebermanns ist nicht mehr und nicht weniger als eine neue Volksoper, wobei das Adjektiv „neu" nicht übersehen werden darf. Es ist eine Volksoper, weil es ein Thema aufgreift, das ebenso wie einstens in Webers „Freischütz" in der Luft liegt und in dieser oder jener Varition die ganze Menschheit angeht. Daß es zudem, im Wort und in der Musik, trotz seiner Projizierung ins Artifizielle und Bildungshafte, dieses Thema mit allem zu Gebote stehenden Realismus auf die Opernbühne bringt, stempelt diese „Opera semiseria" zu einer Volksoper im Sinne eines neuen vitalen Verismus, der nun, wie andere Erzeugnisse unterschiedlichster Kunstgattungen beweisen, unserer Epoche den Kunststempel aufzudrücken scheint, einer Epoche, deren realen Drohungen offenbar nun auch die Kunst mehr und mehr mit realistischen Offenbarungen entgegentreten zu müssen glaubt.
Die Salzburger Uraufführung war zu ihrem Teil wieder ein Triumph für die neue Salzburger Musikbühne, wie sie O. F. Schuh, der Regisseur, konzipierte. Um es ebenfalls „volkstümlich" zu sagen: ihr Rezept paßt immer. Sie ist im Fachlichen — zu Caspar N e h e r, dessen Bühnenbild und Kostüme wieder eine stilechte Kunstpracht entfalteten, war diesmal Georg S z e 1 1 als nervös gespannter und schnell reagierender Theaterkapellmeister comme il faut getreten — exakt aufeinander eingespielt, sie kommt, wie sich das heute schon in der Oper gehört, vom Wort her, studiert haargenau die kulturgeschichtlichen Zusammenhänge und stülpt jeder Art Musik das ihr gemäße Gewand über. Das ist alles appro-biert, hervorragend getroffen, methodisch entwickelt. Hinzukamen die Salzburger Spitzensänger, die zu ihrem Teil der Oper einen glänzenden Weltstart sicherten: Christi Goltz, auch im modernen Gewand eine Penelope antiker Einsamkeit und Größe, und Kurt Böhme als Odysseus, der den schwierigen, allein auf ihm lastenden Uebergang zur Coda der Oper, der Allegorie mit der Verherrlichung der Kunst, die das „traurige Menschenschicksal" verklärt, im Stile einer Konzertarie nicht ohne Moralanwendung würdig vortrug. Wie hervorragend die kleinen Partien besetzt waren, mögen die Namen Anneliese Rothenberger, Dönch, Berry, Klein, Schock, Bayl6 und Lorenz ja, Max Lorenz, der Bayreuther bezeugen. Hervorragendes leisteten auch die Wiener Philharmoniker und der Chor der Wiener Staatsoper, den Richard Roßmayer einstudiert hatte.
Bereits nach dem ersten Opernteil spürte man an der beifallsfreudigen Stimmung des Hauses den sich abzeichnenden Publikumserfolg. Er trat dann in Form eines überzeugenden Viertelstundenbeifalles ein, der vor allem neben den Mitwirkenden den Komponisten und Dirigenten auszeichnete.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!