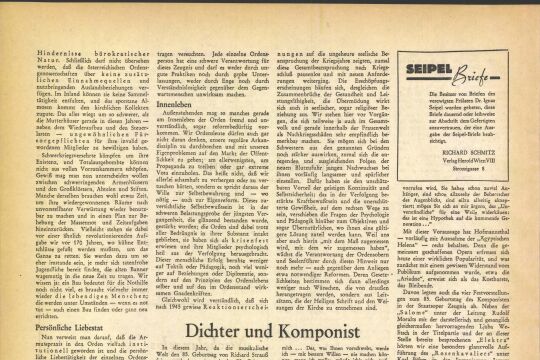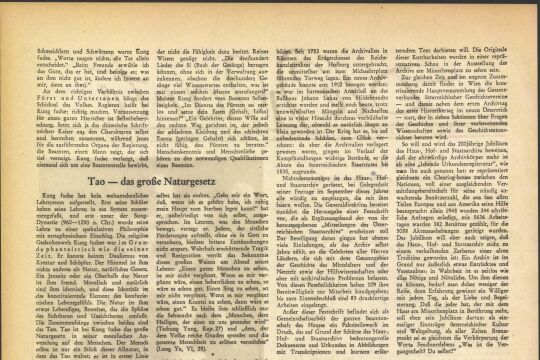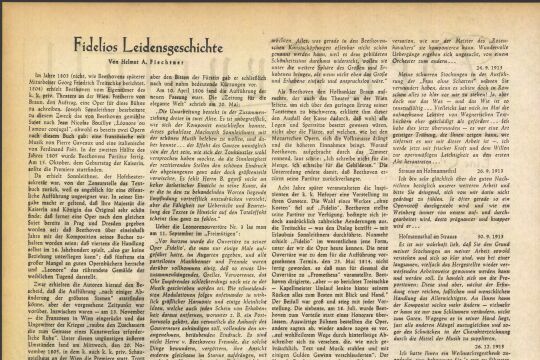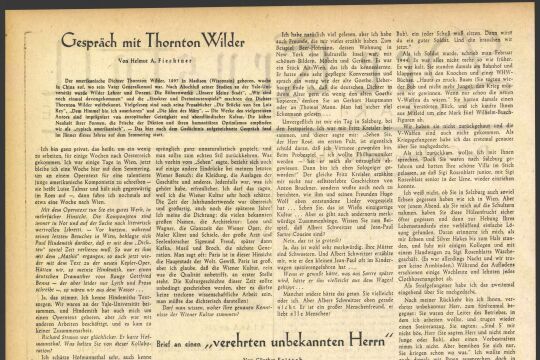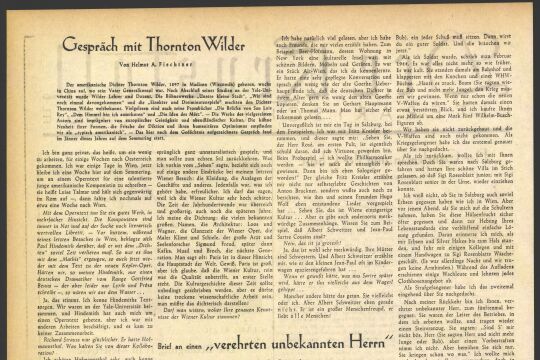„Sind diese Menschen Botokuden?“
Wieder, wie im vorigen Jahr, steht die Märchen- und Zauberoper „Die Frau ohne Schatten“ von Hofmannsthal und Strauss auf dem Programm der Salzburger Festspiele und hat, sowohl was Werk wie Wiedergabe betrifft, den künstlerischen Höhepunkt des Festivals 1975 markiert. Und zwar genau in jener Bedeutung, die der große deutsche Gelehrte in seiner Eröffnungsansprache als wirklich „festspielwürdig“ hervorgehoben hat. — Auch ist ja den beiden mit Salzburg so eng verbundenen Künstlern mit „Die Frau ohne Schatten“ ihr Opus magnum gelungen...
Wieder, wie im vorigen Jahr, steht die Märchen- und Zauberoper „Die Frau ohne Schatten“ von Hofmannsthal und Strauss auf dem Programm der Salzburger Festspiele und hat, sowohl was Werk wie Wiedergabe betrifft, den künstlerischen Höhepunkt des Festivals 1975 markiert. Und zwar genau in jener Bedeutung, die der große deutsche Gelehrte in seiner Eröffnungsansprache als wirklich „festspielwürdig“ hervorgehoben hat. — Auch ist ja den beiden mit Salzburg so eng verbundenen Künstlern mit „Die Frau ohne Schatten“ ihr Opus magnum gelungen...
Insgesamt zehn Werke haben sie gemeinsam geschaffen, und ihre Kollaboration, die sich vom Jahr 1906 (erster Brief über „Elektra“) bis zum Juli 1929 (dem Todesmonat Hofmannsthals) erstreckte, ist die längste und intensivste, die die Operngeschichte kennt, i—- Aber war diese Künstlerehe auch eine glückliche? Die Frage ist oft gestellt und verschieden beantwortet worden. Wir wollen sie heute nicht erneut in ihrer ganzen Breite aufrollen (denn es wäre wirklich viel, sehr viel Positives und Negatives, Offenkundiges wie Hintergründiges betreffend, dazu zu sagen), sondern nur auf einige Teilaspekte hinweisen.
Ohne Zweifel war — wie aus der nunmehr vollständig veröffentlichten umfassenden Korrespondenz hervorgeht — der zehn Jahre jüngere Hofmannsthal durchaus derjenige, der in Fragen des Stils,' des Geschmacks „führte“ und der auch sämtliche Sujets bestimmte. (Die gelegentlich von Strauss vorgeschlagenen versetzen den Leser von heute in einen Zustand grimmiger Heiterkeit und wurden von Hofmannsthal ebenso dezidiert wie höflich abgelehnt). Strauss hingegen, das darf nie vergessen und unterschätzt werden, war nicht nur der größere Routinier und Bühnenpraktiker, sondern auch die ursprünglichere dramatische Begabung. Und es ist sein Verdienst, daß von den gemeinsam geschaffenen Werken mindestens vier leben. Und dies seit einem halben Jahrhundert und länger. Daran sollte man sich, trotz aller möglichen kritischen Einwände im einzelnen, vor allem halten.
So verschiedenartig die beiden Partner waren: jeder erkannte und respektierte den Rang des anderen. Dies vorausgesetzt, mögen nun einige kritische Marginalien folgen. In der Retrospektive will es uns so erscheinen, als hätte Strauss vor allem von dieser Zusammenarbeit profitiert — obwohl, wie bereits angedeutet, Hofmannsthal das Überleben einiger seiner Werke dem Opernkomponisten verdankt. Aber hier kommen wir zugleich auch zum kritischesten Punkt: zum Verhältnis zwischen Wort und Ton, Text und Musik. Denn Hofmannsthals Operntexte sind keineswegs nur „Libretti“, sondern sie sind Dichtungen — freilich so konzipiert und ausgeführt (mit Ausnahme der „Elektra“, die, 1903 geschrieben, auch als Sprechstück einen sensationellen Erfolg hatte), daß sie für Musik „durchlässig“ waren und dem Komponisten genügend Spielraum ließen.
Diese „Libretti“ wollen freilich nicht nur ihrem Inhalt nach „verstanden“, sondern Zeile für Zeile auch als Dichtung gewertet und gewürdigt sein. Doch damit ist es in der Praxis schlecht bestellt, so schlecht, daß ein kritischer Geist vom Rang eines Thomas Mann (der Hofmannsithals Situation genau kannte) diesen bereits nach dem „Rosenkavalier“ fragte, wie er es dulden könne, daß seine zauberhaften, lyrischen und witzigen Texte dermaßen von dem riesigen Strauss-Orchester zugedeckt würden, so daß man auf weite Strecken kaum einen Satz vollständig verstünde. Um diese Schwierigkeit, um diesen für den Dichter geradezu fatalen Sachverhalt wußte auch Hofmannsthal — und hat ein halbes Leben lang für seine Verse gekämpft. Vergeblich. Und wer ihn einigermaßen kennt, weiß, daß dies nicht aus Künstlereitelkeit geschah („Alles Persönliche ist mir ein Greuel“; das war bei ihm keine Phrase), sondern im Interesse des Gesamtkunstwerks, das beide zu realisieren bestrebt waren. (Freilich in einem ganz anderen Sinn als Wagner dies kurz vorher demonstriert hatte.)
Daß es auch anders ging, hörte Hofmannsthal, der nicht gerade als Opernfan bezeichnet werden kann, der aber sehr aufmerksam aufnahm, in anderen Werken. Wie mag er die Librettisten von Verdi und Puccini beneidet haben, die Mozarts vor allem,, aber auch Wagner als Autor seiner eigenen Dichtungen?
Ganz konkret spricht H. v. H. einmal in einem Brief vom 22. April 1922 über dies Problem, als er mit-, ten in der Arbeit am Textbuch zur „Frau ohne Schatten“ steckte und jetzt schon für dieses Werk fürchtete. „Ich hörte unlängst eine Oper hier, von einem bisher Unbekannten, Franz Schmidt. Das Merkwürdige an der Oper von Schmidt, weshalb ich hier davon spreche, war mir dies, daß ich beim ersten Hören fast alles von dem (übrigens absurden) Text verstand, und doch war es keine dünne melodramatische Musik — aber wenn die Singstimme vorwiegen sollte, war alles andere so zurücktretend, und ich — ich kann mir nicht helfen —, ich hatte einen sehr schönen Eindruck davon, trotzdem der Text, wie gesagt, albern war. Ich sage dies nicht um meines Textes willen, so weit kennen Sie mich ja jetzt schon, sondern ich will in ganz inkompetenter Weise damit sagen, daß es doch Möglichkeiten geben muß, manchmal das Wort absolut vorwalten zu lassen, und daß mir viel gewonnen schiene, wenn dies auf Ihrem Wege läge, diesmal.“ — Drei Tage später antwortete Strauss aus Garmisch: „Besten Dank für gestrigen Brief und bin ganz Ihrer Meinung, werde mein Äußerstes tun, um die Dichtung verständlich werden zu lassen und streiche Ihnen sicher nichts Wesentliches.“
Hier haben wir wieder ein Beispiel jener typischen Mißverständnisse, von denen es in dieser Korrespondenz wimmelt. Denn es ging ja um etwas ganz anderes als um die etwaige Streichung einzelner Verse, sondern um den Strauss'schen Kom-positionsstil, seine Instrumentierung, den vielzitierten „Nervenkontrapunkt“: sehr reizvoll in Straussens symphonischen Dichtungen und Orchesterzwischenspielen, aber eine Kalamität, sobald das Orchester nur begleitende Funktion haben soll. Viel früher schon hatte Hofmannsthal seinen Mitarbeiter auf diese Gefahr aufmerksam gemacht und von dem „Zuviel an Musik“ gesprochen, worin der Text und jeder Sinn ertrinkt. „Wenn es gelänge, sich dem gelehrten deutschen Musikgeist zu entwinden, jenem Etwas, das zuviel ist im deutschen Musikwesen ..., ja wenn man als ganz reifer Meister ein wenig über seinen eigenen Schatten, seines deutschen 19. Jahrhunderts Schatten springen könnte...“ Aber eben dieses vermochte Strauss nicht. In „Ariadne“ hat er es versucht, in „Capriccio“, schon nach Hofmannsthals Tod, ist es ihm vielleicht gelungen, aber über „Danae“, die Thomas Mann im August 1952 in Salzburg sah, schrieb er an den befreundeten Bühnenbildner Emil Preetorius: „Ein so recht glückliches Werk is es nicht... und wird sich kaum die Welt erobern. Gregor hat schlecht gedichtet, und Hofmannsthal würde hastig auf seine Nägel blicken. In der Musik natürlich viel Schönes und Reizendes, aber zuviel Pauke, zuviel Pomp und Leere doch auch.“
Dies freilich kann man, was „Die Frau ohne Schatten“ betrifft, nicht behaupten: ■ es ist nicht nur die reichste, prunkvollste und vielschichtigste, sondern auch die differenzierteste Partitur von Strauss. Aber was die Verständlichkeit des Textes betrifft bzw. seine Unver-ständlichkeit, so behielt Hof manns-thal leider recht. Dabei kam, zunächst einmal bei der Fachkritik, das ganze Textbuch unter die Räder, und zwar auf eine so fatale Art, daß die ganze Oper in Verruf geriet und eigentlich erst nach 1945 rehabilitiert wurde. Zumindest was die Musik betrifft. Ihr wird derzeit von der Kritik enthusiastisch gehuldigt, und auch das Publikum beginnt, sie zu schätzen, trotz ihrer stellenweise enormen Kompliziertheit... Aber das Libretto, diese gehalt- und phantasievolle Dichtung Hofmannsthals ... Hier werden mit der Monotonie tibetanischer Gebetsmühlen immer die gleichen Schlagworte wiederholt, auch von Leuten, denen man mehr Einsicht und Gründlichkeit zutraut. — Dies Libretto ist nach Meinung der meisten Kritiker unverständlich, symbolüberfrachtet, schwülstig, voller unklarer Bilder und Figuren. Aber — unser Haupteinwand: wie kann man als unverständlich bezeichnen, was man nie gehört hat? Denn wer studiert heute schon ein Textbuch, zumal ein so umfangreiches und „poetisches“? Oder wer macht sich die Mühe, in dem bereits in mehreren Auflagen erschienen Briefwechsel zwischen Dichter und Komponist ein wenig nachzulesen? Dem nämlich würde alles klar, und er hätte als Besucher einer Aufführung der „Frau ohne Schatten“ den doppelten Genuß und Gewinn.
Aber es kam noch schlimmer. Schon während der Arbeit an der letzten Oper, deren Uraufführung Hofmannsthal erlebte — es war „Die Ägyptische Helena“, die am 6. Juni 1928 in Dresden uraufgeführt wurde — kamen beiden, dem Dichter und dem Komponisten, Bedenken, ob dies Werk, an dem sie fast fünf Jahre lang gearbeitet hatten, dem zeitgenössischen Publikum zugemutet werden könnte. Genauer: Ob denn überhaupt noch mit irgendwelchen Rudimenten von klassischer Bildung gerechnet werden kann, mit einer gewissen Kenntnis der griechischen Götter- und Heldenwelt, zu der die schöne Helena gehört. Und da entringt sich Hofmannsthal der Stoßseufzer: „Sind denn diese Menschen solche Botokuden?! Irgendeine Art Bildung muß man doch voraussetzen!“ (Brief vom 30. April 1928). Nun suchen beide nach Mitteln und Wegen, wie den zu erwartenden Verrissen des Textes — und der damit verbundenen Schädigung der ganzen Oper — vorzubeugen sei. Strauss drückte sich drastischer aus und sprach von „böswilligen Schafsköpfen“, denen man irgendwie vorher erklären müsse, worum es sich handelt, damit sie nicht wieder so einen verdammten Unsinn schrieben. Es ging nämlich um die Zaubertränke — auch heute noch ein beliebtes Witzobjekt der Kritik. Strauss hält es für nötig, „der Bande zu sagen“, daß man sich dies Motiv nicht aus den Fingern gesogen habe, sondern daß es einen Vergessenheitstrank bereits im vierten Gesang der Odyssee gegeben hat, daß sowohl der Vergessenheits- wie der Liebestrank in „Tristan“ keine Erfindung Richard Wagners seien, sondern spätestens schon im Epos Meister Gottfried von Straßburgs zu finden sind.
Wie die beiden nun nach Mitteln suchten, Presse und Publikum vor der Premiere zu informieren, das wiederlegt die These, daß Strauss nur widerwillig — oder aus Gewohnheit — Hofmannsthals allzu komplizierte, anspruchsvolle und „unverständliche“ Libretti komponierte. Auch Strauss war ein Künstler von hoher Allgemeinbildung, besonders was die Humaniora betrifft. Er hat zum Beispiel die 45bändige Propyläen-Gesamtausgabe der Werke Goethes zweimal von A bis Z durchgelesen und sagte einmal später im Rückblick auf seine Gymnasialzeit: „Lieber mehr Homer und Ovid in dieser Zeit als allzuviel Musik!“ (Dabei sind viele seiner Schulhefte mit Notenskizzen, Themen und Akkordketten geziert!)
Er verstand also die Sorgen seines Partners und dessen Furcht vor der Unbildung der „Botokuden“. So hat er denn auch einen Vorschlag Hofmannsthals, der auf den ersten Blick absurd und theaterfremd erscheint, mit allen Kräften unterstützt: „Die Ägyptische Helena“ bei halberleuchtetem Haus spielen zu lassen. Nachdem Maschinenmeister, Bühnenbildner und Regisseur dem zugestimmt hatten, machte der alte Praktiker und Routinier Strauss weitere detaillierte Pläne, wie dem Publikum und der notorisch bösartigen Presse diese ungewöhnliche Maßnahme plausibel zu machen sei: Der Zweck war nämlich, daß das Publikum bei halberleuchtetem Haus den Text wenigstens an den wichtigsten Stellen nachlesen könne. Dieser Gedanke sollte durch einige Leserbriefe von „Musikfreunden“ sowohl an die Theaterdirektion wie auch an die Dresdener ' und die Münchener „Neuesten Nachrichten“ herangetragen und dem Abendprogramm ein Zettel beigelegt werden, etwa folgenden Inhalts (ähnlich oder gleichlautend mit einem „leicht humoristischen“ Artikel, den Hofmannsthal für die Zeitungen schreiben sollte): Wozu schreibt ein Poet schöne Gedanken in schönen Versen, wenn sie niemand liest und man sie von der Bühne nur teilweise versteht? Es seien dann billige Beleidigungen, den Dichter dunkel und verworren zu nennen, wenn niemand Gelegenheit hat, seinen Text kennenzulernen. Er könne, schrieb Strauss an Hofmannsthal, ja noch hinzufügen, sein braver Komponist gäbe sich ja alle Mühe, einen möglichst durchsichtigen Orchesterpart zu schreiben, aber eine Oper sei , eben nun einmal kein Schauspiel, und bei der vielfältigen Inanspruchnahme von Auge und Ohr käme der Dichter sehr leicht zu kurz und bittet: wenn jemand sich nun schon einmal ein Billet für die Oper gekauft hat, so möge er noch die eine Mark für das Textbuch drauflegen, um später aus Unkenntnis des Werkes keine unberechtigten Vorwürfe zu machen. Dieser kleine Artikel, meinte Strauss, könnte etwa den Titel tragen „Der verdunkelte Dichter“...