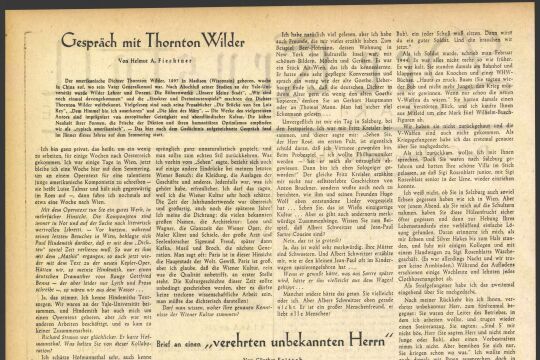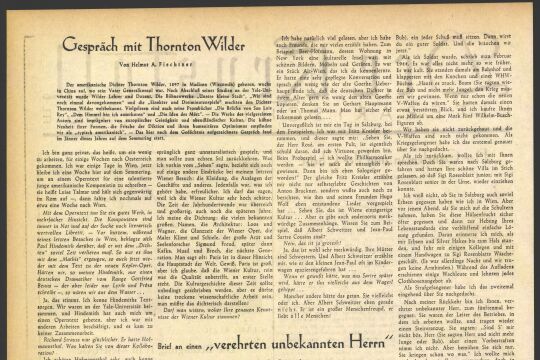Am vergangenen Donnerstag fand In der Wiener Staatsoper die Premiere der „Frau ohne Schatten“ statt. Und zwar als Festaufführung, worüber man im Programmheft der Staatsoper las: „Der 100. Geburtstag des Meisters Richard Strauss wird von der gesamten musikliebenden Menschheit als Gedenktag einer Sternstunde gefeiert. Nur wenige Größen der Musik durften schon zu Lebzeiten sicher sein, daß ihr Werk ihr irdisches Leben überdauern wird: Richard Strauss war unter ihnen sichtbar mit der Corona des Genies ausgezeichnet.“
Schöne, nicht nur „goldene“, sondern auch würdige Worte, die den besonderen Charakter dieser Gedenkfeier kennzeichnen. Wir erinnern uns auch, daß gerade dieses Werk von Hofmannsthal und Strauss während der schweren und sorgenvollen Jahre des ersten Weltkrieges geschaffen wurde, daß es entstanden ist, während Hofmannsthal zunächst als Leutnant in Istrien, später im Kriegspresse-quartier und während der letzten Kriegsjahre in wichtiger Auslandsmission für sein Vaterland Dienst tat. Wir erinnerten uns der Worte von Richard Strauss an seinen Librettisten: „Jedenfalls haben Sie noch nichts Schöneres in Ihrem Leben gedichtet, und ich rechne es mir zum Verdienst, Sie durch unsere gemeinsame Arbeit dazu gebracht zu haben. Hoffentlich wird meine Musik Ihrer schönen Dichtung würdig ...“
Wir gedachten an diesem Abend auch der besonders engen, durch ein ganzes langes Menschenleben bestehenden ununterbrochenen Beziehungen Richard Strauss' zu Wien, zu den Wiener Philharmonikern und speziell zur Wiener Staatsoper, wo die „Frau ohne Schatten“ im Hungerjahr 1919 unter Franz Schalk uraufgeführt wurde — Beziehungen, die eine umfangreiche und imposante Ausstellung in den Prunkräumen der österreichischen Nationalbibliothek dokumentiert.
Wir gedachten. Und gedachten, Strauss und Hofmannsthal zu feiern. Aber wer wurde mit Lärm und Geschrei gefeiert? Karajan! Und zwar noch bevor er den Taktstock hob, bevor ein Ton von Richard Strauss, bevor ein Wort von Hofmannsthal erklungen war.
Schon nach dem zweiten Akt war, Infolge der unwürdigen, lärmenden Demonstrationen, jede Feierstimmung entschwunden. Man fühlte sich wie in der Arena. — Aber dann, vor Beginn des letzten Aktes, kam das Ärgste: In die Stille des großen Hauses rief eine junge Frauen- oder Mädchenstimme: „Karajan muß bleiben!“ Und zwar keineswegs in spontaner Begeisterung, sondern lautstark zwar, aber wohlgezielt und in schönstem Burgtheaterdeutsch. — Daß der Herr Bundeskanzler im Hause war, genierte die impertinente Gans und ihre Komplicen ebensowenig wie die Anwesenheit von Mitgliedern der Familien Strauss und Hofmannsthal.
Wir können und wollen es nicht glauben, daß solche Praktiken die Zustimmung Karajans haben. Einfach deshalb nicht, weil wir ihn als Künstler zu hoch schätzen und weil er selbst wissen muß, daß eine Leistung wie die der neuinszenierten „Frau ohne Schatten“, in die er so viel Zeit, Kraft und künstlerische Intelligenz investiert hat, durch solche „Kundgebungen“ abgewertet wird. Es wäre auch in seinem Interesse, wenn den allzu eifrigen unter seinen Parteigängern, Freunden und Satelliten ein Dämpfer aufgesetzt würde. Denn diese inferiore Art der Reklame hat er wirklich nicht nötig.
„Karajan muß bleiben!“ Es ist klar, wem dieser Ruf, der eine neuerliche Schreiorgie auslöste, galt. Aber er war an die falsche Adresse gerichtet. Unmittelbar nämlich nach Karajans Demission am 8. Mai (zu der ihn niemand gezwungen hatte) begann Unterrichtsminister Doktor Piffl-Percevic Verhandlungen über Karajans weitere Tätigkeit als Dirigent und Regisseur an der Wiener Staatsoper. Gleichzeitig wurde Karajan ein Angebot gemacht, das ihm als Dirigenten und Regisseur die volle freie künstlerische Entfaltung hinsichtlich Werk, Zeit und Sachaufwand zusichert und vorsieht, daß ein Herr seines Vertrauens mit allen Vollmachten, die zur Gewährung der künstlerischen Tätigkeit erforderlich sind, betraut wird. Hierüber dauern die Verhandlungen noch an.
Mit diesen wahrhaft großzügigen Konzessionen ist Dr. Piffl-Percevic der Forderung Karajans auf Entlassung seines Kodirektors, Dr. Hilbert, begegnet. Eine Zumutung, die eine Wiener Tageszeitung hart, aber treffend mit der Schlagzeile umschrieb: „Karajan fordert den Kopf Hilberts“ — und die vom Leiter unserer obersten Kulturbehörde selbstverständlich abgelehnt werden mußte. „Karajan fordert den Kopf Hilberts“ — warum eigentlich? Wieso? Mit welchem Recht und aus welchen Gründen? Darüber wüßte man gern Genaueres. Denn die Nichtrespektierung eines seiner Termine durch den Kodirektor, aus welchen Gründen immer, ist doch wohl kein zulänglicher Anlaß und erscheint dem neutralen Betrachter als eine causa minima, verglichen mit all dem, was der Kodirektor Dr. Hilbert während der letzten Wochen und Monate von seinem Partner einstecken mußte. Es handelt sich hierbei offensichtlich weniger um eine ungeduldige und unduldsame Momentanreaktion als um die Realisierung eines totalen Machtanspruchs des Ex-Direktors.
Und damit sind wir beim Kern des Problems.
Es scheint sich nämlich im Kopf Herrn von Karajans die Vorstellung fixiert zu haben, die Wiener Staatsoper gehöre ihm, oder, um es konzilianter auszudrücken: Er und die Wiener Staatsoper seien identisch. Solche Identifikationen des Künstlers mit dem von ihm Geschaffenen oder Erarbeiteten haben natürlich auch ihre positiven Aspekte. Es kommt nur darauf an, ob das, was geleistet wird, ad majorem domus gloriam oder vor allem zur Vergrößerung des eigenen Ruhmes geschieht. Hier war eine Quelle echter, durchaus zu berücksichtigender und auch zu respektierender Konfliktsituationen: zwischen dem Künstler, der nur seine eigene Arbeit, zum Beispiel die nächste Neuinszenierung, im Auge hat, und dem Direktor, dessen vornehmste und wichtigste Aufgabe es sein muß, für das Wohl des Ganzen zu sorgen und in diesem Sinn zu wirken. (Wir haben diese Situation in dem Querschnitt „Dirigent oder Direktor“ in Nummer 23 der „Furche“ glossiert.)
Aber — ob Dirigent oder Direktor: Karajans Stellung an der Wiener Staatsoper ist einzigartig. In den „Salzburger Nachrichten“ vom vergangenen Sonntag wurde das folgendermaßen formuliert:
„Mit Fug und Recht darf behauptet werden, daß in der gesamten österreichischen Musikgeschichte der Entfaltung einer Künstlerpersönlichkeit nie so viel Spielraum und geradezu maßloses Entgegenkommen zugestanden wurde.“
Weiß das Herr von Karajan? Wenn nicht, so muß man ihn daran erinnern.
Doch es ist Zeit, auch von der Wiener Staatsoper zu sprechen. Sie ist ein nationales Institut mit einer großen Vergangenheit. Es hat sie schon vor der Ära Karajan gegeben, und sie wird noch existieren, wenn uns allen kein Zahn mehr weh tut. Sie besitzt immer noch ein reiches Ensemble, dem nur zwei Dinge fehlen: die ständige Betreuung und ein gutes Arbeitsklima. Bei aller Großzügigkeit, mit der an einem so repräsentativen Kunstinstitut disponiert werden darf, ist darauf zu achten, daß die erfreulich hohen Subventionen wenn nicht sparsam, so doch zumindest zweckmäßig eingesetzt werden. Die Wiener Staatsoper ist kein Tummelplatz der Mittelmäßigkeit und nicht das ausführende Organ irgendwelcher Verwaltungsbürokratien. (Deshalb sind wir für Karajans gelegentliche kostspielige Opernfeste.) Sie ist aber als Hintergrundfolie für einen persönlichen Ehrgeiz und Machtanspruch zu schade, und sie eignet sich nicht als Arena für die Austragung von Machtkämpfen.
Ihre personelle Leitung ist wichtig, aber keineswegs von solcher Bedeutung, wie viele Leute glauben oder uns glauben machen. Wichtiger scheint uns der Geist, die Gesinnung, in der ein solches Haus geführt wird. Die Wiener Staatsoper war einstmals groß als Ensembletheater. Man wagt das Wort heute kaum mehr auszusprechen oder hinzuschreiben; sosehr ist es durch jene diskreditiert worden, die kein Interesse mehr an ihm. sondern sehr andere, leicht durchschaubare Geschäfte im Auge haben. Hört man intelligente und verantwortungsbewußte Künstler, so klingt es oft ganz anders, als es uns die „Fachleute“ weismachen wollen. Wir stehen mit solchen Anschauungen nicht allein da. Hören wir deshalb als kompetenten und unverdächtigen Zeugen den ebenso klugen wie erfolgreichen Generalintendanten der Städtischen Oper Hamburg, den Komponisten Rolf Liebermann, der im Vorwort zu einem soeben erschienenen Buch („Oper der Welt“) schreibt:
„Ich bin ganz besonders betroffen von einer weitherum konformistisch akklamierten Konzeption, nach, der ein paar weltberühmte Standardwerke mit reisenden Spitzensängern aufgeführt werden sollen, und von der so forsch wie oberflächlich behauptet wird, sie sei der einzig mögliche zeitgemäße Ausweg aus der ,Ensemblekrise'. Gerade der umgekehrte Weg scheint mir der einzig mögliche: Der Alltag des Theaters muß sich auf ein Ensemble stützen, wenn der Spielplan ein Gesicht haben soll. Allerdings verlangt dieses Ensemble Pflege und Förderung, mit ihm müssen qualifizierte musikalische und regieliche Kräfte arbeiten und aus den zweiten Kräften erste und aus den ersten Weltstars machen. Niemand behaupte, es gebe keine begabten Nachwuchssänger. Wenn man sich natürlich nicht die Mühe nimmt, sie anzuhören und auf Jahre an das Haus zu binden, sondern wenn man diese Auswahl der Schallplattenindustrie vberl&ßi, und einem Sänger das Prädikat erstrangig' erst dann zuspricht, wenn er bei der Deutschen Grammophongesellschaft oder bei der Decca und Columbia herausgebracht wurde, dann gibt man einem ehrwürdigen Kulturinstitut, das jahrhundertalte Tradition mit heutigen Anliegen zu verbinden hat, den Todesstoß.
Selbst weltanschaulich oder gar konfessionell gebundene Institutionen geben den Stimmen Andersdenkender Raum, in der klaren Erkenntnis, daß Demokratie ohne Erziehung zur Demokratie nicht denkbar ist. Einen Spielplan so aufzubauen, daß er mannigfaltigen Epochen der Geschichte Material zur Unterscheidung liefert, scheint mir auch im Theaterleben das im eigentlichen Sinn demokratische Verfahren. — Über alledem sollte aber niemals der aristokratische Charakter jeder Kunst und jeder Kunstübung vergessen werden, denn Kunst wird nicht nur durch Mehrheitsbeschlüsse geschaffen. Wie eng sich aber gerade im Theater Demokratie und Aristokratie berühren, mag klar werden, wenn ich zu den Pflichten des Intendanten auch die der Unterrichtung des Publikums zähle. Es hieße, sich schlicht einem Diktat der Masse beugen, wenn wir der Minderheit das vorenthielten, was die Mehrheit ■nicht sehen will. (Die Pflicht zur Unterrichtung bleibt ja gerade auch der konservativen Mehrheit gegenüber bestehen.) Andernfalls ziehen wir uns auf den bequemen Standpunkt des gehobenen Vergnügungsbetriebes zurück und merzen auch die letzten Reste pädagogischer Verantwortung aus dem Intendantenberuf aus...“
Von diesen Aufgaben einer Operndirektion war während der letzten Monate und Jahre so gut wie überhaupt nicht die Rede. Sie erscheinen uns aber wichtiger als heftig diskutierte Besetzungsfragen, ja als Direktionskrisen, die kunstvoll zu Staatsaffären hinaufgespielt werden. Hierüber — über das geistige Profil der Wiener Staatsoper, als des zentralen Kunstinstituts zwischen Nord und Süd, Ost und West — soll ein andermal ausführlich an dieser Stelle gesprochen werden.