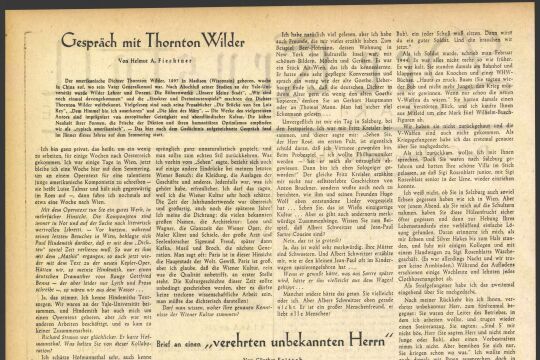„Wären wir weniger schwierig gewesen...“
Vom 17. bis 26. November 1952 weilte Thomas Mann zum letzten Mal in Wien. — Es war, seit seinem ersten Besuch in unserer Stadt im Jahr 1896, der zwölfte. Jene erste Reise hatte er unternommen, als ihm ein kleines Legat von 200 Mark zugefallen war, die er hier „zu verprassen“ gedachte, was ihm auch innerhalb von vier Tagen gelang. Das nächste Mal, 1908, besuchte er Arthur Schnitzler und traf auf dem Semmering Jakob Wassermann und Hofmannsthal. Im Jahr darauf wurde im Akademietheater sein (einziges) Theaterstück „Fiorenza“ aufgeführt, und er war davon entzückt. 1923 kam er zu einem Vortrag und besuchte zum ersten Mal Hofmannsthal in Bodaun. Bs folgten dann, 1925, „vier Pesttage in Wien“, vom 8. bis 11. Juni, mit PEN-Veranstaltungen und seinem Vortrag über „Natur und Nation“. Seither gab es, im Abstand von 1 bis 3 Jahren, immer wieder Vorträge oder Vorlesungen. Die wichtigsten waren Thomas Manns großer Bichard-Wagner-Vortrag im Jahr 1935, der die Münchener Hetzkampagne ausgelöst hatte und der unmittelbare Anlaß seiner unfreiwilligen Emigration wurde, schließlich, im Jahr darauf: „Freud und die Zukunft“, zum 80. Geburtstag des großen Arztes und Forschers.
Vom 17. bis 26. November 1952 weilte Thomas Mann zum letzten Mal in Wien. — Es war, seit seinem ersten Besuch in unserer Stadt im Jahr 1896, der zwölfte. Jene erste Reise hatte er unternommen, als ihm ein kleines Legat von 200 Mark zugefallen war, die er hier „zu verprassen“ gedachte, was ihm auch innerhalb von vier Tagen gelang. Das nächste Mal, 1908, besuchte er Arthur Schnitzler und traf auf dem Semmering Jakob Wassermann und Hofmannsthal. Im Jahr darauf wurde im Akademietheater sein (einziges) Theaterstück „Fiorenza“ aufgeführt, und er war davon entzückt. 1923 kam er zu einem Vortrag und besuchte zum ersten Mal Hofmannsthal in Bodaun. Bs folgten dann, 1925, „vier Pesttage in Wien“, vom 8. bis 11. Juni, mit PEN-Veranstaltungen und seinem Vortrag über „Natur und Nation“. Seither gab es, im Abstand von 1 bis 3 Jahren, immer wieder Vorträge oder Vorlesungen. Die wichtigsten waren Thomas Manns großer Bichard-Wagner-Vortrag im Jahr 1935, der die Münchener Hetzkampagne ausgelöst hatte und der unmittelbare Anlaß seiner unfreiwilligen Emigration wurde, schließlich, im Jahr darauf: „Freud und die Zukunft“, zum 80. Geburtstag des großen Arztes und Forschers.
Politische Wolken hatten sich inzwischen über dem Kontinent zusammengezogen, aber in Wien herrschte immer noch ein für Thomas Mann freundliches Klima. So erscheint es denn doppelt betrüblich, daß sein letzter Besuch mit jener dissonanten Ouvertüre begann, die wir in der 22. Folge der FURCHE zu schildern versucht haben. Wie jene ominöse Pressekonferenz aus der Sicht Thomas Manns gewertet wurde, erfahren wir aus einem Brief an den 20 Jahre jüngeren Berliner Journalisten und Schriftsteller Manfred George, der später In New York die Zeitschrift „Aufbau“ gründete und leitete. Bezugnehmend auf eine Mitteilung in „Associated Press“ schreibt Thomas Mann: „Mir ist eine Fehlmeldung von so läppischer Un-glaubwürdigkeit kaum je vor Augen gekommen. Spricht man auf einer Pressekonferenz zu erwachsenen, demokratisch erzogenen Menschen, oder sind es verhetzte Buben, an die man sich wendet?'« Diesmal an letztere, möchte man dem so böswillig Verleumdeten versichern. Wenn der Wunsch, zur alten Erde zurückzukehren, ihm so verleidet werde, so habe er die Bedeutung des Wortes ein ganzes Leben lang verkannt. Ein bitteres Resümee. „Aber freilich ist in unserer blutig entzweigeschlagenen Welt“, so schließt der Brief, „des Mißverstehens, Schnüffeins, Verdächtigens und Denunzierens kein Absehen. Also werde ich wohl auch nicht Ruhe haben bis zum Ende meiner Tage.“ ★
Doch kehren wir nach Wien zurück. Eines Vormittags, so gegen zehn Uhr, rief mich Franz Theodor Csokor in der Redaktion an und lud mich ein, ihn zu einem Besuch Thomas Manns ins Hotel Bristol zu begleiten. Ich wandte ein, das ginge doch nicht so sans facon, außerdem war ich in Arbeitsdreß und so gar nicht auf eine solche Begegnung vorbereitet. Aber Csokor sagte, er sei angemeldet, und ich möge unbedingt mitkommen, das Nähere werde er mir noch kurz vorher erklären. Der Besuch des PEN-Präsidenten und alten Freundes war für 11 Uhr angemeldet, und eine Viertelstunde vorher trafen wir uns vor dem Hotel. Seine Aufgabe, sagte Csokor, sei eine unangenehme, eine ganz grauslichpeinliche und beschämende Angelegenheit. Es war nämlich ein Vortrag
von Thomas Mann (oder ein Interview mit ihm) im Sender ROT-WEISS-ROT vorgesehen, und nun hatte eine amerikanische Stelle plötzlich „abgewunken“. Da Csokor, wie ich vermute, diese Einladung vors Mikrophon angeregt hatte, war es nun seine Aufgabe, den großen alten Mann wieder „auszuladen“. Doch Glück begünstigte uns auf eine geradezu makabre Art: Wir trafen in der Halle einen etwas bleichen, etwas ermüdeten Mann mit dickem Wollschal um den Hals. Er war — seit der großen Lungenoperation im März 1966 in Chikago — gegen jede Art Reizung der Luftwege sehr empfindlich und hatte sich, kurz vorher, im zugigen, ungeheizten Stiegenhaus der Universität Frankfurt eine Erkältung zugezogen, die sich in Wien zu einer regelrechten Bronchitis auswuchs. — Das erste, was er nach einleitendem Geplauder fragte, war, ob er wohl mit dieser belegten Stimme, seiner Rundfunk-Verpflichtung werde nachkommen können? Hatte er Wind bekommen — oder fühlte er sich wirklich schlecht? Das war für Csokor das Stichwort: „Schonen Sie sich, lieber Freund, um Gottes willen, und sagen Sie dieses blöde Radio ab, ich mach' das schon für Sie“. Und so geschah's. Wenigstens diese Kränkung blieb Thomas Mann in Wien erspart.
Im letzten Augenblick, von meiner Redaktion aufbrechend, hatte ich mein Hofmannsthal-Buch in ein Kuvert gesteckt, um mir eventuell, weil sich ja ein Beitrag von Thomas Mann darin befand, diesen signieren zu lassen. Aber es kam anders. Thomas Mann hatte die Belegexemplare nicht erhalten, hatte das Buch nie gesehen, lobte nun die schöne Ausstattung (von 1949!) die Photos, die Namen der Autoren, und selbstverständlich übergab ich es ihm (un-signiert) als Geschenk. Einige Tage später wurde mir von der Wiener Filiale des Fischer-Verlages „Die Entstehung des Doktor Faustus“ mit einer Widmung zugestellt, für die ich mich — schon nach Zürich adressierend, bedankte, und knapp zwei Wochen darauf kam die folgende Antwort:
Zürich, 12. Dez. 52
Werter Herr Professor, tausend Dank für Ihren Brief! Ich freue mich so sehr Ihrer alten und fortwährenden Anteilnahme an meinem Werk. Daß diese besonders dem „Faustus“ gilt, tut mir wohl. Das Buch hat mich viel gekostet. Der „Joseph“ war das reine Opernvergnügen dagegen. Aber es ist wahr, daß manche ihn gerade dieser Heiterkeit wegen in den Mittelpunkt meiner Produktion stellen.
Auch für das Heft der „Furche“ mit dem Artikel über meinen Vortrag habe ich sehr zu danken. Früher einmal erfuhr ich aus Briefen gutmütig Gekränkter, daß dort von geistlicher Seite — ich glaube, wegen des „Zauberberg“ — sehr schroff mit mir ins Gericht gegangen worden sei. Desto erfreulicher ist mir die ruhige und sympathische Haltung dieser Berichte.
Vor allem aber muß mein Dank
Ihrem Buchgeschenk gelten, diesen Hofmannsthal-Dokumenten, in denen ich lange gelesen habe. Ich habe diesen kostbaren Geist, dessen Menschlichkeiten ich mit amüsierter Ehrerbietung hinnahm, sehr geliebt, und beim Lesen erneuerte sich mir das Gefühl, der eigentümliche Stoß gegen das Herz, den ich bei der Nachricht von seinem Tode empfand. Dieser Tod war wirklich, nach einem guten Wort Arthur Schnitzlers, ,,die Geburt der Unsterblichkeit“.
Aus Wien ist mir letzhin viel Gutes gekommen. Das Buch von Mühlher, „Dichtung der Krise“, hat mir einen außergewöhnlichen Eindruck gemacht. Ich habe dem Verfasser beglückwünschend darüber geschrieben. Sehr schade, daß die Bronchitis, die mir nur gerade erlaubte, meine Verpflichtungen durchzuführen, mich auch um seine Bekanntschaft gebracht hat. Nur langsam erhole ich mich davon. Und jetzt steht der Trubel unserer Übersiedlung in das neue Heim in Erlenbach bevor.
Leben Sie recht wohl!
Ihr ergebener Thomas Mann
Ich hatte in meinem Brief nämlich meine besondere Wertschätzung seines letzten Buches, des „Doktor Faustus“, ausgesprochen und das „Musikologische“ daran — denn Adrian Leverkühn war ja Komponist — besonders gelobt: es sei als wie von einem Fachmann geschrieben, bis in jedes Detail richtig, jetzt
müßte sich nur ein Komponist finden, der die in diesem Buch genau beschriebenen Werke realisiert, und eine „Apocalypsis cum figuris“ gäbe es ja bereits: das Oratorium Franz Schmidts „Das Buch mit sieben Siegeln“. Aber er kannte offenbar weder den Namen des Komponisten noch das Werk... Wie ich dann später hörte, war ihm, was den „Doktor Faustus“ betrifft, Anerkennung „von musikalischer Seite“, wie er zu sagen pflegte, immer willkommen, obwohl er doch bei dieser Arbeit einen so kompetenten Berater wie Adorno beigezogen hatte. Und Thomas Mann war selbst ein großer Musikkenner, besonders Wagner-und Pfitzner-Spezialist. Das kann man von dem am Klavier phantasierenden Hanno Buddenbroock über die Tristan-Novelle und den „Zau-
berberg“ bis herauf zum „Doktor Faustus“ genau verfolgen.
Bei fast jedem seiner “Wien-Besuche traf Thomas Mann auch Hofmannsthal: Im PEN-Club, im Hotel Imperial oder in Rodaun. Doch wie waren ihre Beziehungen als Dichter? Der Norddeutsche bewunderte den großen Österreicher seit dem ersten Hervortreten des „prinzlichen Knaben“, wie er einmal schrieb. Und Hofmannsthal hat sicher den Rang Thomas Manns als Schriftsteller (Dichter wollte dieser ja nie genannt werden) erkannt. Doch hat er über keines der vielen Werke Manns auch nur eine Zeile veröffentlicht. Und auch der im Fischer-Almanach Nr. 82 versteckte Briefwechsel von 1908 bis 1929 umfaßt knappe 30 Seiten (Zum Vergleich: die Korrespondenz Hof-mannsthals mit Ottonie Gräfin Degenfeld, vor kurzem erschienen, ist ein Buch von über 500 Seiten!). Die weitaus größere Zahl der meist kurzen Texte stammt von Thomas Mann. Es gibt nur zwei ausführlichere Briefe: in dem einen versucht Thomas Mann Hofmannsthal zu überreden, die Wahl in die Deutsche Akademie der Künste anzunehmen, im andern begründet Hofmannsthal seine Ablehnung. (Er hat nie ein Amt bekleidet, hat keinen Titel und keine Auszeichnung angenommen, war in keinem „Verein“ Mitglied, außer in dem damals noch sehr exklusiven PEN). Daher müssen wir den Nachruf, den Thomas Mann für Hofmannsthal schrieb, als authentischestes Zeugnis
gelten lassen und setzen eine Passage (etwa ein Drittel des Textes) hierher: „Als er das letzte Mal bei mir war, vor wenigen Wochen, hatte er, zurück von einer Autotour nach Italien, von der er erfüllt war, einige Tage mit Grippe im Hotel gelegen, und man sah es ihm an. Er schien gealtert, grau geworden, seine Gesichtsfarbe war nicht die beste. Aber sein Wesen war von einer Wärme, Liebenswürdigkeit und Anmut, daß keine Besorgnis seines Äußeren wegen aufkommen mochte und ich mich glücklich an meine erste Begegnung mit ihm erinnert fand: vor mehr als zwanzig Jahren, als ich ihn zuerst in Rodaun besuchte und in dem schönen, fast bühnenbildhaften Barocksalon seines Heims, der den Blick auf den Gartenplatz gewährt, wo er „Elektra“ geschrieben, zuerst
„Der Großschriftsteller“ (Musil)
den Reiz seines Gesprächs erfuhr. Ohnedies hingenommen von der Atmosphäre Wiens, dem Älteren, Milderen, Holderen, was den Norddeutschen, im bäuerlichen München Angesiedelten daraus ansprach, war ich bezaubert von der Konzentration dieser Kultur in der Person ihres Dichters. Ich verbrachte den Tag mit ihm, ich ging neben ihm durch seine Landschaft, er las mir in seinem Arbeitszimmer, wo ich eine geistvolle Plastik von Minne bewunderte, aus Lustspielentwürfen vor. Das erste Mal. Die Meinen bestätigen mir mein Entzücken von damals. Briefe und fast alljährlich wiederkehrende Begegnungen in München, Salzburg, Wien haben seitdem geistig-menschliche Beziehungen unterhalten, die nun ins Ewige gelöst sind. Habe ich sie nach ihrem Wert zu schätzen gewußt? Wie der Mensch das Leben schätzt, solang es im Fleische ist, genug, wie die Materie uns die Aussicht aufs Ewige verstellt. Unsere Einbildungskraft reicht nicht aus oder sie gibt sich nicht dazu her, uns das Irdische im Licht des Todes erblicken zu lassen, da doch nur dieses Licht uns seinen Wert erkennbar machen würde. Ich habe nicht gewußt, wie Hofmannsthals Hingang mich schmerzen werde, noch habe ich ganz verstanden, was uns zusammenführte und durch die Jahrzehnte zusammenhielt. Das Wort „Freundschaft“ bedürfte heute seiner Genehmigung. Aber trotz aller Unterschiede der Geburt, der Überlieferung und Lebensstimmung nenne ich, sehend gemacht durch den Tod, die Wahrheit bei Namen, wenn ich von Brüderlichkeit, von Schieksalsver-wandtschaft spreche. Wären wir beide weniger .schwierig' gewesen...“
Aus: Hugo von Holmannsthal — Der Dichter im Spiegel der Freunde, l. Auflage (1969) Humboldt-Verlag, Wien, 2. Auflage (1963) Francke-Verlag,
Bern.
Zum Abschluß sei noch eines heiter-geselligen Abends gedacht: Am 19. November fand im Apollo-Kino die Gala-Uraufführung des Films „1. April 2000“ statt, der Thomas Mann als Ehrengast beiwohnte. — Danach wollte er noch nicht gleich ins Hotel zurück, auch zu keinem offiziellen Souper, sondern „in ein richtiges, kleines Wiener Kafeehaus in der Nähe“. Professor Csokor machte eines ausfindig, und die aus fünf oder sechs Herren bestehende kleine Gesellschaft im Smoking mochte auf die übrigen Gäste einen recht merkwürdigen Eindruck gemacht haben. (Ich erinnere mich nicht mehr, in welchem Kaffeehaus man saß und wer die übrigen waren). Thomas Mann hatte sich bei dem Film bestens unterhalten, war aufgeräumt, gesprächig und in bester Laune, er lobte den Film, dessen Drehbuch von Ernst Marboe mit seiner „optimistischen Tendenz“, lobte die Hauptdarsteller, besonders Hilde Krahl und Leopold Rudolf — und fand den Qualtinger „umwerfend“. Dann erkundigte er sich nach der Staatsoper: er hätte an einem der wenigen freien Abende sich gern eine Mozart- oder Strauss-Oper (wegen des Textes von Hofmannsthal) angesehen, aber er hatte erfahren, daß die Philharmoniker derzeit auf Tournee seien — was Csokor und mir nicht bekannt war — und zögerte ein wenig. So war er. Er wußte allerlei, was niemand dem „Dichter“ zugetraut hätte. Und er genoß alles Neue, Unbekannte, blieb „neugierig“ sein Leben lang. Auch das wußte er und schrieb 1952 an seinen alten Freund Emil Pretorius: „Von Müdigkeit abgesehen, ist es bei mir mit meinen beinahe 77 nicht so weit her. Wie es mit der Produktivität immer stehen möge — an der mir treu gebliebenen rezeptiven Frische habe ich oft mein heimliches Vergnügen“. Und die sich seiner Gesellschaft erfreuen durften, profitierten davon...