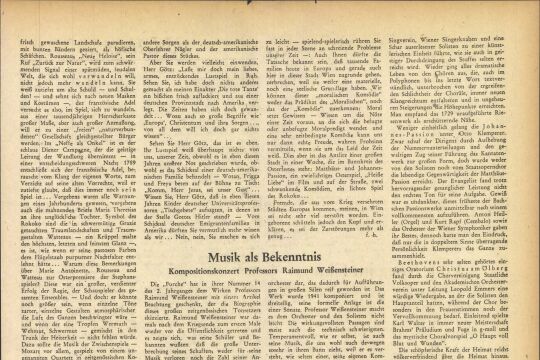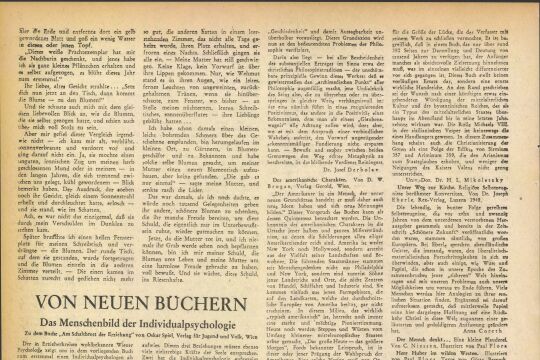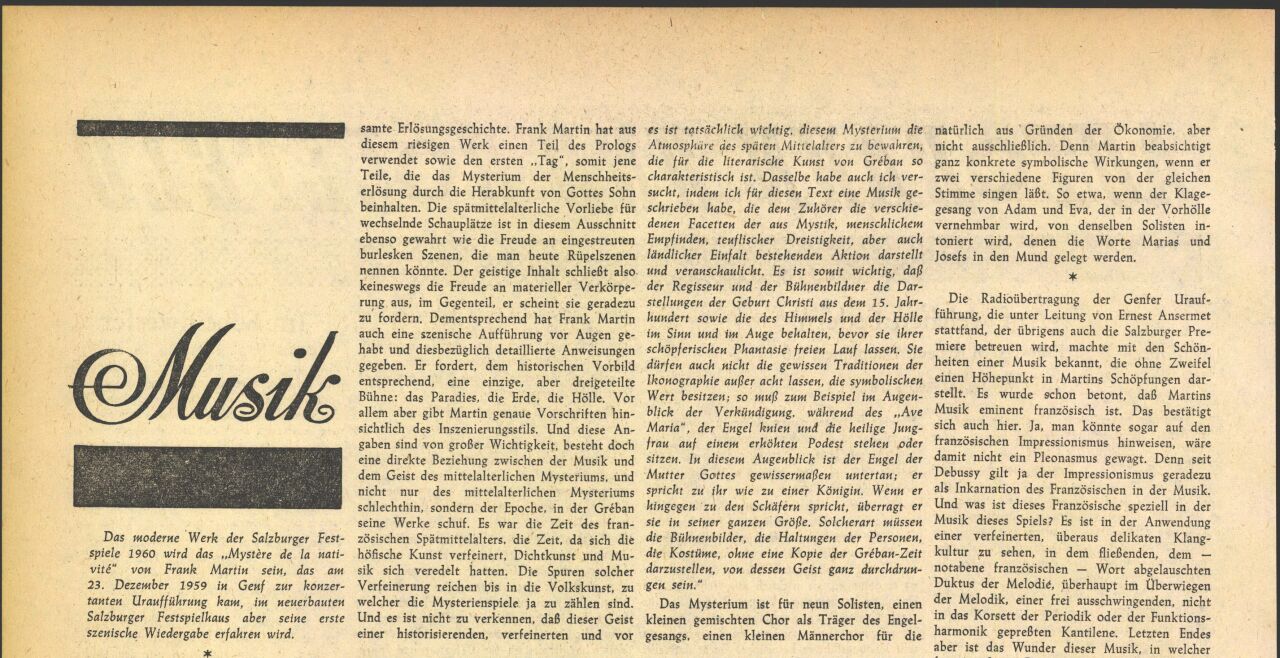
Das moderne Werk der Salzburger Festspiele 1960 wird das „Mystere de la nati-viti“ vom Frank Martin sein, das am 23. Dezember 1959 in Genf zur konzertanten Uraufführung kam, im neuerbauten Salzburger Festspielhaus aber seine erste szenische Wiedergabe erfahren wird. *
Seit etwa 15 Jahren hat der in der Nähe von Amsterdam lebende Schweizer Komponist Frank Martin wie kaum ein anderer Meister seiner Generation das österreichische Publikum in seine Fesseln geschlagen. Dieses Phänomen verdient Beachtung, hegt doch der österreichische Hörer, noch über seine allgemeine Vorsicht in der Beurteilung moderner Musik hinaus, ein gewisses Vorurteil gegen die Kunst des französischen Kulturkreises, die seinen Auffassungen ja tatsächlich sehr fremd ist. Um so beachtenswerter die steigende Beliebtheit Frank Martins, der — ein typischer Einzelgänger der modernen Musik — durch keine „Schule“ und keine Interessentengruppe geschoben wird, sondern stetig seinen klar vorgezeichneten Weg geht, ein Komponist, der nicht einmal zu den sonst so viel geliebten Mätzchen der Originalitätssucht greift, um das Publikum an sich zu erinnern. „Le vin herbe“ wurde zuerst in Salzburg und Wien bekannt, von den Instrumentalwerken die Petite Symphonie Concertante, das Konzert für Bläser und Orchester, das Violinkonzert, es folgten die Oratorien, vor allem die Passionsmusik „Golgotha“, und schließlich kam es in der Staatsoper zur Uraufführung der Shakespeare-Oper „Der Sturm“, einem wahren Wunder an zarter Poesie und musikalischer Feinheit.
Das jüngste Werk Martins, „Le mystere de la nativite“, wird als erstes modernes Werk in das neuerbaute Salzburger Festspielhaus Clemens Holzmeisters einziehen und schon dadurch den Höhepunkt von Martins bisherigem österreichischen Weg darstellen. Als „Mysterium“, als moderne musikalische Fassung eines mittelalterlichen Mysterienspiels, wird das Werk wohl gut in die Jedermann-Stadt passen, wenn auch gewisse Zweifel auftauchen, die mit der Zeit-gebund'enheit der „Nativite“ zusammenhängen. Denn Martins Mysterium ist ein Weihnachtsspiel, ein Weihnachtsspiel mit Verkündigung, Gloria, Engelchören und mit den Heiligen Drei Königen. Doch will Frank Martin diese Zeitgebundenheit nicht gelten lassen. Für ihn ist das Mysterium der Geburt-gleichbedeutend mit dem Mysterium der Erlösung, dessen tiefer Sinn über Zeitr und Ortsbegrenzungen erhaben ist. Ein weiteres mögliches Mißverständnis sieht Martin in dem Titel „Mysterium“ (ohne weitere Spezifizierung), unter dem das Werk unglücklicherweise zunächst angekündigt wurde. Ein Publikum, das diesen Ausdruck ohne dessen Bindung zum Begriff der Menschwerdung vorgesetzt erhält, das vielleicht zum Teil keine historische Sinngebung hinzuzuziehen vermag, könnte unter Umständen Assoziationen zu freimaurerischen Riten oder esoterischen Geheimnissen vermuten. Diesen falschen Vermutungen gilt es entgegenzutreten: „Le mystere de la nativite“ ist textlich ein mittelalterliches Mysterienspiel, in seiner modernen musikalischen und szenischen Fassung eine Verkündigung des christlichen Erlösungsgedankens, die weniger ein Mysterium, ein Geheimnis, als ein ministerium, ein Gottesdienst, sein soll.
Ein Mysterium von außergewöhnlicher Länge war „Le mystere de la Passion“ von Arnoul Greban, das um 1450 entstand. Es umfaßt einen Prolog und vier Stücke, die an ebensoviel Tagen gegeben wurden, insgesamt 34.574 Verse, und enthält von der Revolte der Engel und dem Fall Adams und Evas an bis zur Passion, Ressurrektion und Verklärung Christi die gesamte Erlösungsgeschichte. Frank Martin hat aus diesem riesigen Werk einen Teil des Prologs verwendet sowie den ersten „Tag“, somit jene Teile, die das Mysterium der Menschheitserlösung durch die Herabkunft von Gottes Sohn beinhalten. Die spätmittelalterliche Vorliebe für wechselnde Schauplätze ist in diesem Ausschnitt ebenso gewahrt wie die Freude an eingestreuten burlesken Szenen, die man heute Rüpelszenen nennen könnte. Der geistige Inhalt schließt also keineswegs die Freude an materieller Verkörperung aus, im Gegenteil, er scheint sie geradezu zu fordern. Dementsprechend hat Frank Martin auch eine szenische Aufführung vor Augen gehabt und diesbezüglich detaillierte Anweisungen gegeben. Er fordert, dem historischen Vorbild entsprechend, eine einzige, aber dreigeteilte Bühne: das Paradies, die Erde, die Hölle. Vor allem aber gibt Martin genaue Vorschriften hinsichtlich des Inszenierungsstils. Und diese Angaben sind von großer Wichtigkeit, besteht doch eine direkte Beziehung zwischen der Musik und dem Geist des mittelalterlichen Mysteriums, und nicht nur des mittelalterlichen Mysteriums schlechthin, sondern der Epoche, in der Greban seine Werke schuf. Es war die Zeit des französischen Spätmittelalters, die Zeit, da sich die höfische Kunst verfeinert, Dichtkunst und Musik sich veredelt hatten. Die Spuren solcher Verfeinerung reichen bis in die Volkskunst, zu welcher die Mysterienspiele ja zu zählen sind. Und es ist nicht zu verkennen, daß dieser Geist einer historisierenden, verfeinerten und vor allem französischen Geistigkeit in Martins Musik wieder auflebt. Deshalb ist es also wichtig, daß der optische Eindruck dem Sinn von Sprache und Bild gerecht wird. Und deshalb fordert Martin:
„Eine Inszenierung dieses Mysteriums soll sich an den Gemälden und Kirchenfenstern des 15. Jahrhunderts inspirieren, so aktuell die verwendeten technischen Mittel auch sein mögen;es ist tatsächlich wichtig, diesem Mysterium die Atmosphäre des späten Mittelalters zu bewahren, die für die literarische Kunst von Greban so charakteristisch ist. Dasselbe habe auch ich versucht, indem ich für diesen Text eine Musik geschrieben habe, die dem Zuhörer die verschiedenen Facetten der aus Mystik, menschlichem Empfinden, teuflischer Dreistigkeit, aber auch ländlicher Einfalt bestehenden Aktion darstellt und veranschaulicht. Es ist somit wichtig, daß der Regisseur und der Bühnenbildner die Darstellungen der Geburt Christi aus dem 15. Jahrhundert sowie die des Himmels und der Hölle im Sinn und im Auge behalten, bevor sie ihrer schöpferischen Phantasie freien Lauf lassen. Sie dürfen auch nicht die gewissen Traditionen der Ikonographie außer acht lassen, die symbolischen Wert besitzen; so muß zum Beispiel im Augenblick der Verkündigung, während des „Ave Maria“, der Engel knien und die heilige Jungfrau auf einem erhöhten Podest stehen oder sitzen. In diesem Augenblick ist der Engel der Mutter Gottes gewissermaßen Untertan; er spricht zu ihr wie zu einer Königin. Wenn er hingegen zu den Schäfern spricht, überragt er sie in seiner ganzen Größe. Solcherart müssen die Bühnenbilder, die Haltungen der Personen, die Kostüme, ohne eine Kopie der Greban-Zeit darzustellen, von dessen Geist ganz durchdrungen sein.“
Das Mysterium ist für neun Solisten, einen kleinen gemischten Chor als Träger des Engelgesangs, einen kleinen Männerchor für die Höllenszenen und einen großen gemischten Chor gesetzt. Dieser soll entweder im Orchesterraum oder auf der Bühne sitzen. Er nimmt jedoch auf keinen Fall direkt an der Handlung teil, lediglich in der Schlußszene wird sein Gesang zur Hymne des Volkes. Das. Orchester ist der übliche große, aber nicht überdimensionierte Klangkörper. Die neun Solisten werden jeder in mehreren Rollen eingesetzt. Dies geschieht natürlich aus Gründen der Ökonomie, aber nicht ausschließlich. Denn Martin beabsichtigt ganz konkrete symbolische Wirkungen, wenn er zwei verschiedene Figuren von der gleichen Stimme singen läßt. So etwa, wenn der Klagegesang von Adam und Eva, der in der Vorhölle vernehmbar wird, von denselben Solisten intoniert wird, denen die Worte Marias und Josefs in den Mund gelegt werden.
Die Radioübertragung der Genfer Uraufführung, die unter Leitung von Ernest Ansermet stattfand, der übrigens auch die Salzburger Premiere betreuen wird, machte mit den Schönheiten einer Musik bekannt, die ohne Zweifel einen Höhepunkt in Martins Schöpfungen darstellt. Es wurde schon betont, daß Martins Musik eminent französisch ist. Das bestätigt sich auch hier. Ja, man könnte sogar auf den französischen Impressionismus hinweisen, wäre damit nicht ein Pleonasmus gewagt. Denn seit Debussy gilt ja der Impressionismus geradezu als Inkarnation des Französischen in der Musik. Und was ist dieses Französische speziell in der Musik dieses Spiels? Es ist in der Anwendung einer verfeinerten, überaus delikaten Klangkultur zu sehen, in dem fließenden, dem — notabene französischen — Wort abgelauschten Duktus der Melodie, überhaupt im Überwiegen der Melodik, einer frei ausschwingenden, nicht in das Korsett der Periodik oder der Funktionsharmonik gepreßten Kantilene. Letzten Endes aber ist das Wunder dieser Musik, in welcher französischer Geist zum Personalstil eines Meisters wird, nur mit einem Wort zu umschreiben: Einfachheit. Sie läßt sich auch stilistisch erfassen: sie liegt in der Harmonik, die frei von Dissonanzen ist — Martin zählt zu den wenigen zeitgenössischen Musikern, die fast ausschließlich Konsonanzen verwenden —, sie liegt in der Unkompliziertheit der Formen, die nur ganz selten selbständige Funktionen haben. Wesentlicher aber als all dies ist die Einfachheit und Bescheidenheit, wie sie im Ausdruck der Musik fühlbar wird. Und dafür gibt es keine Erklärungen, es sei denn der Hinweis auf die persönlichen, menschlichen Qualitäten des Autors. Wie wesentlich aber gerade diese Qualitäten in diesem Fall sind, geht aus den gleichen Eigenschaften des mittelalterlichen Textes hervor. Undenkbar, was da entstanden wäre, wenn nicht ein gleichgesinnter Geist am Werke gewesen wäre.
Eine gewisse Ausnahme machen natürlich die Höllenszenen. Sie sind ja Kontrast, Intermedien, die in ihrer weltlichen Lustigkeit schon im Mittelalter die Pausen, das Ausruhen von der geistigen Konzentration markieren sollten und heute Iceine andere Funktion haben als damals. Bezeichnend dafür, daß diese Szenen zum größten Teil in Prosa gesprochen werden und nur gelegentlich eine untermalende, bloß illustrierende Musik finden, besser gesagt, eine Art Geräuschkulisse.
Um so schöner, empfindungstiefer wirkt dann wieder die Musik. Und nicht etwa auf eine Auslese von Hörern, nein, es ist eine Musik für breite Publikumsschichten. Und dies mag ihr erstaunlichstes Merkmal sein. Zwischen der Scylla Epigonentum und der Charybdis Originalität um jeden Preis hat Frank Martin einen Weg gefunden, der aus dem elfenbeinernen Turm herausführt. Von diesem Weg hat er geträumt, als-er schrieb:
„Die richtige Verhaltensweise des Komponisten wäre es ohne Zweifel, nach seinem wahren Geschmack zu schreiben, wirklich das festzuhalten, was er am meisten liebt. Man muß freilich gestehen, daß es heute nur wenige gibt, die das tun; dem Anschein zum Trotz ist es das schwerste Ding von der Welt. Man braucht dazu besonders viel Mut, denn die Mode ist eine gleichzeitig mächtige und verführerische Herrscherin, und oft glaubt sich einer unabhängig, der ihr bewußt gehorcht. Auf jeden Fall kann in Gegenwart von so hochgespannten und einander entgegengesetzten Anforderungen die Haltung des Künstlers in seinem Schaffen nur schwer und selten eine abgeklärte sein. Weit öfter wird sie mit Kampf zu tun haben: Kampf mit sich selbst, mit dem Publikum, Kampf vor allem mit diesen konträren Forderungen. Zweifellos läßt sich darin auch eine kräftige Anregung finden, denn unaufhörlich wird die Hoffnung wiedergeboren, eines Tages jene Gegensätze versöhnen, besser gesagt, vereinigen zu können, jene Gegensätze, die sich auf der einen Seite als Originalität und Gärung, auf der anderen als Schönheit und Abgeklärtheit gegenüberstehen. Immer wieder entsteht aufs neue auch die Hoffnung, auch mit dem Publikum den erträumten Kontakt zu finden, ihm endlich das geben zu können, was es erwartet: jenes Werk, das neu und klassisch zugleich ist. . .“
Und Frank Martin, der diesem Ziel vielleicht näher gekommen ist als irgendein anderer unserer Generation — er wäre nicht Frank Martin, wenn er nicht hinzusetzte: „... jenes wunderbare, unmögliche Werk ..