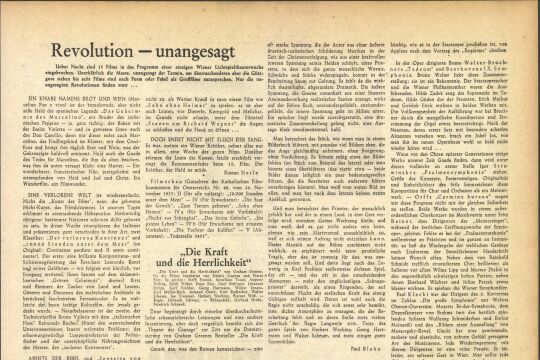Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Festspiele der Mozart-Stadt
Das kunstvolle szenische Geflecht der Handlung in der Mozart-Oper „Le nozze di Figaro" mit dem- starken politisch-satirischen Einschlag wurde in diesem Jahr aufgelockert und die heiteren Verwirrungen stärker in die Bahn der italienischen Büffa gelenkt. Während die szenische Darstellung zum Ursprung, zur Büffaoper, .zurückkehrte, ließ das Bühnenbild, das noch im vergangenen Jahr in den Entwürfen von Alfred Roller eine wunderbare Verbindung mit den besten Zeiten der Festspiele hergestellt hatte, in seiner jetzigen Gestaltung von Caspar Neher die Übereinstimmung mit dem Stil der unwandelbaren Mozartschen Musik durch desillusionierende Nüchternheit vermissen. Herbert Karajan ließ die feinpointierten SeCco-Rezitätive wie Chansons funkeln, das Parlando behandelte er mit glücklicher Einfühlung in Sprache, Charakter und Affekt. Die Ouvertüre wurde unter seiner temperamentvollen Stabführung ein etwas zu wirbelnder Auftakt, die Festesstimmung zu einem tollen, überstömenden Brio. Den wunderbaren, unerschöpflichen Reichtum der Melodien konnte man im Verlauf der Handlung durch die Übersteigerung nicht voll auskosten, trotzdem die gesanglichen Leistungen vollendet dargebracht wurden.
Zum zweitenmal wurde neben den großen Meistern der Tonkunst ein modernes Opernwerk auf den Spielplan der Festspiele gesetzt. Das Experiment „Dantons Tod“ war gelungen, in diesem Jahr wählte man als Vertreter der modernen Musik Frank Martin mit seinem Werk „Le vin herb 6" (Der Zaubertrank), das bereits als Oratorium aufgeführt worden ist. Die zu einem Roman geformte Fassung des Tristan- Stoffes von Joseph Bedier bildet für den Komponisten die Grundlage zu seinem musikalischen Werk. Von allen Vorbildern .unabhängig, insbesondere von der Tristanformung Richard Wagners, brachte Martin den spröden Stoff in eine eigene musikalische Sprache. Man kann diese Komposition nur so bezeichnen, denn weder Melodienführung noch ein besonderer Rhythmus treten hervor, sie folgt lediglich dem Wort als Sprachmelos, wie es die Musik des Altertums kennt. Man muß das Technische, das Mathematische, das in dem Werk enthalten ist, bewundern, jedoch das Empfinderi, „das Geschenk des.. Himmels“, schweigt. Darum bleibt man kühl trotz der Handlung, die Bedier in so einfacher, ergreifender Weise erzählt, und trotz der wunderbaren Sprache der Bindingschen Übersetzung. Nun mag noch die Form des Oratoriums der inneren Enthaltsamkeit der Musik entgegerikommėn, jedoch der Versuch, das Ton werk in eine Oper umzuwandeln, wird durch die rein epische Gestaltung, unbefriedigend gelöst. Zweifellos hat zu dieser Dramatisierung das antike Theater als Vorbild gedient, was auch Caspar Neher im Bühnenbild, sparsam in Form und Farbe, zum Ausdruck brachte. Oskar Fritz Schuh beschränkte sich in der Regiearbeit auf strenge, antike Gesten bei den Solopartien, und bei der Gruppierung des Chores hielt er sich gleichfalls an die Vorschriften des hellenischen Theaters. Ferenc Fricsay, der das kleine Orchester leitete, holte aus der subtilen Partitur alle Klangmöglichkeiten heraus. Die Künstler, in erster Linie Maria Cebotari (Isot) und Julius Patzak (Tristan), gaben mit ihrer hohen Gesangkultur der Aufführung zuweilen Glanz, durch Charakterisierung des Sprechgesanges belebten sie das undramatische musikalische Geschehen. Ein Achtungserfolg, der dem Bemühen der Sänger, der Musiker und dem Staatsopernchor galt, schloß die wenig festspielmäßige Aufführung.
Wilhelm Furtwängler hat in seinem Orchesterkonzert die großen Erwartungen nicht ganz erfüllt, da unbegreiflicherweise kein symphonisches Werk unserer Klassiker auf dem Programm stand. Nach dem Höhepunkt der diesjährigen Festspiele, den uns Furtwängler in der unvergessen bleibenden Wiedergabe der Leonoren-Ouvertüre geschenkt hat, mußte die Auswahl der Werke in seinem Konzertprogramm, die sich auf weniger bedeutende moderne Kompositionen beschränkt, etwas enttäuschen. Das eigenständige Variationswerk von Alfred Uhl, „Introduktion und Variationen über ein Thema aus dem 16. Jahrhundert“, zeigte die ernste Geisteshaltung des Komponisten, konnte jedoch weder den Interpreten noch das Publikum entzünden. Auch die drei Vorspiele zu „Palestrina“ von Hans Pfitzner, sind zu spröde, um eine Aussage eines Dirigenten vom Formate Furtwänglers zur Geltung bringen zu können. Die „P e t r u s c h k a - S u i t e“ von Strawinsky hat unter der instrumentalen Umarbeitung gelitten. Erst die symphonische Dichtung von Richard Strauß, „Ein Helden- 1 e b e n“, bot Ganzes und neuer, edler Glanz brach aus dem Werk, dem wir heute schon etwas entfremdet .gegenüberstehen. Fast schon traditionell sind die Orchesterkonzerte Edwin Fischers, der nicht nur die Philharmoniker leitete mit einer Kraft, die aus tiefem Musikempfinden geboren ist, sondern gleichzeitig als Pianist und Dirigent wie kaum ein anderer das Metaphysische ih den reifen Werken Mozarts,. Beethovens und Schuberts auszudeuten versteht. Es war ein Befreien aus einem tiefen inneren Erleben, als das Publikum in endlosem Beifall dem Künstler und seinen Helfern dankte. Im Mittelpunkt des dritten Orchesterkonzerts stand unter der Leitung des italienischen Dirigenten Alceo Galli era die Fünfte Symphonie von Anton Dvorak in c-mpll op. 95. Der Amerikaaufenthalt Dvoraks hat mit der reichen Verwendung von Volksmusikmotiven der Neger und Indianer in der Symphonie „Aus der Neuen Welt“, seinen Niederschlag gefunden. Der fremdartige Charakter der Musik führt in diese neue Welt, es klingen Töne auf, die nur bei Naturvölkern und im Altertum gebräuchlich. waren. Aber immer wieder durchzieht ein Motiv das Werk — rnan darf es… wohl Heimwehmotiv nennen .—, Sehnsucht nach dem Vaterland und den Freunden. Gallieras Temperament und seine Geistigkeit machten ihn zu einem vorzüglichen Vermittler der Themen. Wo. jedoch die weichen Empfindungen der Heimaterinnerung durchklingen, wäre mehr gefühlsmäßige Auslegung erwünscht gewesen. „Der Feuervogel“, ein Jugendwerk Strawinskys, entfaltete seine Schwingen in südlicher Pracht. .. In der symphonischen Dichtung „Nocturnes“ von Claude Debussy zeigten die Philharmoniker wieder ihre wunderbare Prägnanz, und die Zartheit ihrer Streicher schimmerte in den verschwommenen Farben des Tongemäldes.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!