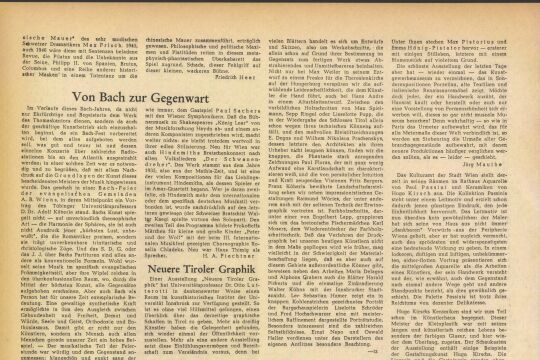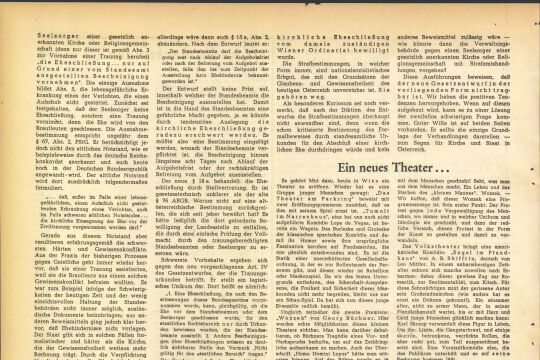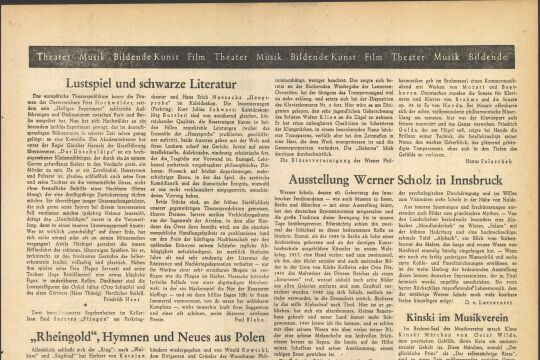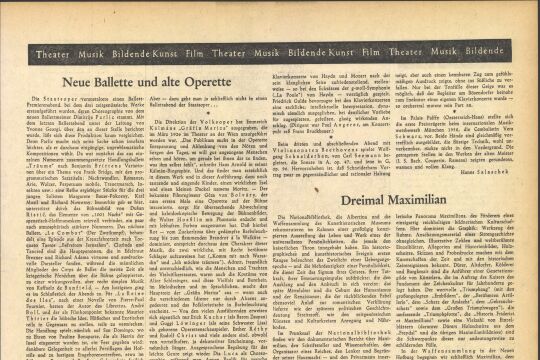Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ernste und heitere Kantaten
Das traditionelle alljährliche Kompositionskonzert von Raimund Weissensteiner, von den Wiener Symphonikern unter der Leitung Kurt Rapfs ausgeführt, begann mit einem neuen Variationenwerk, das im Vorjahr beendet wurde. Es ist, wie seine Vorläufer (die Variationen über die die Ostersequenz, das „Dies irae” und andere) für großes Orchester gesetzt und von diesen technisch und strukturell wenig unterschieden. Auch daß der Komponist gerade nach der ersten pythischen Ode von Pindar griff, die in einem Codex des Klosters San Salvadore bei Messina aufgezeichnet wurde (und deren Authentizität natürlich niemand verbürgen kann), ist begreiflich; sie entspricht dem Gesamtstil Weissensteiners. — Sehr interessant war die Wiederbegegnung mit der Neufassung der VI. Symphonie von 1947, deren letzter Satz der Komponist stark umgearbeitet, eigentlich neu geschrieben hat. Dabei wurde ein zwölftöniges Thema eliminiert und durch ein anderes, kantableres und faßlicheres ersetzt, der symbolische, dreißigmal wiederkehrende, Zwölftonakkord aber beibehalten. Der stärkste Eindruck ging jedoch von den „Liedern eines Gottsuchers” aus, und dies nicht nur dank der meisterhaften, wenn auoh wenig stimm- kräftigen Interpretation durch Otto Wiener. Hier ist die meist harte, blechbläsergepanzerte Sprache des Priesterkomponisten weicher, lyrischer, zugänglicher; und wie er so verschiedenartige Texte wie die von Ephraem dem Syrer und Boethius (4. und 6. Jahrhundert) über Jean Paul, Nietzsche, Maeterlinck und Thrasolt in einer — seiner — Sprache vertont hat, spricht für die eigenständige Künstlerpersönlichkeit Weissensteiners, von dem man freilich postromantischen Schönklang und einschmeichelnde Melodien nicht erwarten darf. Geistig an der Gregorianik und an Bruckner orientiert, könnte man Raimund Weissensteiner als „Neugotiker” bezeichnen. Starker Beifall eines Publikums, das die Inbrunst des Strebens und die Einheit der Aussage zu spüren schien.
„Wer einsam ist, der hat es gut” Ist der Titel einer heiteren Kantate von Alfred Uhl für Sopran, Tenor und Bariton, Chor und Orchester nach Gedichten von Wilhelm Busch, Christian Morgenstern und Joachim Ringelnatz, die im 4. Abonnementkonzert der Philharmoniker unter der kundigen und temperamentvollen Leitung des Komponisten aufgeführt wurde. Sie erklang zum erstenmal vbr fünf Jahren im gleichen Saal, und wenn wir damals den Eindruck hatten, daß ein Kammerensemble dem leichten, humoristischsatirischen Stoff gemäßer gewesen wäre, so zeigt bei der Wiederbegegnung auch der große Apparat seine Vorteile. Uhl hat jenen Humor von der Sorte „wenn man trotzdem lacht”, in den Künsten der Instrumentation und der treffenden Charakterisierung ist er ein Meister, und er versteht es auch mit seiner Musik, das Publikum zu unterhalten. Auffallend war dem Rezensenten, wie das Niveau der Musik von dem der Texte abhängig ist, das heißt die Morgenstern-Lieder und –Chansons sind die weitaus feinsten und anspruchvollsten. Die Philharmoniker waren mit bester Laune am Werk, und die drei ausgezeichneten Solisten brillierten in allen Registern, nicht nur der Stimmen — vom Baß bis zum Sopran —, sondern auch in denen des variablen Ausdrucks (Wilma Lipp, Murray Dickie und Hans Lättgen).
Im Museum des 20. Jahrhunderts spielte das Ensemble „die reihe” unter der Leitung von Friedrich Cerha Werke von Boulez, Haubenstock- Ramati (derzeit in Wien ansässig) und Christobal Halffter, dem jugendlichen Direktor des Conservatorio Real in Madrid. Das Hauptwerk des Abends, „Le Marteau sans Maitre” von 1954, das inzwischen Schule gemacht hat und auch in Wien wiederholt aufgeführt wurde, ist an dieser Stelle schon ausführlich gewürdigt worden. (Die Solistin Rosemary Phillips wurde für die einmalige Aufführung extra im Flugzeug aus London herbeigeholt, aber man fragte sich am Schluß, ob sich der Transport gelohnt hat.) Auch die Flötensonate von Boulesz, von Peter Kotik und Charlotte Zelka mit Ausdruck, Vehemenz und beachtlicher Virtuosität vorgetragen, wurde in Wien schon gespielt. Htilffters „Espe jos” von 1963 ist für vier Schlagzeuger und Tonband geschrieben. Von der Art dieser KortipoSitio- nen mag ein Selbstkommentar zu „Mobile for Shakespeare” von 1960 für Klavier, Celesta, Vibra-Mardmba- phon und drei Schlagzeuger mit der vorzüglichen Merial Dickinson, die dazu zwei Shakespeare-Sonette sang, eine Vorstellung geben: „Verschiedene Objekte rotieren mit verschiedenen Umlaufzeiten. Das Resultat ist eine unbegrenzte Anzahl verschiedener vertikaler Zusammenhänge, erreicht durch die Rotation einer begrenzten Anzahl von Elementen.” Helmut A. Fiechtner
Das Orchester „Philharmonia Hungarica” spielte unter Leitung von Miltiades Caridis die „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta” von Bėla Bartök in nicht ganz ausgeglichener Wiedergabe, was wohl vor allem auf die Tempoauf- fassungen zurückzuführen war sowie auf den zuwenig beseelten Vortrag des Adagios, das zu den schönsten Eingebungen moderner Musik gehört. Ausgezeichnet tönen die Holzbläser, ein wenig zu fanfarig das Blech. Das war auch beim nachfolgenden 1. Konzert für Klavier und Orchester, Es-Dur von Franz Liszt zu bemerken. Allerdings brachte der Solist Ludwig Hoffmann Schwung und Bedeutung in die Wiedergabe und riß die Führung an sich. Mit einer abgerundeten Wiedergabe von Tschaikowskijs 5. Symphonie e-Moll, op. 64, spielte sich das Orchester völlig frei und wurde mit Sympathiekundgebungen überschüttet.
Daniel Schafran, der bekannte Violoncellist, von Nina Mussinjan auf dem Klavier begleitet, spielte die Sonate G-Dur, BWV 1027 von Johann Sebastian Bach, die Sonate Nr. 1 von Moise Wainberg und die Sonate in c, op. 65 von Benjamin Britten sowie von Bach die Solo-Suite D-Dur, BWV 1012. Was in allen Stücken auffiel, war die Trockenheit der Wiedergabe, die viele Feinheiten und manche Unvollkommenheiten aufwies, besonders in der Intonation, aber nirgends ein persönliches Profil zeigte. Dadurch kamen sowohl Wainberg als noch mehr Britten um das Beste in ihren Kompositionen, und das Weitausschwingende, ins Metaphysische reichende in Bachs Musik kam nur andeutungsweise zur Geltung, zumal auch vom Klavier her in dieser Richtung keine Hilfe kam. Es blieb Musik ohne Muse.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!