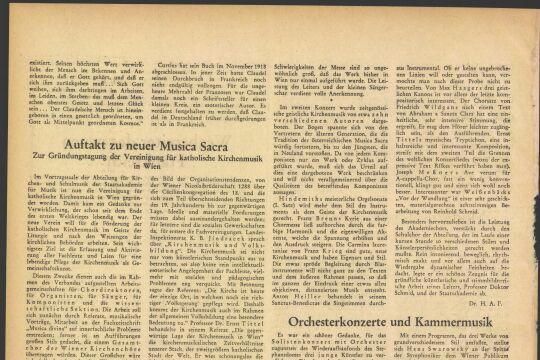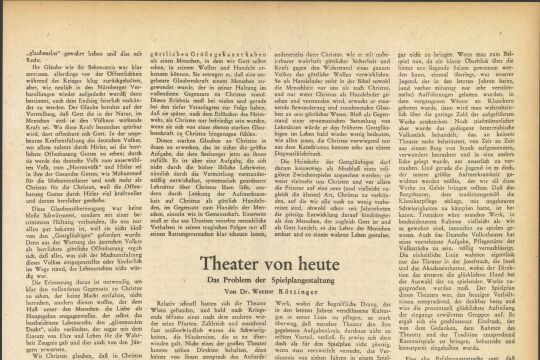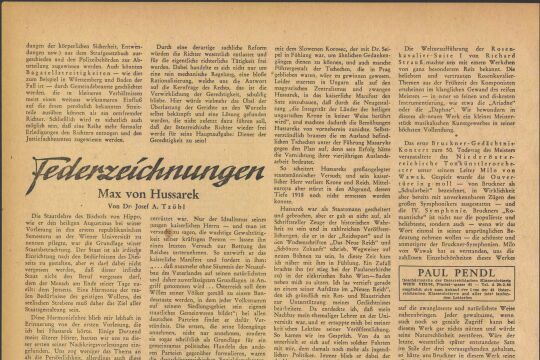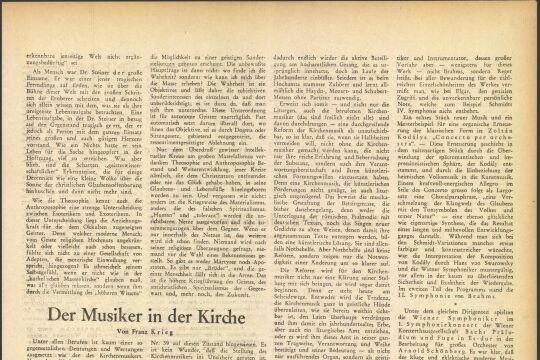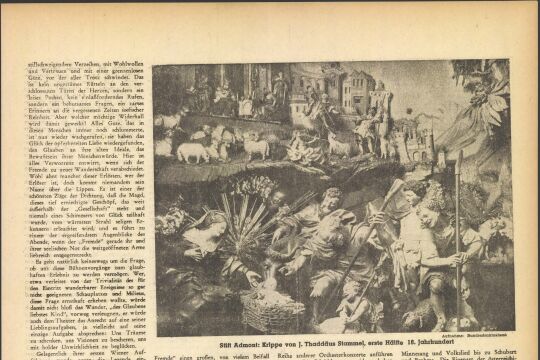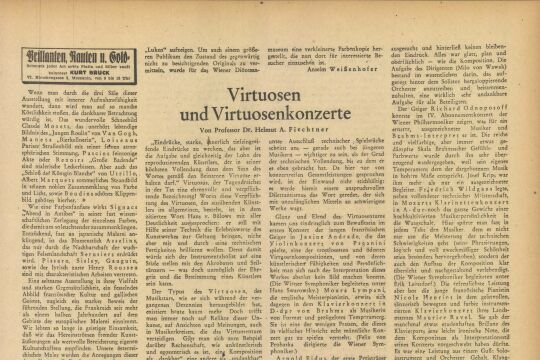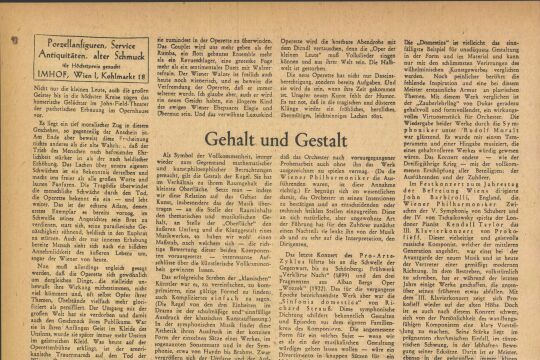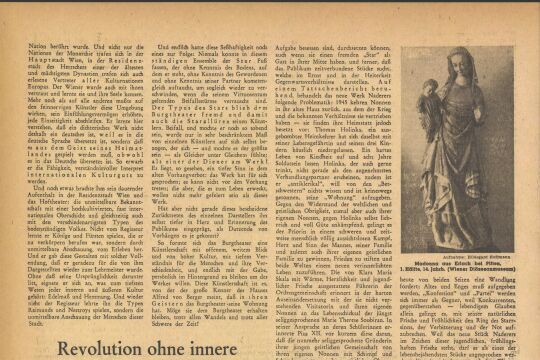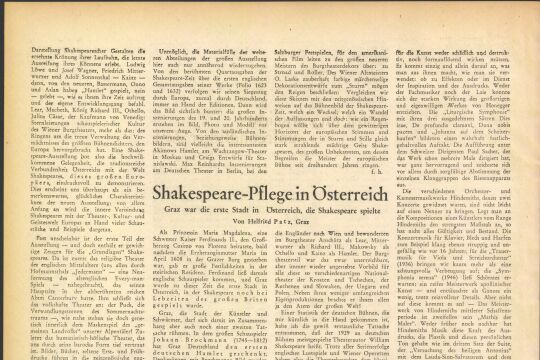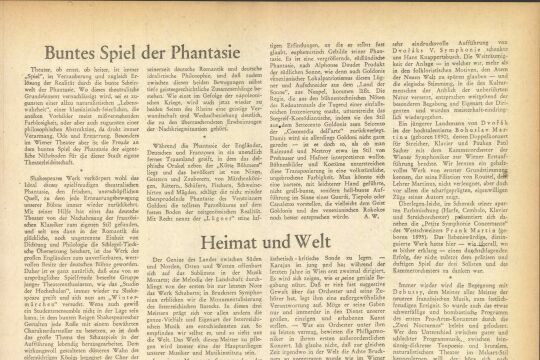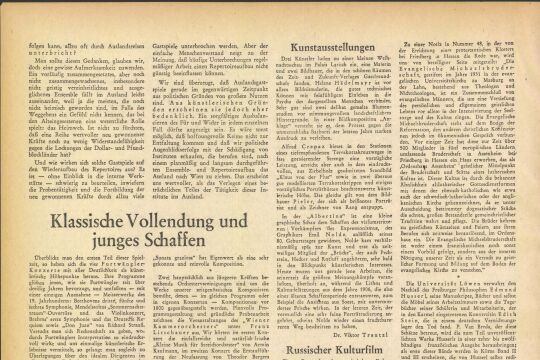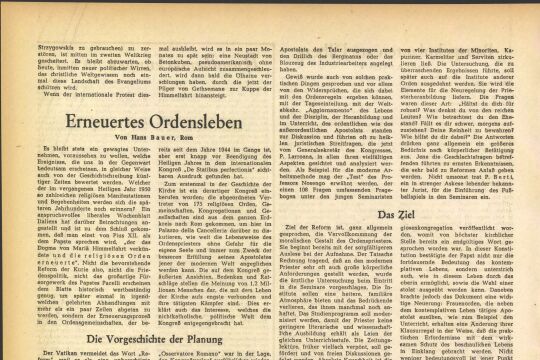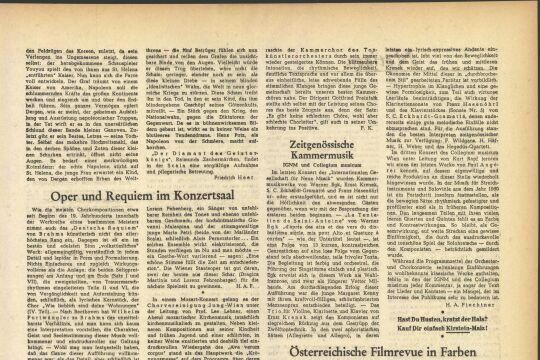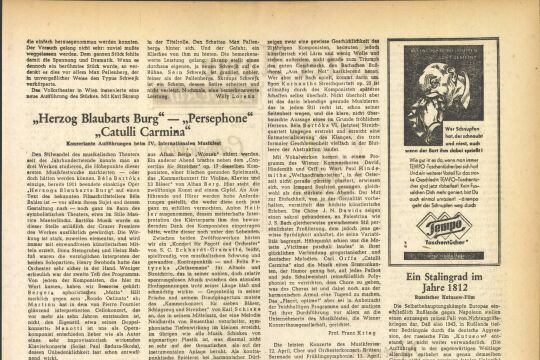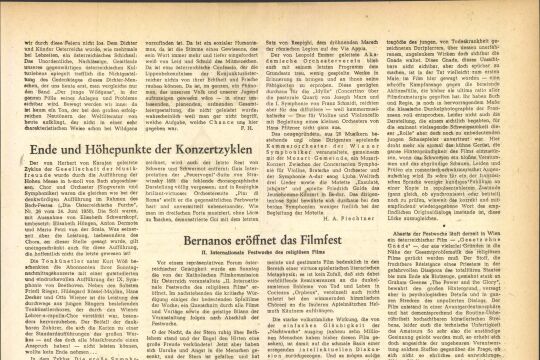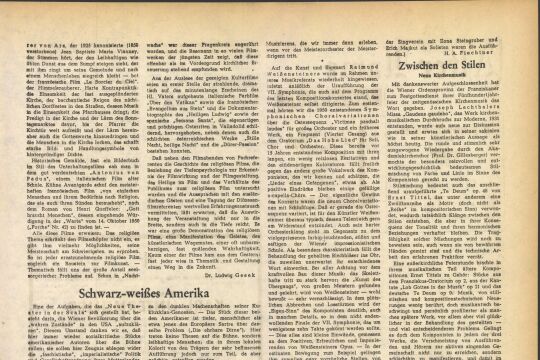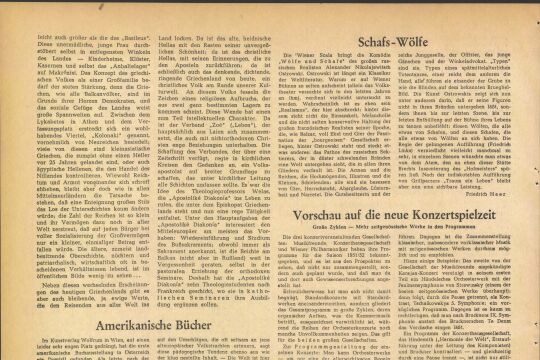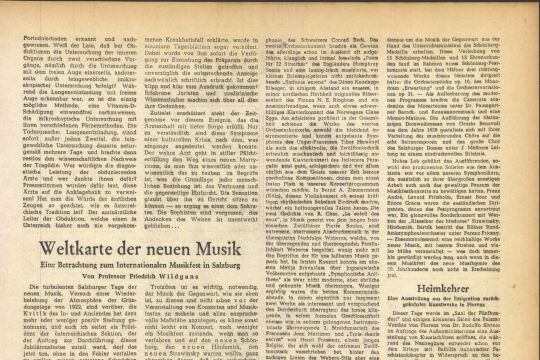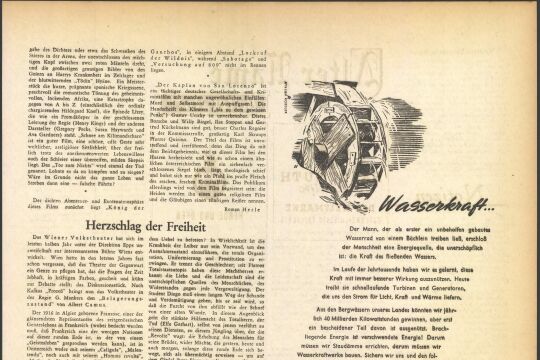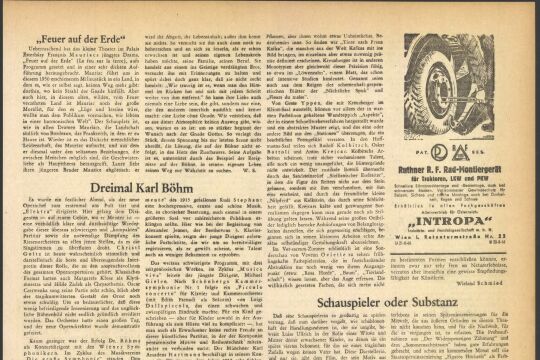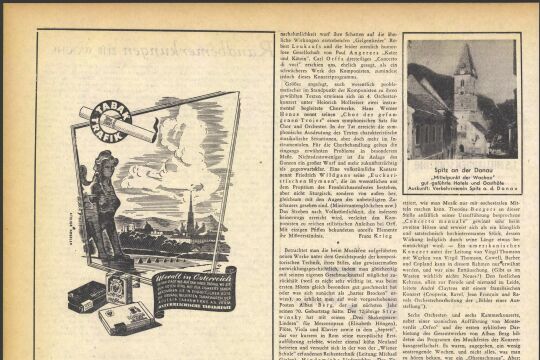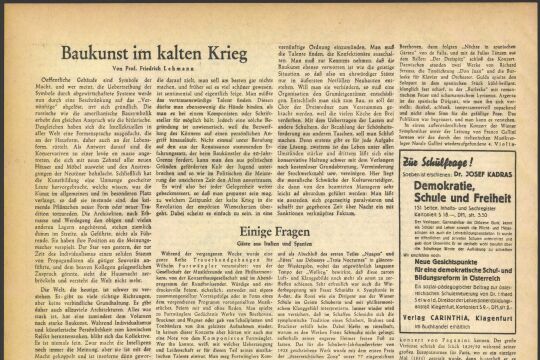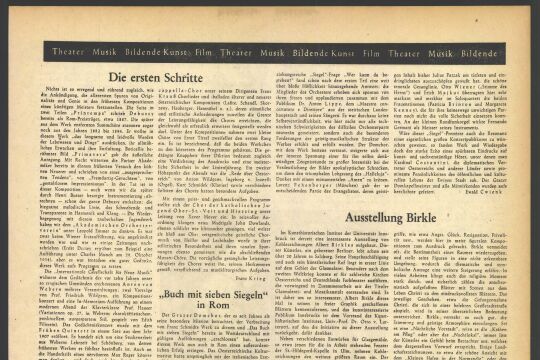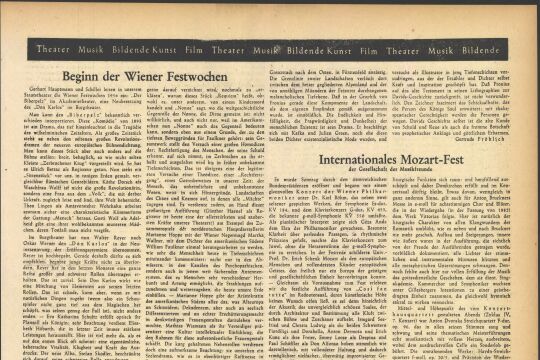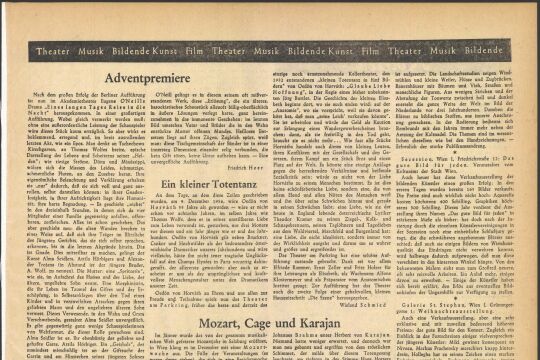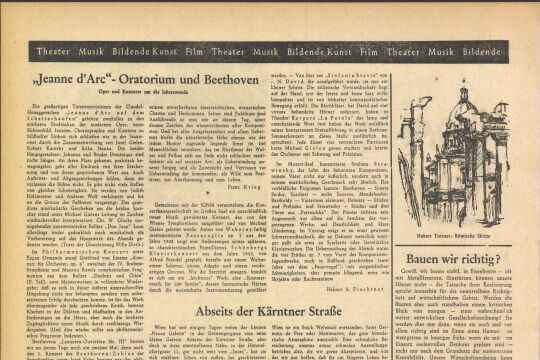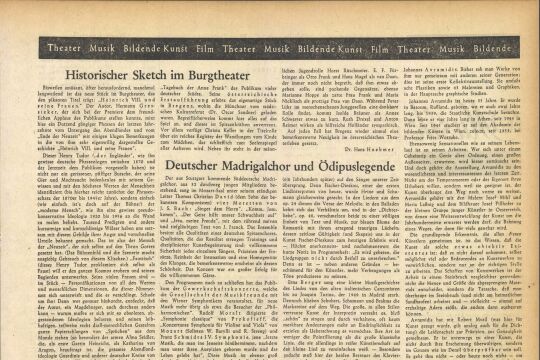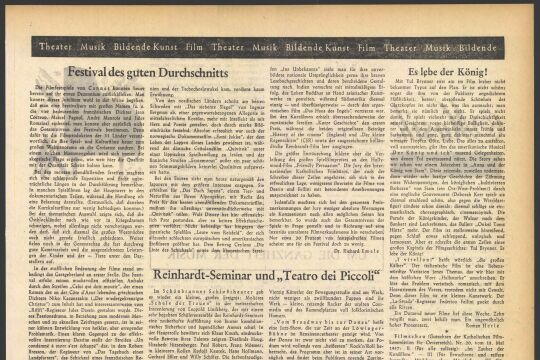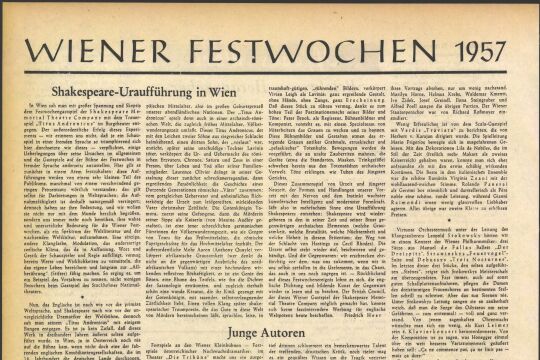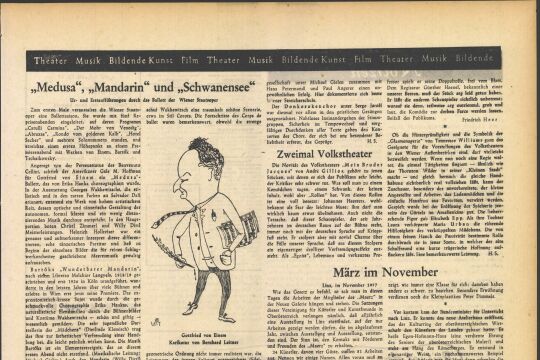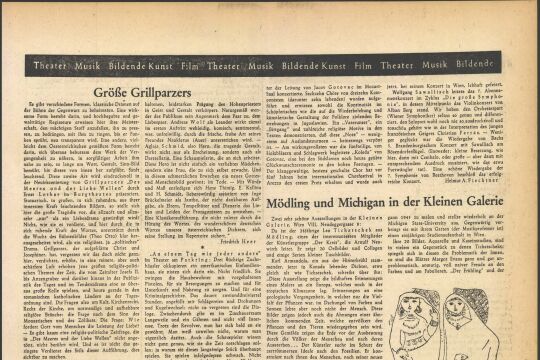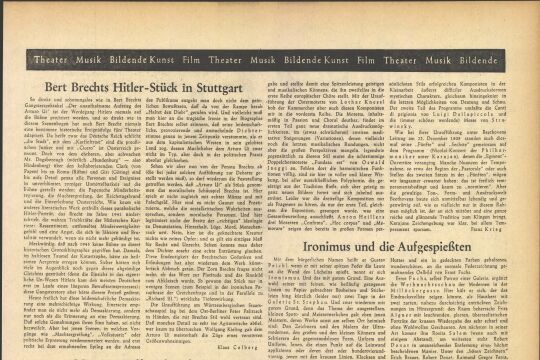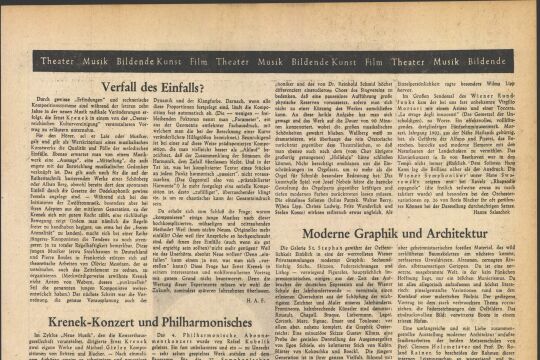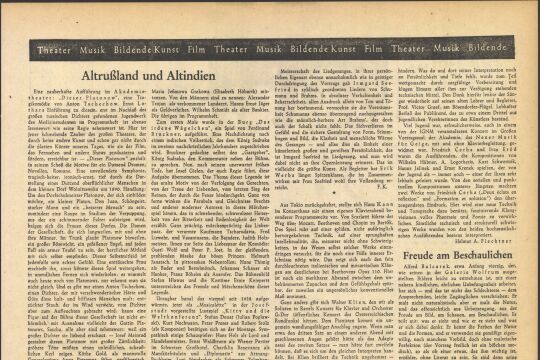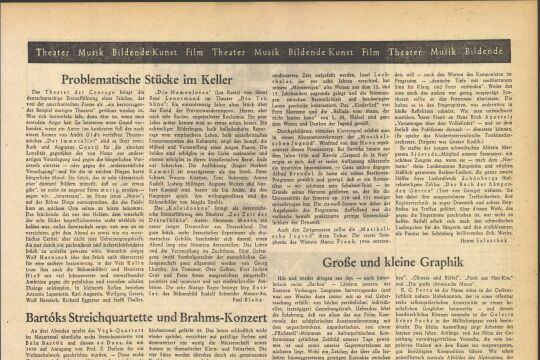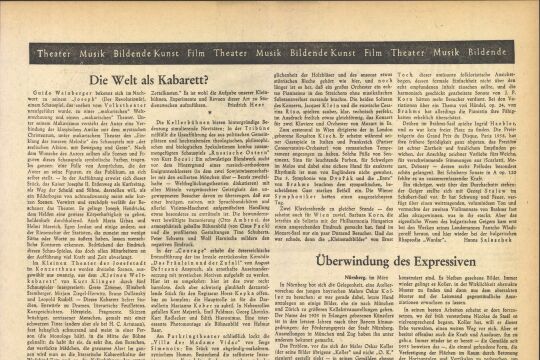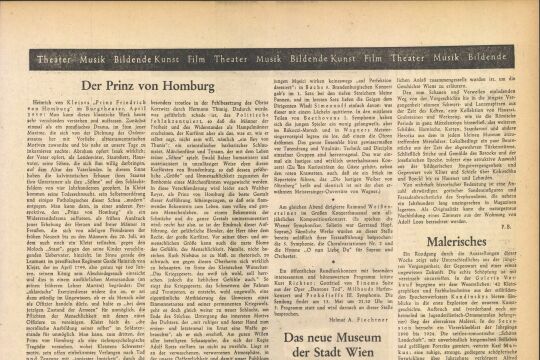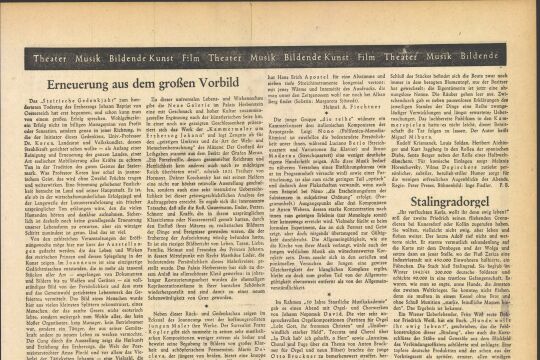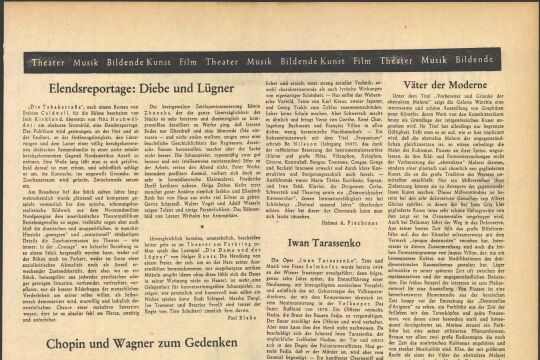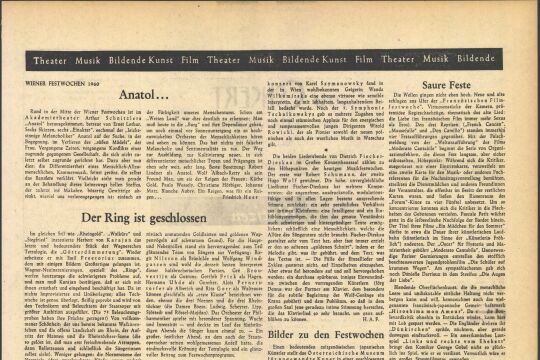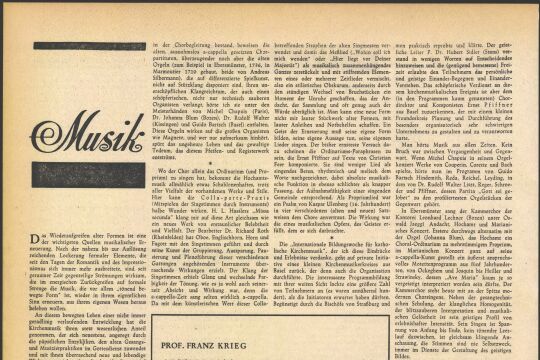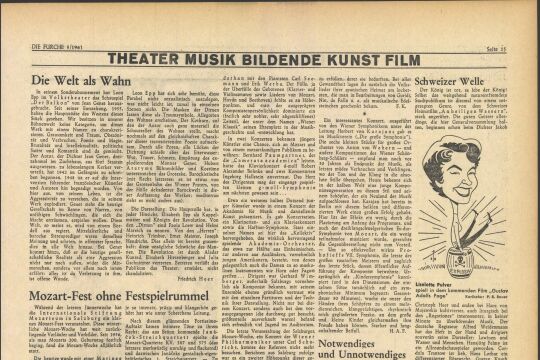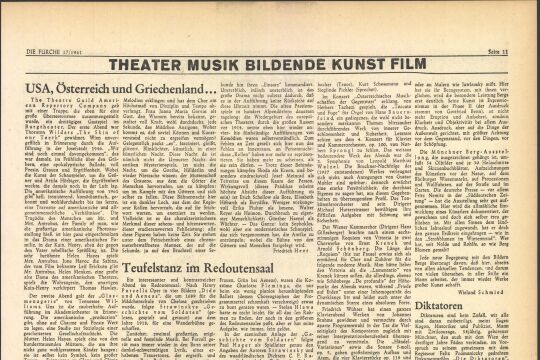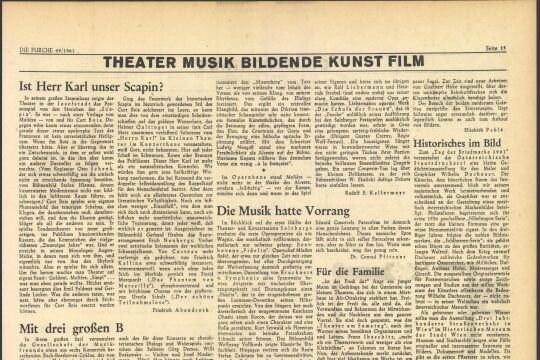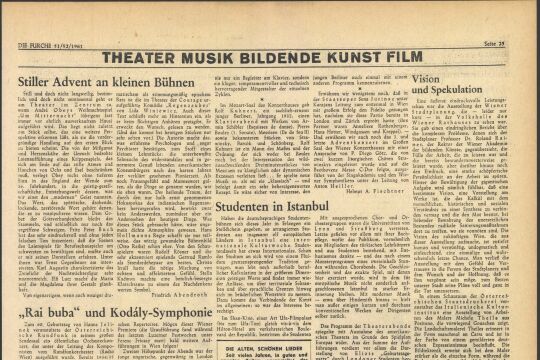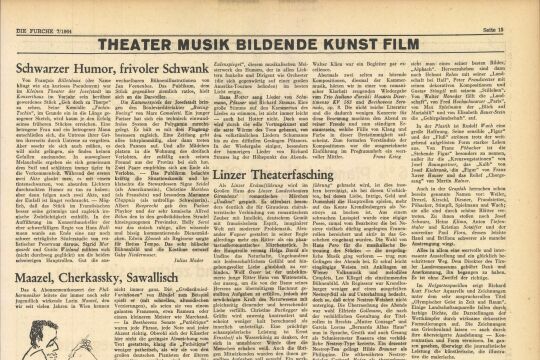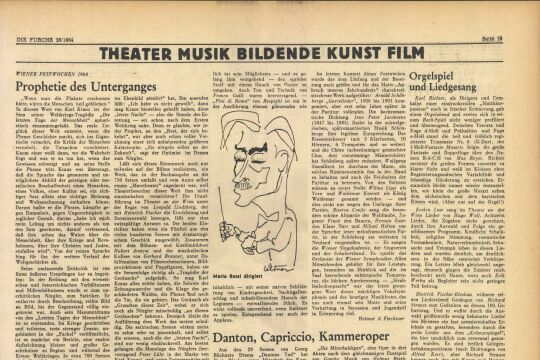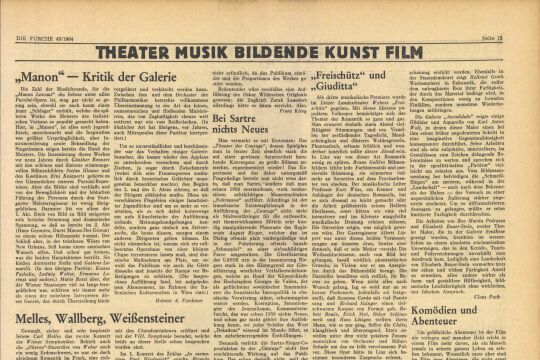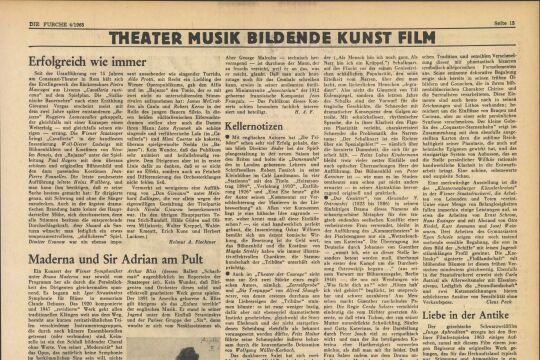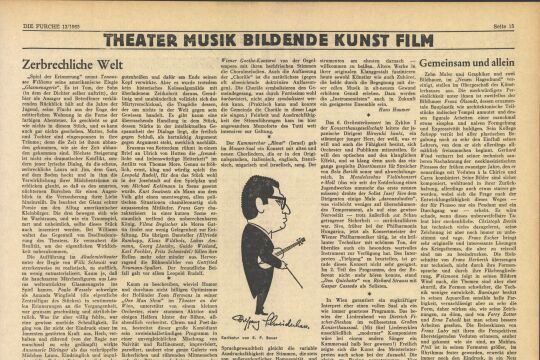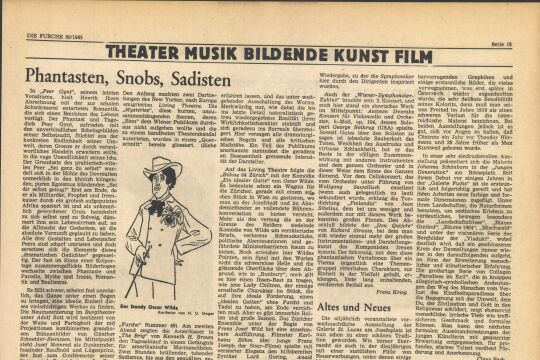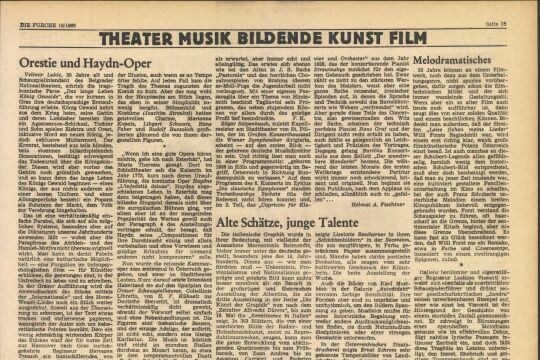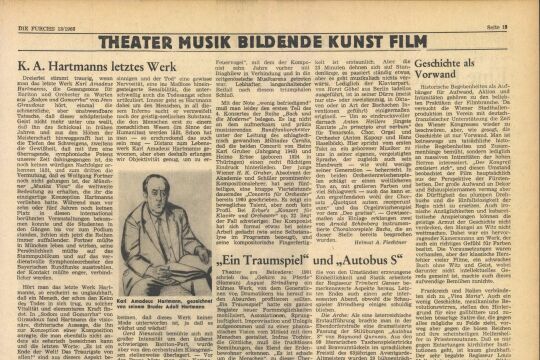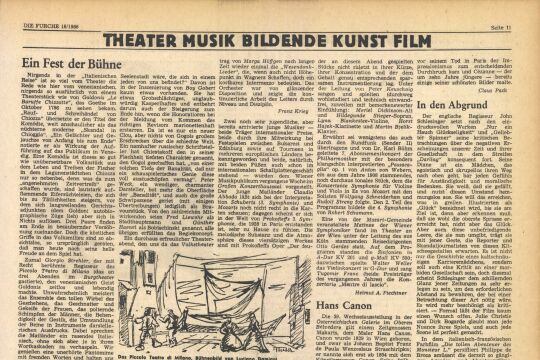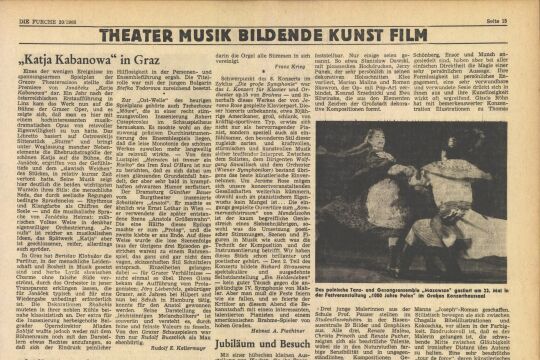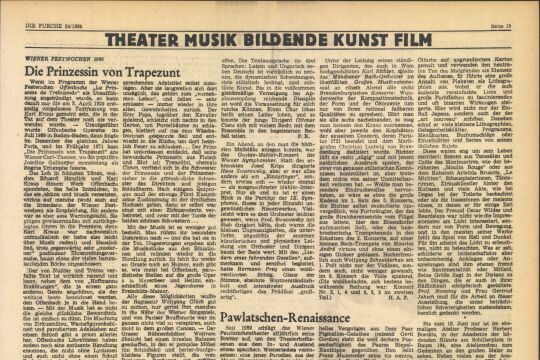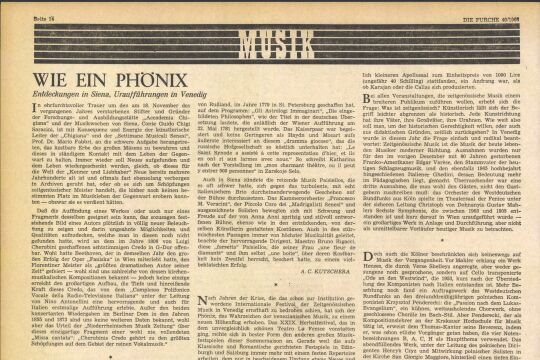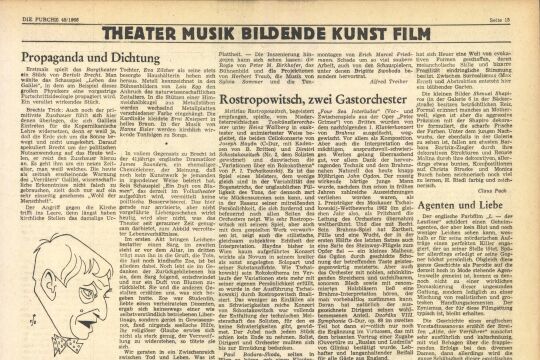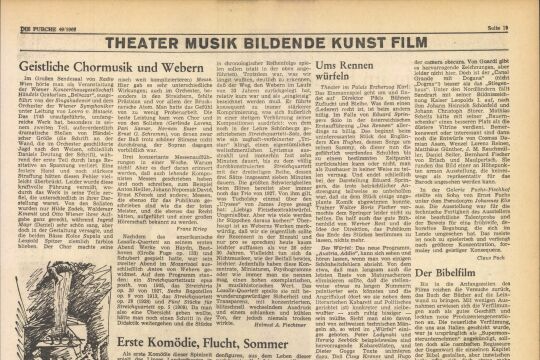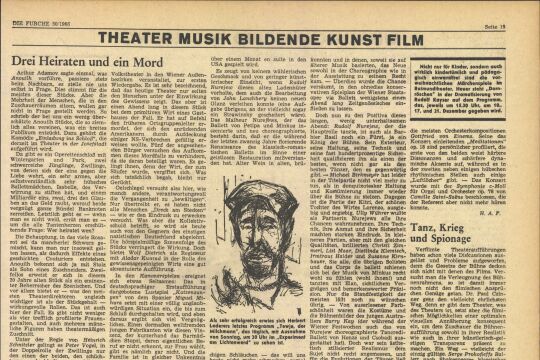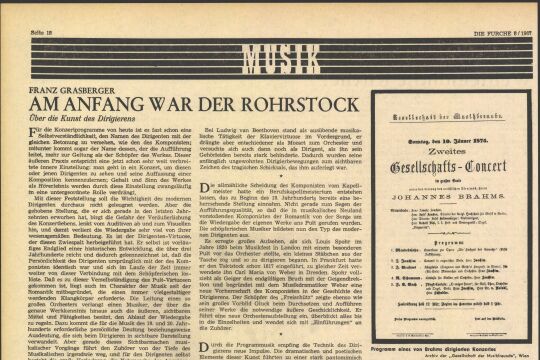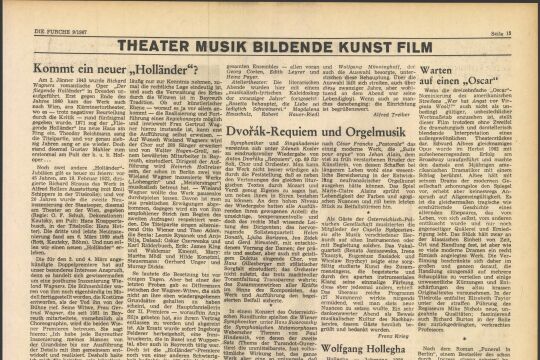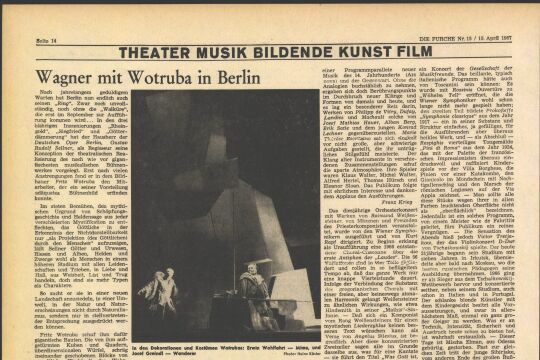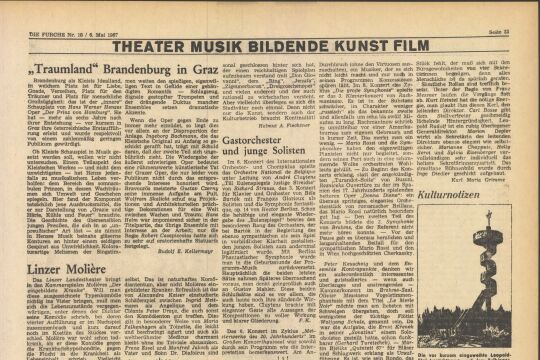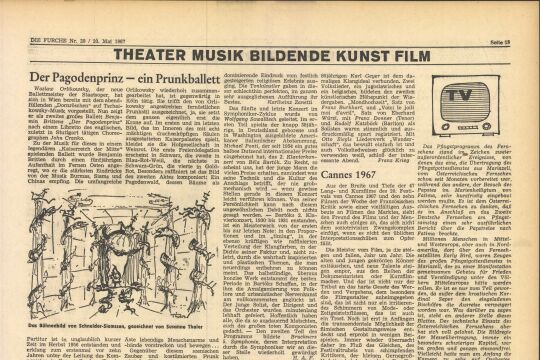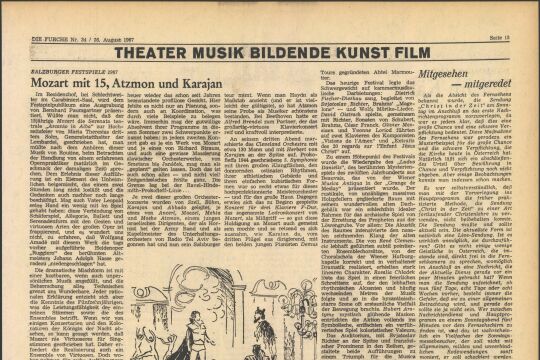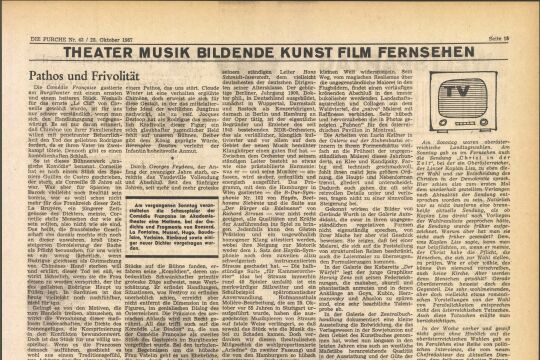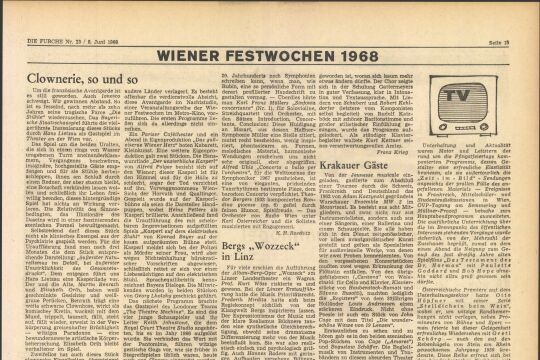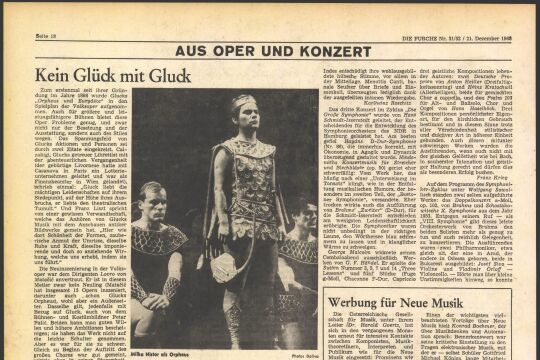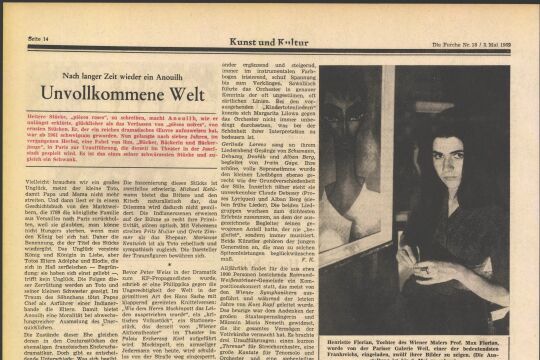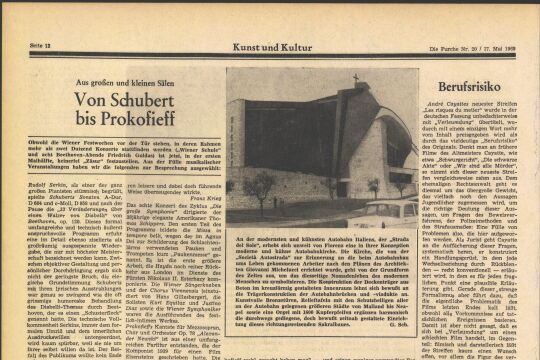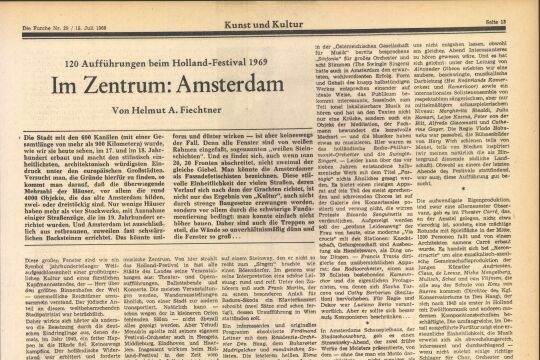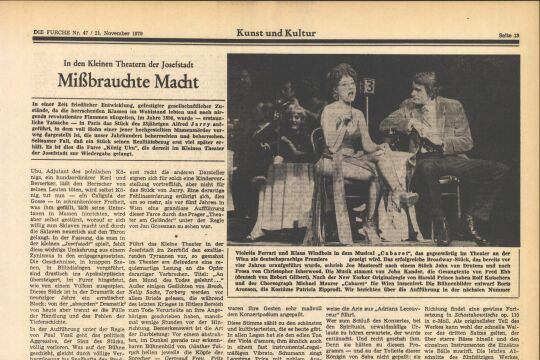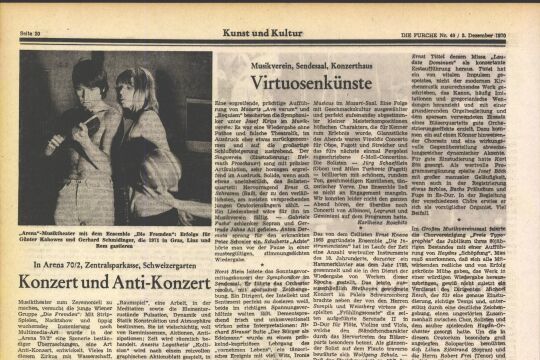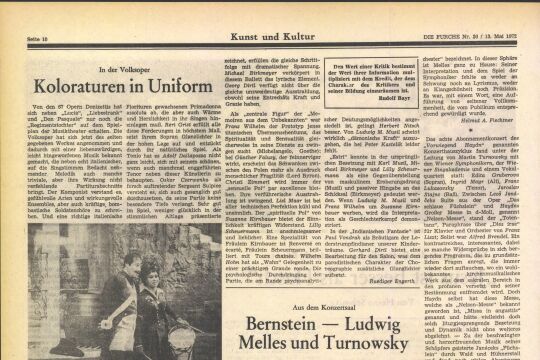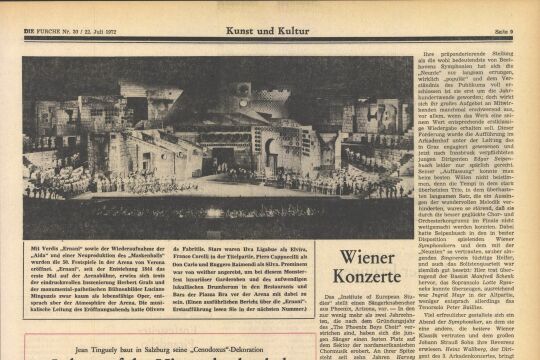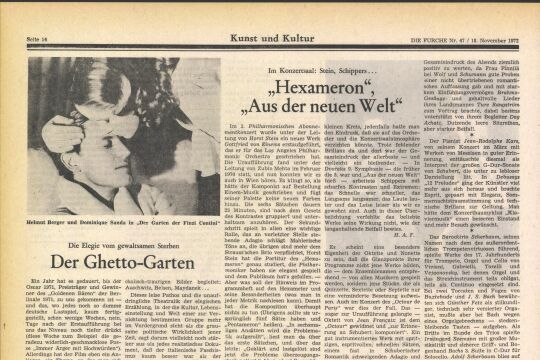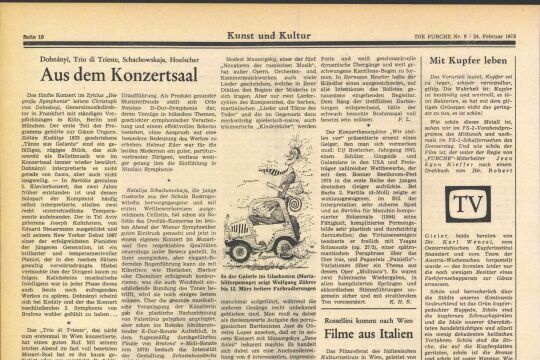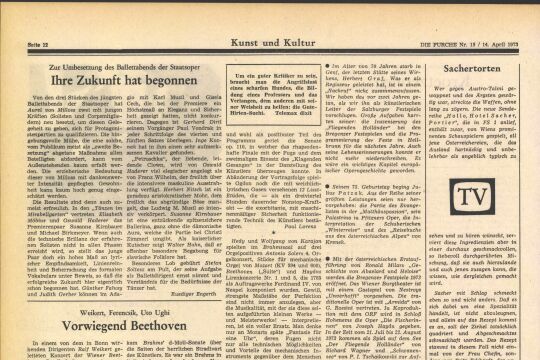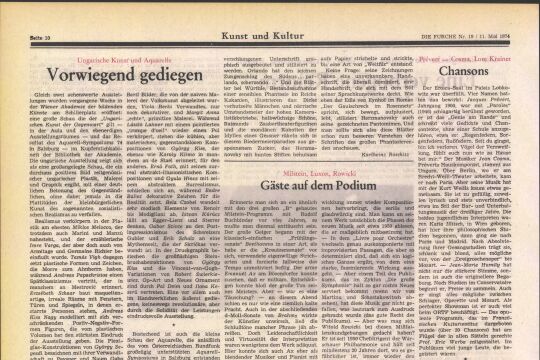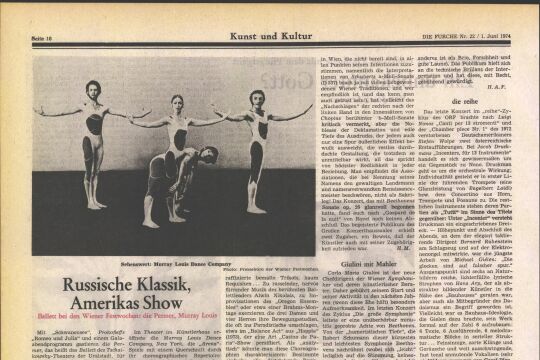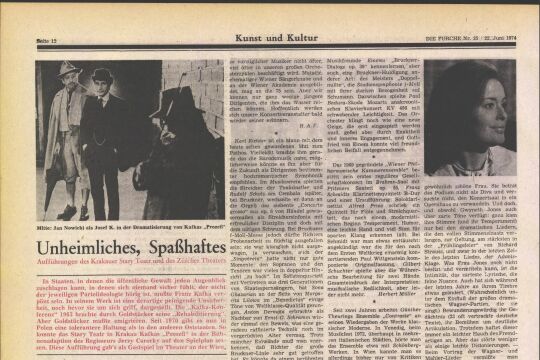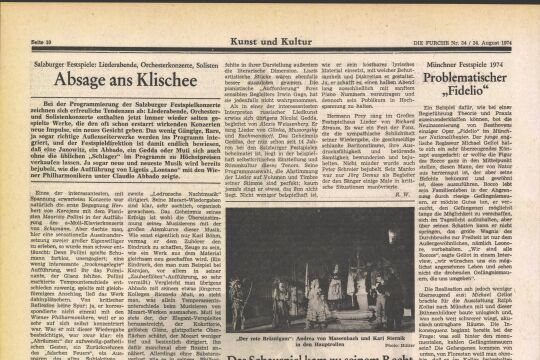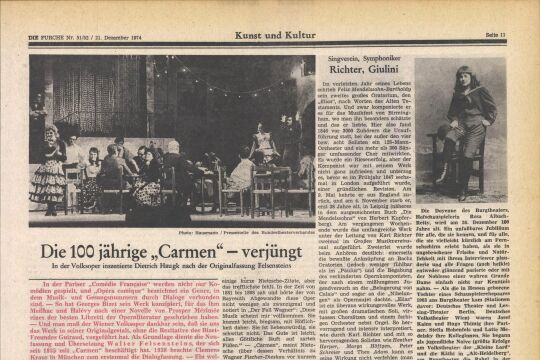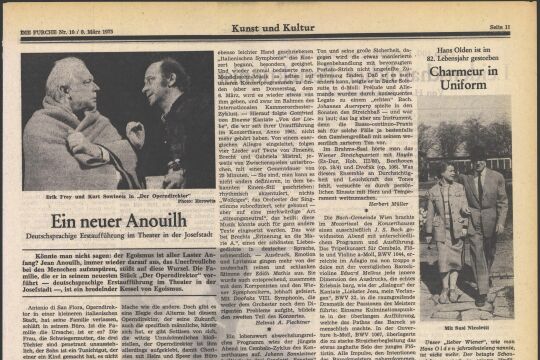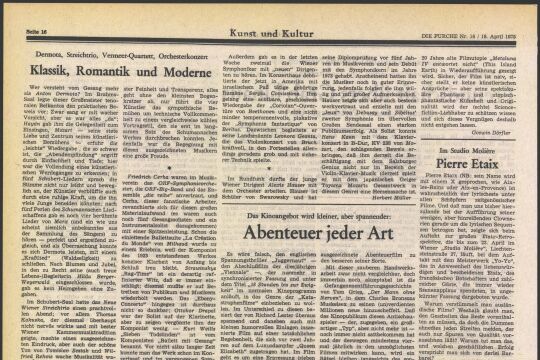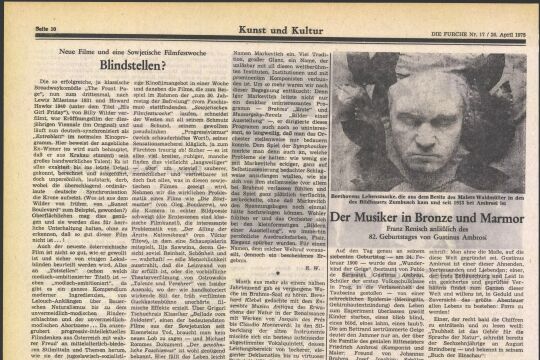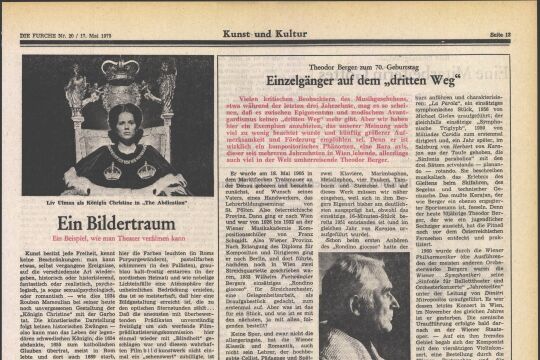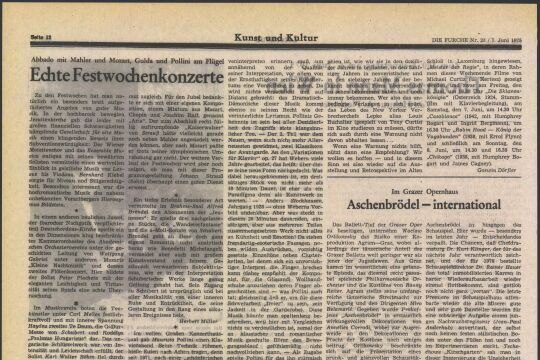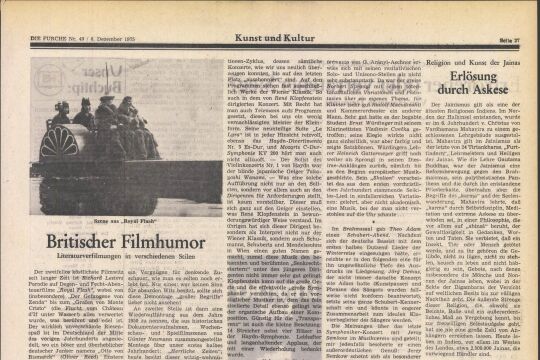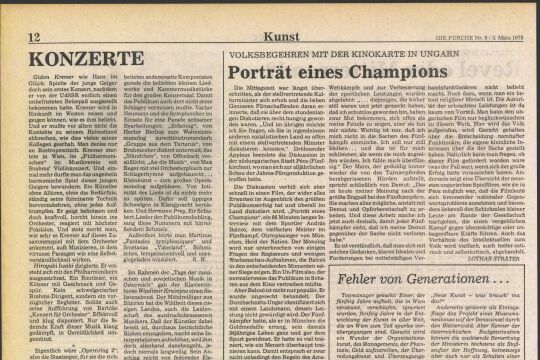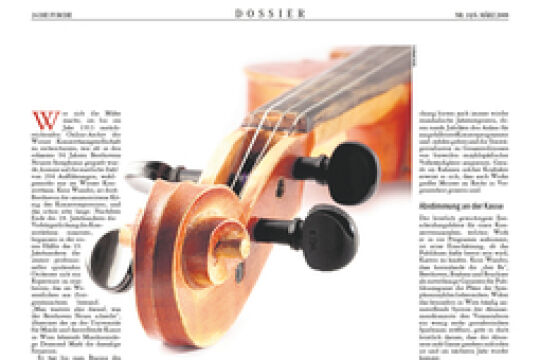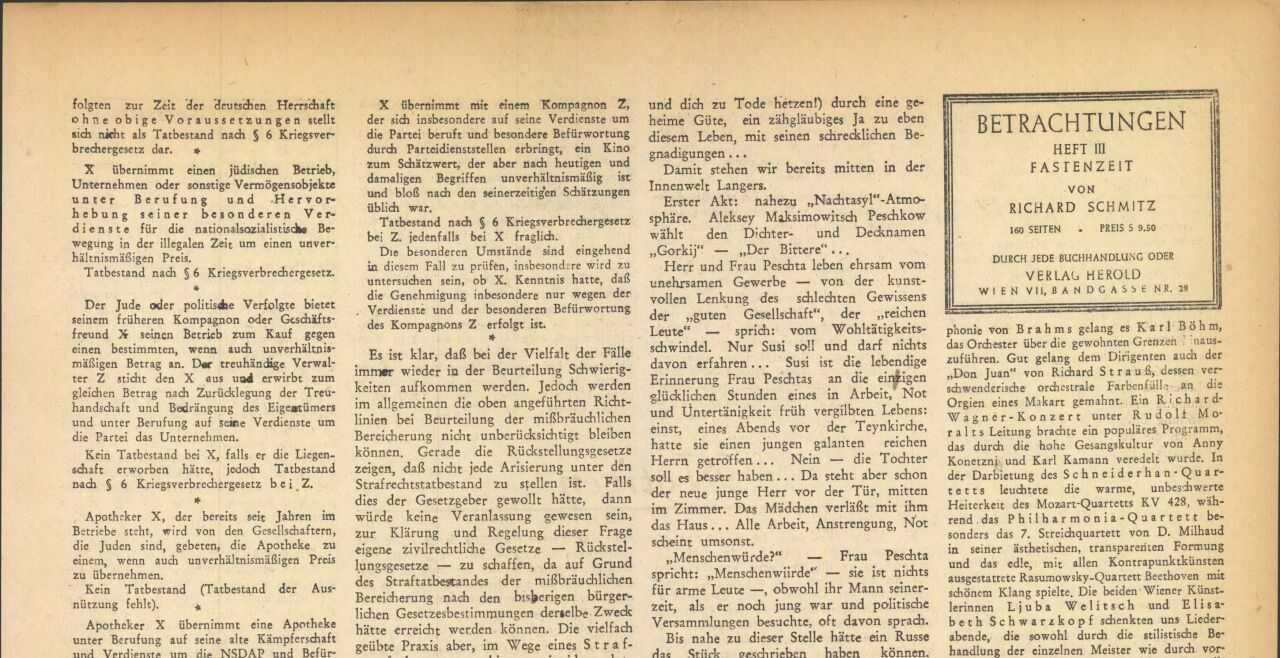
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Instrumental-Konzert
Unter „Konzert” verstand man im 16. Jahrhundert eine Kompositionsform, bei der ein instrumentaler und ein vokaler Klangköper um die Vorherrschaft stritten. Später unterschied man zwischen dem weltlichen instrumentalen Kammerkonzert (Concerto da camera) und dem Kirchenkonzert (Concerto da chiesa). Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde erstmalig eine kleine Gruppe von Soloinstrumenten oder eine Solovioline dem vollen Orchester gegenübergestellt. Hieraus entwickelte sich sowohl das Concerto grosso, dessen Form noch in Beethovens Tripelkonzert und Brahms’ Doppelkonzert nachwirkt, und das eigentliche Solokonzert.
Concertare heißt wetteifern, und man verstand darunter den edlen musikalisch-technischen Wettstreit zwischen den Solisten und dem übrigen Orchester. Dieser Wettstreit spielt, sich in den Konzertsälen Wiens gegenwärtig auf einer ziemlich anspruchslosen Stufe in der Form eines Wettkampfes um die dynamische Vorherrschaft ab. Was die Qualität der künstlerischen Leistung anbetrifft, haben sich Solisten, Dirigenten und Orchester nicht viel vorzuwerfen. Es wird allgemein empfunden und zugegeben, daß uns wirklich überragende Instrumentalsolisten fehlen. Wo wären die Nachfolger eines Paganini oder Liszt, und wo der orphische Sänger, der unser Ohr verzauberte, wie das unserer Väter und Großväter? Ob wir diesem Typus des Künstlers nachtrauern sollen und ob er in unsere Zeit und Musikkultur paßte, ist eine andere Frage. Doch haben wir keinen Grund, an der subjektiven und objektiven Richtigkeit des Urteils der älteren Generation zu zweifeln, die behauptet, die Zeit der großen Solisten wäre dahin und entschwunden. Dagegen können wir nichts tun. Aber man kann dafür sorgen und sollte es sich sehr angelegen sein lassen, daß die Begleitung der Solistenkonzerte sorgfältiger vorbereitet wird und nicht jene unausgeglichenen, improvisatorischen Auf. führungen überhandnehmen, denen man mit Sorge entgegensieht und nach denen man erleichtert aufatmet, wenn nichts allzu Schlimmes „passiert” ist.
Unter unseren heimischen Geigern nimmt Wolfgang Schneiderhan heute zweifellos die erste Stelle eiin. Während wir bisher nur das klassische, zuweilen fast akademische Ebenmaß seiner Darbietung anerkennen konnten — verbunden mit einem sehr schönen, runden Ton und einer völlig einwandfreien Technik —, schlug uns in seiner Wiedergabe des Violinkonzertes von Brahms im dritten Orchesterkonzert der Konzerthausgesellschaft unter Ferencsik zum erstenmal der warme Atem intensiven Erlebens und persönlicher Durchdringung des Kunstwerkes entgegen.
Der Londoner Pianist Alfred Kitchin spielte das zweite Klavierkonzert von Rachmaninov in einem Russischen Konzert der Symphoniker unter Rudolf Moralt. Es war eine saubere Durchschnittsleistung die keinen bleibenden Eindruck hinterließ. Die Begleitung zeigte einige von jenen Mängeln, von denen wir eingangs sprachen.
Ein wertvolles, neues Orgelkonzert, das die nicht eben große Zahl dieser Gattung vermehrt, lernten wir in Hindemiths op. 4 6 kennen. Nikus dirigierte das „Konzert für Orgel und Kammerorchester” im Rahmen eines Sonntagnachmittagskonzertes. Anton Heiller hat den Geist des Werkes trefflich erfaßt und spielte mit großer Leichtigkeit und virtuoser Bravour. Die geschmackvolle und diskrete Registrierkunst des jungen Organisten bewährte sich auch in diesem Werk, und auch die Mitglieder des begleitenden Tonkünstlerorchesters zeigten sich den hohen Anforderungen der mod rnen Komposition gewachsen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!