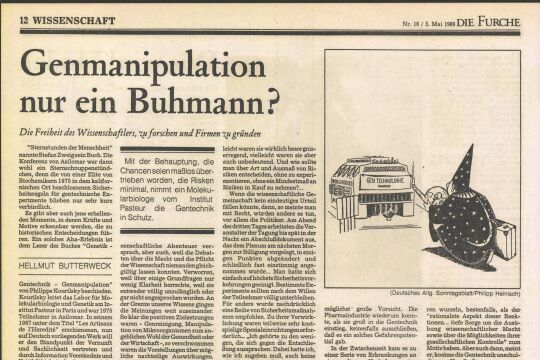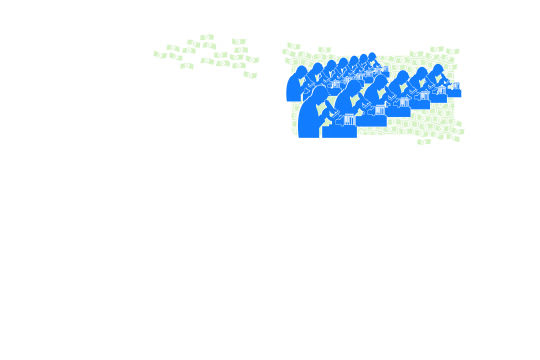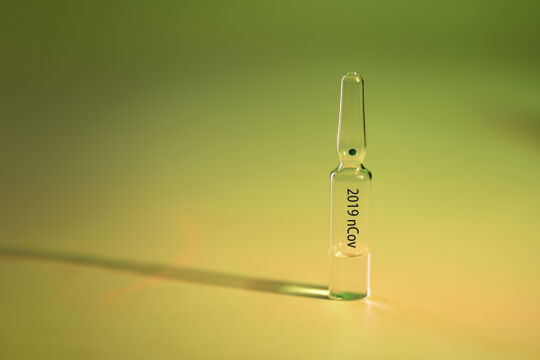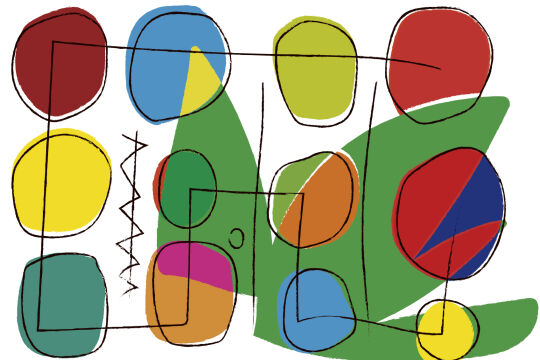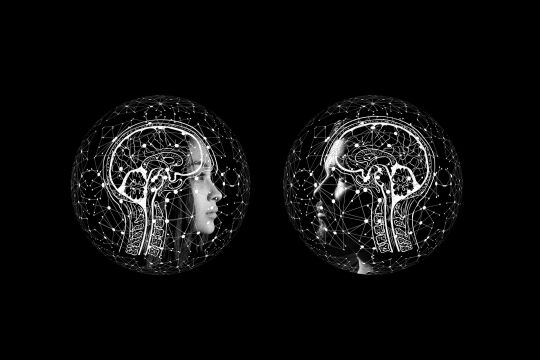AUSTAUSCH auf Augenhöhe
Raus aus dem Elfenbeinturm - heute sind Offenheit und Transparenz angesagt: Helga Nowotny über den Wandel der Wissenschaftswelt.
Raus aus dem Elfenbeinturm - heute sind Offenheit und Transparenz angesagt: Helga Nowotny über den Wandel der Wissenschaftswelt.
In ihrer Laufbahn ist Helga Nowotny stets am Puls der Wissenschaft geblieben: Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Wien und der Soziologie an der Columbia-Universität in New York wurden Wissenschaft und Technik zum Fokus ihrer Forschungen. Als Professorin lehrte sie zuletzt an der renommierten ETH Zürich. Von 2010 bis 2013 war sie Präsidentin des Europäischen Forschungsrats (ERC), der die Grundlagenforschung in der Europäischen Union fördert. Heute ist sie Vorsitzende des Gremiums "ERA Forum Council Austria", das den österreichischen Wissenschaftsminister an der Schnittstelle von europäischer und nationaler Forschungspolitik berät.
DIE FURCHE: Der Begriff der "offenen Wissenschaft" steht heute in der Agenda der europäischen Forschungspolitik ganz oben. Manche sprechen gar von "Science 2.0", einem radikalen Upgrade der Forschung. Wird jetzt alles anders?
Helga Nowotny: Ich sehe zwei gegenläufige Entwicklungen: Eine geht in Richtung einer neuen Öffnung der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft. Sie erhält kräftigen Aufwind durch die zunehmende Bedeutung, die große Datensätze in vielen Wissenschaften erhalten. Dazu kommt, dass die Digitalisierung quer durch die etablierten Grenzziehungen zwischen Experten und Laien verläuft. Das Internet hat den Zugang zum Wissen großteils demokratisiert. Für die heranwachsende Generation ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, dass man sich Information über die digitalen Medien beschafft und sich in Netzwerken bewegt. "Citizen Science" versucht, die aktive Mitwirkung von Laien im Forschungsprozess zu fördern. Das geht so weit, dass sogar eine gemeinsame Autorenschaft an wissenschaftlichen Publikationen entsteht. Übrigens wird eine solche Öffnung seit langem im technologischen Innovationsprozess praktiziert. Firmen haben früh erkannt, dass es sich lohnt, die Nutzer ihrer Produkte in die Entwicklung einzubeziehen und von deren Erfahrung zu lernen.
DIE FURCHE: Aber gibt es tatsächlich eine Demokratisierung und Verbreiterung des Wissens? Manche Forscher beklagen, dass die institutionelle Wissenskultur heute zunehmend eng geführt wird ...
Nowotny: Das ist die erwähnte gegenläufige Entwicklung: In vielen Ländern sehen wir, dass Regierungen und Forschungsförderer darauf bestehen, schon bei der Antragstellung von Forschungsprojekten deren sozioökonomischen Nutzen zu berechnen. Der "Vertrag" zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, der metaphorisch immer wieder beschworen wird, wird formalisiert: Um die Vertragserfüllung zu überprüfen, werden Indikatoren, ständiges Monitoring und "Bench-Marks" eingerichtet. Das erhöht zwar die Effizienz, führt aber auch dazu, dass weniger Raum für Unvorhergesehenes und Kreativität bleibt. Hier geht es wie immer darum, die richtige Balance zu finden.
DIE FURCHE: Wie bewerten Sie die aus dem Boden schießenden Projekte der "Citizen Science", dem wachsenden Bereich der Bürgerbeteiligung an der Forschung?
Nowotny: Das Potenzial ist enorm groß, vor allem in den Lebenswissenschaften, der Biomedizin, und im Umweltbereich. Und die Astronomie hat ja seit langem eine Fan-Gemeinschaft, die mitarbeitet, etwa um neue Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu entdecken. Durch "Citizen Science" soll die Forschung zumindest teilweise in die Gesellschaft getragen werden. Kinder können durch einfache Experimente lernen, wie man diszipliniert Beobachtungen durchführt, diese analysiert, vergleicht und mit anderen bespricht, um dann zu einer gültigen Interpretation zu kommen. Das ist ungemein bereichernd und für das weitere Leben von Nutzen. Erwachsene können ihre besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen und sich als Teil einer Gruppe fühlen, die gemeinsam Lösungen erarbeitet. Die Grenzen von "Citizen Science" freilich liegen dort, wo der Unterschied zwischen Experten und Laien nicht aufgehoben werden kann. Die größte Herausforderung ist jedoch, von den vielen kleinräumigen und kurzfristigen Initiativen in einer Art Quantensprung zu einer echten Professionalisierung zu gelangen. Das schließt Qualitätskontrolle mit ein. Es ist machbar, aber nicht einfach - doch notwendig, wenn wir auch nur einen Bruchteil dessen realisieren wollen, was Wissenschaft und Technik heute ermöglichen.
DIE FURCHE: Wird die Öffnung der Wissenschaft deren Verhältnis zur Gesellschaft generell neu ordnen?
Nowotny: Vor nicht zu langer Zeit dachten Wissenschaftler, dass es genügt, die Bevölkerung aufzuklären, um ohne weitere Fragen ihre reibungslose Unterstützung zu erhalten. Heute spricht man auch an den Universitäten und in vielen Forschungsinstituten von "Verantwortlicher Forschung und Innovation", kurz RRI. Diese hat auf EU-Ebene mit der Rom-Deklaration von 2014 einen offiziellen Status erhalten. Es geht darum, gesellschaftliche Bedürfnisse und Anliegen stärker in die Wissenschaft zu verlagern. Im Hintergrund steht die Notwendigkeit, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Problemlösungskapazität der Wissenschaft wieder herzustellen und sie davon zu überzeugen, dass Innovation, wenn sie verantwortlich betrieben wird, dem gesellschaftlichen Nutzen dienen kann. Neu dabei ist die Einsicht, dass diese "Verantwortliche Forschung" - RRI - nur funktionieren kann, wenn der Austausch auf Augenhöhe stattfindet und von gegenseitigem Respekt getragen wird.
DIE FURCHE: Wie sehen Sie die Rolle Österreichs im Rahmen dieser Entwicklung?
Nowotny: Die Ergebnisse der regelmäßig durchgeführten Eurobarometer-Umfragen stellen uns ein schlechtes Zeugnis aus: Österreich liegt bei der Einschätzung, ob Wissenschaft und Technologie insgesamt einen positiven Einfluss hat, im Mittelfeld. Aber 69 Prozent der Österreicher geben an, dass sie sich nicht genügend informiert fühlen und 55 Prozent geben offen zu, daran auch nicht interessiert zu sein. Hier offenbart sich ein tiefer liegendes Problem. Doch es gibt auch das Gegenteil. Exemplarisch ist hier die europaweit einzigartige Initiative der Ludwig Boltzmann-Gesellschaft zur gezielten Öffnung von Forschungsprozessen in den Gesundheitswissenschaften. Die Initiative "Open Innovation in Science" beabsichtigt, sich bei Betroffenen, Angehörigen, Pflegenden, Ärzten und Therapeuten zu erkundigen, welche Forschungsfragen zu psychischen Erkrankungen ihrer Meinung nach aufgegriffen werden sollten.
Ziel ist es, den Erfahrungshorizont der Forschung zu erweitern und diese näher an die tatsächlichen Bedürfnisse der Betroffenen heranzurücken. Zugleich wird ein Ausbildungsprogramm gestartet, in dem Wissenschaftler Methoden erlernen, um die Anregungen aus der Öffentlichkeit in die Forschungsagenda einbauen zu können.
DIE FURCHE: Welche Veränderungen bringt "Open Access", der angestrebte freie Zugang zu den wissenschaftlichen Ergebnissen?
Nowotny: Die "Open Access"-Bewegung ist innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft entstanden: Sie ist eine Art Revolte gegen die exzessiven Preissteigerungen der wissenschaftlichen Verlage. Ziel war und bleibt es, deren Monopolstellung zu brechen. So entstanden die ersten "Open Access"-Publikationen wie "PLOS" oder "ar-Xiv" für die Physik. Forscher haben nicht eingesehen, weshalb sie für die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse auch noch bezahlen sollen, wenn sie für dieselben Verlage umsonst als Gutachter tätig sind. Um "Open Access" umfassend durchzusetzen, braucht es allgemeine Richtlinien auch der Forschungsförderer. Die Herausforderung liegt darin, eine allseits akzeptierte Lösung zu finden, Ergebnisse öffentlich und möglichst umsonst zugänglich zu machen. Doch letzten Endes muss jemand dafür bezahlen.
DIE FURCHE: Der britische Wissenschaftsjournalist Michael Brook behauptet in seinem neuen Buch "Freie Radikale", die Forschung sei zu brav und "domestiziert" geworden. Die politischen Rahmenbedingungen seien viel eher an Kreativität und Genialität auszurichten. Was halten Sie davon?
Nowotny: Der geniale Einzelkämpfer wird von den Medien noch immer gerne hochstilisiert, doch in der wissenschaftlichen Praxis hat er längst ausgedient. Wissenschaftliches Arbeiten ist beides: hoch kompetitiv und enorm kooperativ. Natürlich entstehen nach wie vor Ideen im Kopf Einzelner, doch es braucht die Forschungsgruppe, um sie weiter zu entwickeln und umzusetzen. Es braucht den weltweiten Austausch mit Kollegen, die irgendwo auf der Welt an ähnlichen Problemstellungen arbeiten, aber ebenso die kritische Masse im eigenen Labor, an einer Forschungsinstitution und an den Universitäten.
DIE FURCHE: Was wäre denn Ihre Vision einer "offenen Wissenschaft"?
Nowotny: Eine solche wird sich nur durchsetzen können, wenn sie von den Rändern ins Zentrum vordringt. Dem Druck, möglichst viel in "High Impact"-Fachzeitschriften zu publizieren und dies als einziges Qualitätsmerkmal anzusehen, muss widerstanden werden. Er führt zu perversen Effekten, vor allem zu einer Art Selbstzensur beim wissenschaftlichen Nachwuchs. Um ihre Karrierechancen zu wahren, glauben viele junge Wissenschaftler, sich nur an formalen Erfolgskriterien orientieren zu müssen. Dann kommt es auch zu negativen Begleiterscheinungen wie wissenschaftlicher Missbrauch: Die Zahl der Publikationen, die widerrufen werden mussten, war noch nie so hoch wie jetzt. Gutachter sind überfordert und das "Peer-Review"-System ist an seine Grenzen gelangt. In meiner Vision braucht es daher viel mehr kompetente Rebellen: Wissenschaftler, die multiple Kompetenzen erworben haben und wissen, dass Exzellenz mehrdimensional ist - aber auch den Mut und die Weitsicht haben, gegen den Mainstream zu schwimmen, wenn sie es im Sinn einer offenen Wissenschaft für richtig halten.